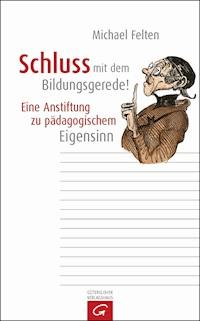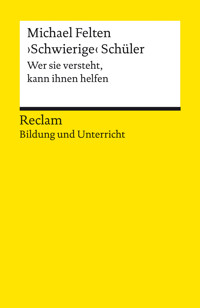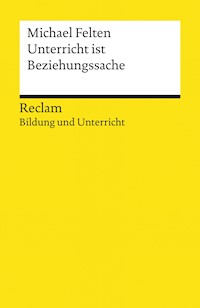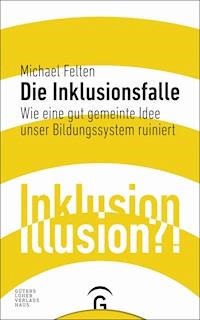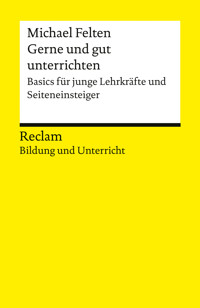
Gerne und gut unterrichten. Basics für junge Lehrkräfte und Seiteneinsteiger E-Book
Michael Felten
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Bildung
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Erfolgreich in den Beruf als Lehrkraft starten Ein kompakter und praxisnaher Überblick über alle Aspekte, die für einen erfolgreichen Berufseinstieg als Lehrkraft entscheidend sind: Wie bewältige ich den vorgesehenen Stoff? Wie gestalte ich den Unterricht interessant und lernwirksam? Wie gehe ich erfolgreich mit Störungen um? Was ist bei der Notengebung zu beachten? Und was tun bei Selbstzweifeln und Überlastung? Mit vielen ganz konkreten Beispielen und weiterführenden Hinweisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Michael Felten / Michael Storch
Gerne und gut unterrichten
Basics für junge Lehrkräfte und Seiteneinsteiger
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962502
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962502-7
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014732-0
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Prolog
Präambel: Ein Grundgesetz für Lehrkräfte?
Stoff bewältigen, Stunden gestalten
a) Bildungsinhalte – die Auswahl macht’s!
b) Welche Unterrichtsformen sind lernwirksam?
Ruhig auch mit dem Plenum arbeiten
Lernt man Selbständigkeit durch Selbständigkeit?
Geht’s gemeinsam besser?
Ab und zu Rollentausch: Schüler als Lehrende
c) Auf das Unterrichtsklima kommt es an!
Die Beziehung macht’s
Ermutigung tut unendlich gut
Zauberwort Fehlerfreundlichkeit
d) Klassenführung – den ganzen Haufen im Griff behalten
Schwung und Sog
Die Lerngruppe als Solidargemeinschaft
Classroom Management: einfach gerne Leitwolf sein
Ist Strenge unanständig?
Konflikte nicht ersticken, sondern bearbeiten
e) So geht’s konkret
Eine ganz normale Mathestunde
Überlegungen zu einer Deutschsequenz
Rechtschreibunterricht – scheinbar altmodisch, aber hochwirksam
Schwierigkeiten erkennen, mit Störungen umgehen
a) Unruhige Klassen
b) Chronische Störer
c) Heikle Elterngespräche
d) Schwachstellen von Lehrkräften
Stein für Stein: die Klippen des Schulalltags
a) Fünftklässler – lernt man in der Grundschule heute eigentlich nichts mehr?
b) Noten – Teufelszeug oder sakrosankt?
c) Berechtigungen – weich oder ehrlich?
d) Mathe – zu schwer?
e) Digitalisierung – überschätzt?
f) Fördern – manchmal uferlos?
g) ›Behinderte‹ Kinder in der Klasse – ein Problem?
h) Irritierende Meinungen – unterbinden?
Schulentwicklung nüchtern sehen
a) Inklusive Bildung
b) Neue Prüfungskultur
c) Pädagogische Freiheit
Ausblick: Und was tun bei Selbstzweifel, Überlastung, Ausstiegsgedanken?
Epilog: Schule – ein Glücksfall
Links & Literatur
Zu den Autoren
[7]Prolog
DER INTERESSIERTE:
Es ist ja wohl ziemlich kompliziert geworden, Lehrer zu sein.
DER KUNDIGE:
Ja, ein herrlicher Beruf. Menschenbildner, so abwechslungsreich ist kaum eine Tätigkeit!
DER INTERESSIERTE:
Na toll! Die meisten Schüler wollen doch gar nichts lernen, die wollen sich höchstens amüsieren!
DER KUNDIGE:
Auf den ersten Blick mag das so wirken. Aber hinter der Fassade winkt anderes.
DER INTERESSIERTE:
Gut, bei Einzelnen ist vielleicht der Ehrgeiz verschüttet – aber Jugendliche als Gruppe, das ist doch einfach eine wilde Horde!
DER KUNDIGE:
Sagen wir: eine Herde, die einen Hirten sucht …
DER INTERESSIERTE:
Hm. Aber anstrengend ist das doch schon!
DER KUNDIGE:
Anstrengend ist vor allem, wenn man zu schnell gut sein will. Tatsächlich sollte man sich dafür zehn Jahre nehmen. Sonst verausgabt man sich unnötig – und macht seine Arbeit dann nicht mehr gerne.
DER INTERESSIERTE:
Was, so lange?
DER KUNDIGE:
Außerdem ist es anstrengend, wenn man meint, alles anders machen zu müssen als die Älteren. Tatsächlich muss man Schule gar nicht neu denken. Sondern richtiger. Also [8]bisherige Fehler möglichst weglassen. Dazu das Wesentliche etwas besser machen. Und vielleicht auch Neues einfügen.
DER INTERESSIERTE:
Das hört sich so an, als sei gar nicht jede Innovation weiterführend?
DER KUNDIGE:
Im Elfenbeinturm wird so manches gedacht, Weise können auch Torheiten ausbrüten. Aber die jungen Leute wollen dasselbe wie eh und je: das Gefühl haben, dass sie vorankommen. Dass ihr Tun einen Sinn hat. Und dass man sie als Personen wichtig findet. Jeden Einzelnen. Klar spielt auch KI eine Rolle. Aber das ist nicht die Hauptsache.
DER INTERESSIERTE:
Da bin ich jetzt echt gespannt …
[9]Präambel: Ein Grundgesetz für Lehrkräfte?
Landesgesetze, Richtlinien, Verordnungen, Erlasse – Tonnen von Papier und Paragraphen lasten auf unserem Schulwesen. Zudem ist alles ständig im Fluss: gestern diese Reform, heute jene Innovation – und morgen wird mancher Hype von vorgestern wieder verworfen. Vorangestellt sei dieser Schrift deshalb, was ich – nach Jahrzehnten des Unterrichtens und der Bildungspublizistik – als wesentliche Leitgedanken für selbstbewusste Lehrkräfte ansehe. Selbst wenn von Bayern bis Bremen noch spezielle Vorschriften hinzukommen mögen.
Wie unser Grundgesetz das Zusammenleben der Menschen in Deutschland regelt und sie mittels Grundrechten auch vor staatlicher Willkür schützt, so wäre eine elementare Verfasstheit auch dem Bildungswesen zu wünschen. Pädagogen1 ist einerseits etwas besonders Kostbares anvertraut, unsere Jugend. Andererseits kann ein innerer Kompass entlasten und schützen, in der Arbeit mit lernentwöhnten Kindern (von Garrel), anspruchsfreudigen Eltern sowie im Auf und Ab der Bildungspolitik.
Lehrerinnen und Lehrer sind weder beste Freunde von Kindern noch deren Offiziere. Sie beherrschen vielmehr die Kunst, gleich und ungleich zugleich mit jungen Menschen umzugehen. Sie können sich einerseits in kindliches Denken und Empfinden sensibel einfühlen, andererseits aber auch unerschrocken Orientierung geben und ehrliche Beurteilungen [10]aussprechen. Sie sind freundlich und haben hohe Erwartungen.
Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in einer Art Bermudadreieck: Schüler wollen möglichst wenig Hausaufgaben machen, Eltern wollen für ihr Kind zumindest das Abitur, und das Bildungsministerium will vor einer Wahl dieses und nachher jenes. Lehrkräfte sollten deshalb innerlich unabhängige und kritische Personen sein. Denn sie müssen den Lernweg finden, den sie für ihre jeweilige Lerngruppe und ihre speziellen Schüler verantworten können.
Schulpädagogisch verantwortbares Handeln erfordert eine besondere Expertise, beim Unterrichten wie beim Beurteilen. So kann man Gymnasiallehrer oder Berufsschullehrer nicht schadlos in die Grundschule versetzen und glauben, das gehe schon gut. Wir konsultieren auch nicht den HNO-Arzt, wenn das Knie schmerzt – aus gutem Grund. Auch Seiteneinsteiger schneiden in fachlicher Hinsicht nicht schlechter ab als traditionell ausgebildete Lehramtsanwärter, zudem zeigen sie mehr Stressresistenz.
Was sich banal anhört, ist es keineswegs. Vielerorts galt lange Zeit die Parole, es gebe eine alleinseligmachende Lehr-Lern-Methode, etwa das selbstorganisierte, eigenverantwortliche [11]Lernen von Schülern. Die Forschung hat diese Ansicht widerlegt, namhafte Experten haben dies auch eingestanden – aber dies ist noch nicht in jedem Lehrerzimmer, bei jeder Lehrkraft angekommen. Tatsächlich führen viele Wege nach Rom – und andere eben ins Abseits. Und nicht jede Methode passt zu jedem Thema, jedem Schüler und jeder Lehrkraft. Entscheidend darf nicht sein, ob Methoden wohlklingende Namen tragen oder von Schulinspektoren gern gesehen werden. Sondern ob die tatsächlichen Lernprozesse der Schüler nachhaltig, ob sie tiefenwirksam sind.
Neuerdings wird ja pädagogisches Tun vielfach vermessen – und Evaluation liefert gewiss interessante Daten. Aber Kennwerte erfassen im Schulischen bei Weitem nicht alles. Unterricht ist ganz wesentlich Beziehungssache, ein emotional grundierter Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden. Er funktioniert anders als die Abläufe in einer Brotbackstraße, lässt sich höchstens ansatzweise in der Sprache der Ökonomie beschreiben, wird durch Begriffe wie Output oder Income im Grunde nicht erfasst. Deshalb läuft es auf Augenwischerei hinaus, ist letztlich politische Rhetorik, wenn ein Ministerium verkündet, man wolle in den nächsten zehn Jahren die Zahl der Schulabbrecher halbieren oder die Quote an Schülern, die die Optimalstandards erreichen, um 30 % steigern.
Allenthalben hört man, die Schule müsse völlig umgekrempelt werden – für das 21. Jahrhundert mit seiner Unsicherheit und Komplexität brauche es ganz neue Kompetenzen. Bildung [12]könne deshalb nicht länger Wissenserwerb sein, vielmehr gehörten Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken und Kommunikation auf die Agenda. Aber waren das nicht immer schon grundlegende Fähigkeiten? Nur lassen sie sich nicht im Trockendock erwerben. Dazu braucht es fachliches Lernen, an Themen, die noch nicht einmal unmittelbar nützlich sein müssen, sondern den Horizont weiten, und in Formen, die die Persönlichkeit stärken.
Zukunftsphrasen haben Hochkonjunktur. Aber auch im Zeitalter der Digitalisierung bleiben die Tugenden und Haltungen relevant, die man unter anderem beim Lösen von Matheaufgaben oder dem Studium literarischer Klassiker erlernen kann: Genauigkeit, Plausibilität, Beharrlichkeit, Frustrationstoleranz, Sorgfalt, Disziplin, Konzentrationsfähigkeit, Neugierde und Offenheit. Wenn wir wollen, dass junge Menschen wirklich kritisch, wirklich kreativ werden, brauchen sie mehr als wirtschaftlich verwertbare ›Kompetenzen‹.
Auch für frühere Generationen war Zukunft vor allem eines: ungewiss. Ernsthafte und anspruchsvolle Bildung in einer historisch reflektierten Gegenwart, das ist einfach das Beste, was eine Gesellschaft ihrer Jugend mitgeben kann. Deshalb wird in diesem Buch weder von Schulen der Zukunft geträumt, noch werden die Schattenseiten der heutigen Schule zelebriert. Vielmehr wird gezeigt, wie man gerne und gut in den Jetzt-Schulen unterrichten kann.
[13]Teil I
Stoff bewältigen, Stunden gestalten
Manchen ist die Frage lästig, aber sie steht im Raum: Was ist eigentlich Bildung? Eine Kurzformel könnte lauten: Wenn Menschen im Gewusel des Lebens nicht nur dahinvegetieren, sondern sich Durchblick verschaffen. Damit dies möglichst jedem möglichst früh offensteht, hat sich eine kostbare Institution herausgebildet – die öffentliche, allgemeinbildende Schule.
Dass dort nicht am Leben an sich, sondern nach Fächern geordnet geforscht und gelernt wird, hat einen guten Grund: Die uns umgebende Wirklichkeit ist einfach derart komplex, dass man sie bei organisiertem, also nicht zufälligem Lernen am besten unter verschiedenen Blickwinkeln betrachtet – sprachlich, naturwissenschaftlich, ästhetisch. Zudem macht es – nicht nur aus finanziellen Erwägungen – Sinn, das einzelne Kind mit solch lernender Auseinandersetzung nicht alleine zu lassen, sondern es in Gruppen zu unterrichten, also in Klassen oder Kursen. Nicht zuletzt lieben gerade junge Menschen die Abwechslung – das fachliche Lernen und Lehren ist deshalb getaktet, hier ein Häppchen Deutsch, dort eine Portion Mathematik.
Die Kernfragen rund um Stoff und Stunde sind stets dieselben: Welchen Teil aus dem Spektrum eines Faches sieht der Bildungsplan für die jeweilige Altersstufe vor? Wie kann man diesen Aspekt für die jeweilige Klasse verstehbar, mit Sinn behaftet, interessant machen? Welche Unterrichtsformen sind dabei prinzipiell lernwirksam – und welche eignen sich im konkreten Fall besonders? Welches Klima, welche Atmosphäre hilft beim Lernen am besten? Schließlich: Wie kann man 30 unterschiedlichste, womöglich pubertierende Kinder eine Stunde, vielleicht sogar 90 Minuten lang bei der Stange, also motiviert halten?
[14]a) Bildungsinhalte – die Auswahl macht’s!
»Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann ’ne Gedichtanalyse schreiben. In 4 Sprachen.« (Schülerin Naina)
Unterrichtsplanung ist letztlich die Klärung der Frage mit den 9 W’s: Wer soll was von wem wann mit wem wo, wie, womit und wozu lernen? Wobei man denken könnte, das »Was?« sei in der Praxis schon weitestgehend beantwortet. Denn der Unterrichtsstoff ist ja bereits nach Fächern aufgeteilt, und diese Fachinhalte sind schon in den jeweiligen Richtlinien niedergeschrieben und als solche festgelegt, sowohl nach Reihenfolge als auch Altersgemäßheit; zudem gibt es schulinterne curriculare Vorgaben, die zu beachten sind. Tatsächlich richten sich viele Lehrkräfte letztlich primär danach, wie das eingeführte Lehrbuch den Stoff gliedert und anbietet – schließlich hat dieses ja behördliche Weihen erhalten.
Etwas weniger schlicht wäre nicht schlecht. Alleine schon deshalb, weil die Lernergebnisse darunter leiden, wenn man den »Stoff« nur oberflächlich verstanden sortiert und ihn mehr oder weniger gedankenlos abarbeiten lässt. Denn Schüler setzen sich ja mit Binomischen Formeln lieber und tiefer auseinander, wenn das Thema für sie irgendeine Sinnhaftigkeit besitzt – es also nicht einfach darum geht, Seite 85–89 des Lehrbuchs hinter sich zu bringen. Und auch in der Logik der Bildungsidee steht ein solches Thema nicht als Selbstzweck, aus reiner Nützlichkeit oder nur wegen innerfachlicher Zusammenhänge auf dem Plan. Sondern vor allem, weil die Lehrkraft auch mit lästigsten Termumformungen einer hochbedeutsamen Metaaufgabe nachgeht: die Schüler die Welt verstehen zu lehren (Gruschka 22019).
Das setzt natürlich voraus, dass ich als Lehrkraft selbst [15]verstanden habe, wie die Dinge zu verstehen sind. Es reicht nicht, den unterrichtlichen Gegenstand einfach aus dem Lehrbuch oder dem KI-generierten Stundenentwurf abzulesen – ich sollte seine Sachlichkeit selbst so durchdringen, dass ich verstehe, wie man ihn verstehbar machen kann. Nur so lässt sich ja begründen, warum es nicht genügt, dass eine KI die Stunde plant. Denn dann wäre ich allenfalls »Lernbegleiter«, der hier ein bisschen ermuntert, da ein wenig kontrolliert. Aber ich würde nicht unterrichten, also den zu vermittelnden Sachzusammenhang in personaler Beziehung nahebringen.
Auch die Frage, warum Schüler sich mit diesem oder jenem Thema beschäftigen sollen, ist nicht trivial, sollte aber nie ungeklärt bleiben. Womit müssten sich junge Menschen denn auseinandersetzen, damit sich ihr Horizont weiten kann und sie mündig werden? Was Wolfgang Klafki »didaktische Analyse« nannte, sind eigentlich Teilfragen an den erwogenen Stoff: Welche Sachstruktur hat er, welche grundsätzliche, gegenwärtige, zukünftige, exemplarische Bedeutung hat er für die Schüler, wie steht es um seine Zugänglichkeit für die Lernenden? Es geht also darum, die Unterrichtsgegenstände, durch die und an denen Lernprozesse angeregt werden sollen, so auszuwählen und anzuordnen, dass sie sinnhaft werden: im existenziellen Sinne, also in ihrer Bedeutsamkeit für den Lernenden und die Gesellschaft; und auch im fachlichen Zusammenhang: Was verstehen und können wir damit in fachlicher Hinsicht besser? Woran knüpft es an, was zieht es nach sich?
Unterricht planen heißt also, ein vielgestaltiges Kategorienfeld vorab gedanklich zu durchstreifen. Nicht mit dem Ziel einer bombastischen Abhandlung (wie im Referendariat), sondern als mentale Gewohnheit, die in didaktische Bewusstheit mündet – und in eine kleine (vielleicht nur innere) Stichwortliste. Der Unterrichtsgegenstand soll
[16]exemplarisch sein (Welches grammatikalische, mathematische, politische etc. Schlüsselproblem stellt sich hier? Welche typischen Vertreter – z. B. einer literarischen Gattung oder einer Quellengattung – gibt es?)
Gegenwartsbezug haben (nicht primär orientiert an jugendlichen Lebenswelten, sondern der gesamtkulturellen Entwicklung)
Orientierung bieten (in der Zeit, im Raum etc.)
Zukunftsbezug besitzen (persönliche Relevanz für Schulabschlüsse, Berufsleben, Freizeit; Relevanz für gesellschaftliche Entwicklung)
zugänglich und altersgemäß sein.
Früher oder später wird einem indes klar, dass Schulbücher wie Lehrpläne einfach zu viel Stoff enthalten. Und damit steht eine wichtige Entscheidung an: Will ich durch alle Themen oberflächlich hindurchhetzen oder lasse ich einzelne mit Bedacht aus – und wenn Wegfall: ganze Bereiche oder nur vertiefende Aspekte? Auf diese Frage gibt es keine generell gültige Antwort – nur als oberste Maßgabe: Die Schüler sollen möglichst nachhaltig lernen.
In Mathe habe ich z. B. das Kapitel Bruchterme im Jahrgang 8 einfach gestrichen – weil es in diesem Alter ein sehr unanschauliches Thema ist (die Schüler also einiges an Zeit gekostet und viele enorm entmutigt hätte) und in der Oberstufe – dank Spiralprinzip – beinahe spielend nachgeholt und eingebaut werden kann. Anderes Beispiel Geschichte: Da fällt – zumindest im G8-Zug – vielfach das Thema »Weimarer Republik« in Klasse 8 unter den Tisch, was sich aber durchaus verschmerzen lässt; denn eigentlich sind erst Oberstufenschüler in der Lage, die komplexe Gemengelage der Novemberrevolution sowie die Vielfalt der politischen Akteure mit ihren Interessen zu überblicken.
[17]Also: Curriculare und fachwissenschaftliche Vorgaben mögen existieren, aber Unterrichten gelingt lockerer und ist wirksamer, wenn ich diese verstehend durchdrungen habe – und auch geprüft. Denn es ist keineswegs ausgeschlossen, dass sich offizielle Vorgaben bei solchem Check als überholt, unsinnig oder problematisch erweisen. Nach solcher Klärung kann ich souveräner eine Unterrichtsreihe planen, also eine sinnvolle Folge von Erarbeitungsschritten. Und nähere mich damit der Frage, wie ich methodisch vorgehen möchte oder sollte. Denn ich habe es ja sowohl mit einer Gruppe zu tun als auch mit Individuen, die in puncto Entwicklungsstand und Vorwissen höchst unterschiedlich sind. Es gilt also, mögliche Zugangsvarianten und passende Sozialformen zu bedenken.
b) Welche Unterrichtsformen sind lernwirksam?
»Im Mittelpunkt steht ein Lehrer, für den zugleich seine Schüler im Zentrum stehen.« (Ewald Terhart)
Eigentlich ist es recht übersichtlich, wie Lernen funktioniert: Man begegnet Neuem oder erfährt Unbekanntes. Einfachere Dinge merkt man sich spontan, mit komplexeren muss man sich auseinandersetzen, muss ihren Ablauf oder Zusammenhang verstehen. Und wenn das frisch Erworbene nicht gleich wieder vergessen werden soll, muss man es einüben, am besten in wechselnden Kontexten. Ob das Lernen nachhaltig war, erweist sich allerdings erst mit Abstand – bei einem Test oder späteren Anwendungen.
Ein erster 5-Punkte-Plan fürs Unterrichten könnte also so aussehen:
[18]Anknüpfen: Sorge dafür, dass das nötige Vorwissen der Schüler hinreichend aktiviert wird.
Erkunden: Wähle interessante und herausfordernde Problemaufgaben zur Erschließung des neuen Lernthemas aus. Manchmal macht es Sinn, dass sich Schüler zunächst individuell probierend an das Problem herantasten; oft ist es aber auch effektiv, dass Lehrer einen Sachverhalt direkt im Plenum vorstellen und erklären.
Erarbeiten: Biete Aufgaben mit steigendem Schwierigkeitsgrad an (bspw. »Blütenaufgaben«). Halte für Lernschwächere von Anfang an zusätzliche Hilfen bereit (z. B. Musterlösungen, Formulierungshilfen oder Stichwortlisten), für Schnellere ergänzende Herausforderungen (z. B. Transferaufgaben).
Vernetzen: Gib den Schülern Gelegenheit, sich über ihre Erfahrungen auszutauschen – um Irrtümer aufzuklären und das Verständnis jedes Einzelnen zu verbreitern.
Festigen: Verschaffe jedem die Gelegenheit zu genügend Übung – das nötige Ausmaß wird bei jedem unterschiedlich, die Erledigung will bei jedem kontrolliert sein. In Trainingsphasen können sich Lernstarke vielfältig als Lernhelfer profilieren.
Schulisches Lernen stellt zudem einen besonderen Anspruch: Die Lehrkraft hat es nicht nur mit einzelnen Lernern zu tun, sondern mit einer Gruppe unterschiedlichster Einzelwesen. Und es gilt – da nicht alle Schüler etwa an Mathe spontan interessiert sind – dafür zu sorgen, dass diese sich überhaupt auf den Lernstoff und die damit verbundenen Mühen einlassen (Motivation).
Die Befunde der XXL-Metastudie Visible learning von Unterrichtsforscher John Hattie2 haben nun gezeigt: Lehrkräfte, [19]die stark lenkend, als Regisseur, als Kapitänin, als activator auftreten, wirken ungleich lernwirksamer als solche, die sich nur begleitend, moderierend, als facilitator einbringen. Das bedeutet – im Gegensatz zu bisherigen Auffassungen vom Lehrer light – eine ziemliche Neuakzentuierung des Lehrerbildes: »Durch dieses aktive, herausfordernde Lehrerbild rehabilitiert Hattie den dominanten, redenden Lehrer – der aber ebenso auch genau weiß, wann er zurücktreten und schweigen muss. Die Perspektive auf den Unterricht ist: lehrerzentriert. Im Zentrum steht ein Lehrer, für den allerdings seine Schüler im Zentrum stehen. Er muss ihr Lernen sehen können, um sein Lehren daran orientieren zu können.«3