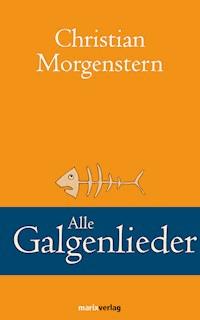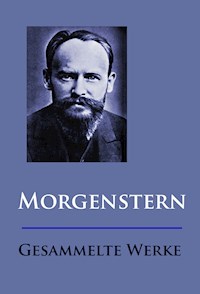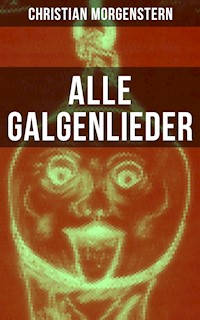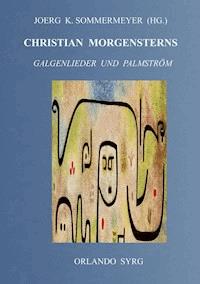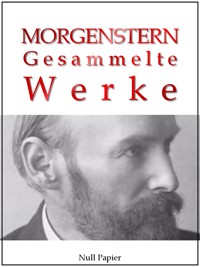1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Christian Morgensterns "Gesammelte Gedichte" versammelt ein beeindruckendes Spektrum von 851 lyrischen Arbeiten, die die Vielfalt und Tiefe seiner poetischen Welt erlebbar machen. Der literarische Stil Morgensterns zeichnet sich durch einen spielerischen Umgang mit Sprache aus, der oft groteske, humorvolle und philosophische Elemente miteinander verwebt. In seinen Gedichten spiegelt sich der Einfluss des Symbolismus und des Expressionismus wider, wobei er durch einen innovativen Einsatz von Sprachbildern und Klangspielen die Leser in eine Welt zwischen Traum und Realität entführt. Themen wie das Menschsein, die Natur und das Verhältnis zwischen diesen Aspekten werden auf eine Weise behandelt, die sowohl zeitlos als auch universell nachvollziehbar ist. Christian Morgenstern (1871–1914) war ein deutscher Dichter und Schriftsteller, dessen Werk stark von seinem Interesse an Philosophie und Religion geprägt ist. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Lyrik des frühen 20. Jahrhunderts und suchte stets nach der Verbindung von Ernst und Humor. Neben seiner Dichtkunst war Morgenstern auch Übersetzer und eine Schlüsselfigur in der literarischen Bewegung, die sich gegen den Naturalismus wandte und den Spielraum der Fantasie betonte. Die "Gesammelten Gedichte" sind nicht nur eine wertvolle Sammlung seiner besten Werke, sondern auch eine Einladung, das Spiel mit Worten zu genießen und den eigenen Denkprozess anzuregen. Leser, die sich für die Feinheiten der Sprache und die Ausdruckskraft der Lyrik interessieren, werden in dieser Sammlung sowohl Freude als auch tiefere Einsichten finden. Ein Muss für alle Liebhaber der deutschen Literatur und der Poesie. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine umfassende Einführung skizziert die verbindenden Merkmale, Themen oder stilistischen Entwicklungen dieser ausgewählten Werke. - Ein Abschnitt zum historischen Kontext verortet die Werke in ihrer Epoche – soziale Strömungen, kulturelle Trends und Schlüsselerlebnisse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen. - Eine knappe Synopsis (Auswahl) gibt einen zugänglichen Überblick über die enthaltenen Texte und hilft dabei, Handlungsverläufe und Hauptideen zu erfassen, ohne wichtige Wendepunkte zu verraten. - Eine vereinheitlichende Analyse untersucht wiederkehrende Motive und charakteristische Stilmittel in der Sammlung, verbindet die Erzählungen miteinander und beleuchtet zugleich die individuellen Stärken der einzelnen Werke. - Reflexionsfragen regen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der übergreifenden Botschaft des Autors an und laden dazu ein, Bezüge zwischen den verschiedenen Texten herzustellen sowie sie in einen modernen Kontext zu setzen. - Abschließend fassen unsere handverlesenen unvergesslichen Zitate zentrale Aussagen und Wendepunkte zusammen und verdeutlichen so die Kernthemen der gesamten Sammlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gesammelte Gedichte (851 Titel in einem Buch)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Diese Ausgabe mit dem Titel Gesammelte Gedichte (851 Titel in einem Buch) vereint in großer Breite die lyrische Produktion Christian Morgensterns und macht sie in einer einzigen, lesefreundlichen Zusammenstellung zugänglich. Ziel ist es, die Spannweite seines dichterischen Sprechens sichtbar zu machen – von spielerischer Nonsenskunst bis zu stiller Einkehr – und zugleich die innere Kontinuität seines Werkes erfahrbar zu halten. Indem kanonische Zyklen neben seltener gelesenen Stücken stehen, entsteht ein Panorama, das die Vielfalt der Stimmen, Töne und Formen bündelt und so einen unmittelbaren Zugang sowohl für Erstlesende als auch für Kenner eröffnet.
Der Band bringt die bekannten Zyklen der komischen und grotesken Lyrik zusammen, darunter Alle Galgenlieder, Galgenlieder, Palmström, Palma Kunkel und Der Gingganz, und stellt ihnen kontemplative Sammlungen wie Einkehr, Auf vielen Wegen, Melancholie, Ein Sommer und Ich und die Welt zur Seite. Ergänzt wird dieses Spektrum durch thematische und jahreszeitliche Stücke (Osterbuch, Zeitgedichte) sowie durch Titel, die auf spielerische Verfremdung und Traditionserkundung verweisen (In Phanta’s Schloß, Horatius Travestitus). Die Auswahl ist so konzipiert, dass sie das vielgestaltige poetische Feld Morgensterns in seiner ganzen Beweglichkeit und seinem Reichtum erlebbar macht.
Die Sammlung verfolgt die Aufgabe, Morgenstern nicht auf einen Ton festzulegen, sondern die eigentümliche Verbindung von Ernst und Heiterkeit herauszustellen, die sein Werk als Ganzes trägt. Sie versteht sich als konzentrierte Einladung zum Wieder- und Neulesen: einerseits als verlässliche Referenz der lyrischen Hauptstücke, andererseits als Fundus von Rand- und Übergangsformen, die sein poetisches Labor sichtbar machen. Dabei bleibt die Ausgabe ihrem Fokus treu: Sie versammelt Gedichte und eng benachbarte Ausdrucksweisen, ohne den Anspruch eines vollständigen Gesamtwerks zu erheben – und ermöglicht dennoch, Entwicklungen und Querverbindungen innerhalb dieser poetischen Welt nachzuzeichnen.
Im Zentrum stehen Gedichte: kurze, pointierte Stücke, längere Balladen, Lieder, Sonettisches und freie Formen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Nonsens- und Sprachspiellyrik der Galgenlieder und ihrer Folgebände, in denen Klang, Rhythmus und logische Verrenkungen zu poetischen Ereignissen werden. Daneben treten Natur- und Stimmungslyrik, meditative Miniaturen und gelegentliche Gelegenheitsdichtungen. Der Band würdigt damit sowohl die spielerische als auch die ernste lyrische Praxis Morgensterns und bewahrt die charakteristische Mischung aus Witz, Beobachtungslust und formaler Disziplin, die seine Poesie unverwechselbar macht.
Über die Lyrik hinaus öffnet die Sammlung den Blick auf angrenzende Textsorten, wo sie Morgensterns poetische Arbeit unmittelbar berühren. Stufen – Eine Entwickelung in Aphorismen und Tagebuch-Notizen dokumentiert die verdichtete Reflexion und die knappe Formulierungskraft, die auch seine Gedichte prägt. Titel wie Horatius Travestitus führen parodistische und travestierende Impulse vor Augen, während In Phanta’s Schloß und Zeitgedichte den Spielraum zwischen Fantastik und Gegenwart deuten. Diese Vielfalt zeigt, wie Morgenstern Formen mischt, um Sprache zu erproben und poetische Möglichkeiten auszuloten, ohne den lyrischen Kern aus dem Blick zu verlieren.
Was diese Werke verbindet, ist eine seltene Allianz aus Sprachfreude, Genauigkeit und gedanklicher Beweglichkeit. Morgenstern inszeniert Logik und Unlogik, tastet das Verhältnis von Zeichen und Sinn ab und führt lesend in eine Schule des Hörens: Klangfarben, Binnenreime, Taktwechsel und überraschende Neologismen wirken als Bedeutungsträger. Zugleich durchzieht eine leise, oft heitere Melancholie seine Texte, die das Komische nicht gegen das Ernste ausspielt, sondern damit verschränkt. Die Sammlung macht diese Spannungen und Übergänge erfahrbar und zeigt, wie konsequent das Spielerische bei Morgenstern Erkenntnisform sein kann.
Als Gesamtheit bleibt diese Dichtung bedeutsam, weil sie die Möglichkeiten der deutschen Sprache mit seltener Freiheit und formaler Strenge zugleich erkundet. Sie bietet ein Modell poetischer Präzision, das sich nicht auf Weltanschauung festlegt, sondern Denken in Bewegung hält. Die Galgenlieder erweitern den Horizont komischer Lyrik; die kontemplativen Bände vertiefen die innere Resonanz der Worte; die aphoristischen Notate schärfen den Blick für Maß und Maßlosigkeit des Ausdrucks. In der Zusammenschau lässt sich ablesen, wie Morgenstern Spiel, Erkenntnis und Musik der Sprache zu einem nachhaltigen, lebendigen Werk fügt.
Historischer Kontext
Christian Morgenstern (1871–1914) wuchs im Wilhelminischen Kaiserreich auf, geprägt von Reichsgründung (1871), rasanter Industrialisierung und städtischer Verdichtung. Geboren am 6. Mai 1871 in München als Sohn des Malers Carl Ernst Morgenstern, bewegte er sich früh in den Kunstmilieus Münchens und später Berlins. Um 1900 prägten Naturalismus, Symbolismus und Jugendstil die deutschsprachige Literatur; Zeitschriften wie PAN (ab 1895) und Die Insel (ab 1899) formten den Geschmack. Zwischen Fortschrittsoptimismus und fin-de-siècle-Melancholie entstanden Gedichtformen, die zwischen Spiel und Ernst oszillieren. Diese Kulturatmosphäre bildet den Resonanzraum für sein Gesamtœuvre, das Sprachwitz, Metaphysik und Gesellschaftssatire miteinander verschränkt.
In den späten 1890er und frühen 1900er Jahren etablierte sich eine neue Medienlandschaft aus Satirepresse, Kleinbühnen und literarischen Salons. Das Münchner Wochenblatt Simplicissimus (gegründet 1896 von Albert Langen) und Berliner Kabaretts wie Überbrettl (1901, Ernst von Wolzogen) oder Schall und Rauch (ab 1901, Max Reinhardt) machten pointierte Literatur performativ erfahrbar. Gedichte kursierten als Rezitationsnummern, Parodien und Chansons; sie wurden vor Publikum ebenso erprobt wie im Buchhandel. Morgensterns poetische Verfahren – Reimexperimente, paradoxes Denken, ostentative Sachlichkeit – reagieren auf diese Bühne der Moderne, in der Lachen, Nachdenken und Formbewusstsein eng zusammenspielen und Gattungsgrenzen ständig überschritten werden.
Das Kaiserreich war zugleich ein Zeitalter der Bürokratisierung, des naturwissenschaftlichen Prestiges und der Moralgesetzgebung. Debatten um Darwinismus und Monismus (Ernst Haeckel, 1834–1919; Deutscher Monistenbund, 1906 in Jena gegründet) trafen auf kirchliche und bürgerliche Gegenkräfte. Die sogenannte Lex Heinze (1900) markierte kulturpolitische Einschränkungen, die Satire und Kunst provozierten. Vor diesem Hintergrund gewinnt Morgensterns Sprachskepsis Profil: die spielerische Demontage amtlicher Redeweisen, die Verfremdung von Naturkunde und Logik, das Nachzeichnen scheinbar „objektiver“ Argumente bis zum absurden Kipppunkt. Seine Gedichte sind Produkte eines Disputs zwischen rationaler Moderne und metaphysischer Suche, der um 1900 viele Intellektuelle in Deutschland und Österreich prägte.
Biographisch wirkte eine chronische Lungenkrankheit als Triebkraft für Ortewechsel, Einkehrmotive und eine Poetik des Leichten. Die europaweite Sanatoriumskultur der Zeit – klimatische Kurorte, Diät- und Atemschulen – bildete einen realen Hintergrund für die Arbeit an Zyklen, Miniaturen und Aphorismen. Aufenthalte in Gebirgs- und Kurorten sowie Reisen strukturierten sein Schreiben; das Bedürfnis nach karger Form und klarer Linie korrespondiert mit eingeschränkter körperlicher Belastbarkeit. Christian Morgenstern starb am 31. März 1914 in Meran (Südtirol, damals Österreich-Ungarn), einem traditionsreichen Luftkurort. Die dortige Atmosphäre des Übergangs – zwischen Heilversprechen und Endlichkeit – spiegelt sich in Tonlagen seines Spätwerks.
Parallel zur naturwissenschaftlichen Moderne gewann um 1900 die Spiritualität neuer Typen an Einfluss: Lebensreform, Theosophie und ab 1913 Anthroposophie. Rudolf Steiner leitete ab 1902 in Berlin die deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft und trennte sich 1913 institutionell, um die Anthroposophie zu formen. Morgenstern nahm ab 1909 an Steiners Vorträgen in Berlin teil; seine 1910 geschlossene Ehe mit Margareta Gosebruch von Liechtenstern stärkte diese Orientierung. Für sein Gesamtwerk ist dieser Kontext bedeutsam: Ironie und Übermut stehen neben Ernstfällen der Selbsterziehung und meditativer Übung; poetische Logik wird zur Schule der Wahrnehmung, die jenseits bloßer Rationalität nach Sinnhorizonten sucht.
Auch die Vermittlungswege seiner Gedichte sind Teil des historischen Kontextes. Berliner Verleger wie Bruno Cassirer (Verlag seit 1898) sowie Münchner Häuser um Albert Langen (ab 1893) verbanden Buchkunst, Grafik und avancierte Typographie. Theaterreformen von Otto Brahm (Freie Bühne, ab 1889) bis Max Reinhardt (Deutsches Theater, ab 1905) etablierten Sprechkunst und literarische Szenen, in denen lakonische Kürze und Pointenwirkung zählten. Diese Infrastruktur begünstigte Zyklen, die zwischen Lesebuch, Bühnenvortrag und Zeitungsabdruck wechselten. Die gleichzeitige Präsenz in Presse, Kapitelbuch und Rezitationssaal erklärt, warum formale Prägnanz, Variation und Wiedererkennbarkeit für seine poetischen Verfahren so zentral werden konnten.
Im europäischen Modernismus positionieren sich seine Texte als freundliche Störung: Sie antizipieren die Sprachzerlegungen der Avantgarden, ohne deren Hermetik zu teilen. Als Berlin mit Der Sturm (ab 1910, Herwarth Walden) zum Knoten für Expressionismus wurde und in Zürich 1916 das Cabaret Voltaire den Dadaismus ausrief (Hugo Ball, Emmy Hennings), fanden spielerische Logikbrüche, Nonsens und Parodie erhöhte Aufmerksamkeit. Autoren wie Kurt Tucholsky (1890–1935) und Joachim Ringelnatz (1883–1934) zählten zu späteren Lesern, die in der Verbindung von Humor und Präzision ein Muster sahen. So wirken seine Verfahren weit über die Entstehungszeit hinaus in Satire, Kinder- und Lautpoesie nach.
Nach 1914 sorgte Margareta Morgenstern als Nachlassverwalterin für Editionen, die verstreute Zyklen, Aphorismen und Gelegenheitsstücke zusammenführten; in den 1910er und 1920er Jahren erschienen erweiterte Ausgaben bei renommierten Häusern der Moderne (u. a. Bruno Cassirer, Berlin, und Kurt Wolff, Leipzig). Im Milieu der Weimarer Republik gelangten seine Gedichte in Lesebücher, Schullesungen und Rundfunkformate (Funkstunde Berlin sendete ab 1923), was ihre Doppelgestalt aus Ernst und Spiel kanonisierte. Dieser rezeptionsgeschichtliche Rahmen – editorische Konsolidierung, pädagogische Verbreitung, mediale Streuung – macht verständlich, warum das Gesamtwerk heute als vielfältiger Kommentar zur deutschsprachigen Kultur zwischen 1890 und 1914 gelesen werden kann.
Synopsis (Auswahl)
In Phanta’s Schloß
Verspielte, phantastische Gedichte, die Traumlogik und Märchenmotive mit Sprachwitz verbinden und das Imaginäre als Schutz- und Experimentierraum erkunden.
Auf vielen Wegen
Weit gespanntes Lyrikbuch, das über unterschiedliche Formen und Tonlagen von Natur und Liebe bis zu Ironie und Weltsinn streift; ein Gang durch Morgensterns thematische Vielfalt.
Horatius Travestitus
Parodistische Nachdichtung klassischer Horaz-Oden, die gelehrte Pose, Schuldrill und Zeitgeschmack mit burlesker Aktualisierung und Metrikspiel verspottet.
Ich und die Welt
Kurzgedichte und Betrachtungen über das Verhältnis von Subjekt und Außenwelt, zwischen stiller Heiterkeit, Skepsis und metaphysischem Staunen.
Ein Sommer
Ein jahreszeitlicher Gedichtzyklus, der Licht, Wärme und Landschaft als Bilder von Fülle und Vergängnis verdichtet.
Und aber ründet sich ein Kranz
Gelegenheits- und Widmungsgedichte, die Motive der Sammlung, Freundschaft und Liebe zu einem kreisenden Motivkranz schließen.
Galgenlieder-Zyklus (Galgenlieder, Palmström, Palma Kunkel, Der Gingganz; gesammelt auch als Alle Galgenlieder)
Nonsens- und Logik-Parodien mit Figuren wie Palmström und Korf, in denen Sprachspiele, absurde Folgerungen und leichtfüßige Reime bürgerliche Vernunft, Bürokratie und Gewohnheit hinterfragen.
Zeitgedichte
Gedichte zur Gegenwart seiner Epoche, in denen moralischer Ernst, Satire und lakonische Beobachtung zusammentreffen.
Melancholie
Leise, dunkel getönte Lyrik über Abschied, Nacht und Endlichkeit, die die Ironie zurücknimmt und kontemplative Tiefe sucht.
Osterbuch
Religiös-symbolische und jahreszeitliche Dichtung um Ostern, Auferstehung und Erneuerung, oft im Spiegel des Frühlings.
Einkehr
Meditative Gedichte der inneren Sammlung und geistigen Suche; schlichte Formen tragen existenzielle Fragen.
Ich und Du
Dialogische Liebes- und Beziehungslyrik über Nähe und Distanz, die das Zwischenmenschliche mit philosophischer Leichtigkeit beleuchtet.
Wir fanden einen Pfad
Ein Zyklus über gemeinsame Wege und gelebte Verbundenheit, in dem Naturbilder eine Metapher für Partnerschaft und Sinnsuche werden.
Stufen - Eine Entwickelung in Aphorismen und Tagebuch-Notizen
Aphorismen und Aufzeichnungen, die Morgensterns innere Entwicklung nachzeichnen—ästhetische, ethische und religiöse Einsichten in gedrängter Form.
Gesammelte Gedichte (851 Titel in einem Buch)
In Phanta’s Schloß
Inhaltsverzeichnis
DEM GEISTE FRIEDRICH NIETZSCHES
Sei's gegeben, wie's mich packte, mocht es oft auch in vertrackte Bildungen zusammenschiessen! Kritisiert es streng und scharf, – doch wenn ich Euch raten darf: Habt auch Unschuld zum Geniessen!
PROLOG
Längst Gesagtes wieder sagen, hab ich endlich gründlich satt. Neue Sterne! Neues Wagen! Fahre wohl, du alte Stadt, drin mit dürren Binsendächern alte Traumbaracken stehn, draus kokett mit schwarzen Fächern meine Wunden Abschied wehn. Kirchturm mit dem Tränenzwiebel, als vielsagendem Symbol, Holperpflaster, Dämmergiebel, Wehmutskneipen, fahret wohl!
Hoch in einsam-heitren Stillen gründ ich mir ein eignes Heim, ganz nach eignem Witz und Willen, ohne Balken, Brett und Leim. Rings um Sonnenstrahlgerüste wallend Nebeltuch gespannt, auf die All-gewölbten Brüste kühner Gipfel hingebannt. Schlafgemach –: mit Sterngoldscheibchen der Tapete Blau besprengt, und darin als Leuchterweibchen Frau Selene aufgehängt.
Längst Gesagtes wieder sagen, Ach! ich hab es gründlich satt.Phanta's Rosse vor den Wagen! Fackeln in die alte Stadt! Wie die Häuser lichterlohen, wie es kracht und raucht und stürzt! Auf, mein Herz! Empor zum frohen Aether, tänzergleich geschürzt! Schönheit-Sonnensegen, Freiheit- Odem, goldfruchtschwere Kraft, ist die heilige Kräftedreiheit, die aus Nichts das Ewige schafft.
AUFFAHRT
Blutroter Dampf .. Rossegestampf .. »Keine Scenen gemacht! Es harren und scharren die Rosse der Nacht.«
Ein lautloser Schatte, über Wiese und Matte empor durch den Tann, das Geistergespann .. Auf hartem Granit der fliegende Huf .. Fallender Wasser anhebender Ruf .. Kältendes Hauchen .. Wir tauchen in neblige Dämpfe .. Donnernde Kämpfe stürzender Wogen um uns.
Da hinauf der Hufe Horn! In die stäubende Schwemme, hoch über den Zorn sich sträubender Kämme empor, empor!
Aus klaffenden Wunden speit der Berg sein Blut gegen euch. Mit Wellenhunden fällt euch an der Hass der Höhe wider das Tal. Aber ihr fliegt, blutbespritzt, unbesiegt, empor, empor. Vor euch noch Farben verzuckenden Lebens, auf grünlichem Grau verrötender Schaum; hinter euch Schwarz und Silber, die Farben des Todes. Ein Schleier, an eure Mähnen geknüpft, schleppt geisterhaft nach. Wie ein Busentuch zieht ihr hinauf ihn über des Bergs zerrissene Brust.
Müde sprang sich der Sturzbach. Nur mit den Lippen wehrt er sich noch. Und bald wird er zum Kind und hängt sich selber spielend an eure Schweife.
Weiter! weiter!
Da! Winkende Gipfel im Sicheldämmer! Langsamer traben die Rosse der Nacht. Heilige Sterne grüssen mich traut. Ewige Weiten atmen mich an. Langsamer traben die Rosse der Nacht, gehen, zögern, stehen still.
Alles liegt nun florumwoben.Schlaf umschmiegt nun Unten, Oben. Nur die fernen Fälle toben. Leise Geisterhände tragen mich vom Wagen in des Schlummers Traumgelände.
Aller Notdurft, alles Kummers ganz befreit, fühle ich ein höhres Sein mich durchweben. Wird die tiefe Einsamkeit mir auf alles Antwort geben?
IM TRAUM
Wer möcht am trägen Stoffe kleben, dem Fittich ward zu Weltenflug! Ich lobe mir den süssen Trug, das heitre Spiel mit Welt und Leben. In tausend Buntgewande steck ich, was geistig, leiblich mich umschwebt; in jedem Ding mich selbst entdeck ich: nur der lebt Sich, der also lebt.
Mir ist, ich sei emporgestürmt über stürzende Wasserfälle. Mir engt's die Brust, um mich getürmt ahn ich schützende Nebelwälle. Aus dumpfen Regionen, aus Welten von Zwergen, trieb's mich fort, ob auf ragenden Bergen ein besserer Ort dem Freien, zu wohnen.
Es weht mir um die Stirne ein Hauch wie von Frauengewand .. Folgte zum steilen Firne mir wer aus dem Unterland? Es beugt sich zu mir nieder ein liebes, schönes Gesicht .. Glaubst Du, ich kenne Dich nicht, Sängerin meiner Lieder?Du bist ja, wo ich bin, mein bester Kamerade! Bei Dir trifft mich kein Schade, meine Herzenskönigin!
»Du flohest aus Finsternissen, mühsamen Mutes, ich weiss es. Du hast zerrissen Dein Herz, Dein heisses, und bei dem Leuchten Deines Blutes bist Du den dunklen Pfad weiter getreten, bis Du mich fandest und mit tiefen Gebeten mich an Dich bandest, dass ich Dich liebgewann, dem ringenden Mann ein treuer Kamerad.
Du brachst uralte Ketten und kamst heute Nacht in mein Reich. Ich will Dich betten an meiner Brust warm und weich, in Träumepracht deine Seele verzücken:der ganzen Welt Aussen und Innen sei Deinem Sinnen preisgestellt. Magst sie schmücken mit lachender Lust, magst sie tausendfach deuten und taufen, mit Berg und Wald, mit Wiese und Bach, mit Wolken und Winden, mit Sternenhaufen Dein Spiel treiben, Deinen Spass finden; brauchst nicht zu bleiben an einem Ort; magst die Welt bis zu Ende laufen; denn Hier oder Dort, wo Du auch seist, wo sich das Himmelszelt über die Erde spannt: das sei Deinem Geist Phanta's Schloss genannt.«
Schneller strömt des Blutes Fluss, Wonne mich durchschauert, auf meinen Lippen dauert sekundenlang Dein süsser Kuss.Nun nimm mich ganz, und trage mein Fragen mit Geduld! Für alles, was ich nun sage, trägst Du fortan die Schuld.
PHANTA'S SCHLOSS
Die Augenlider schlag ich auf. Ich hab so gross und schön geträumt, dass noch mein Blick in seinem Lauf als wie ein müder Wandrer säumt. Schon werden fern im gelben Ost die Sonnenrosse aufgezäumt. Von ihren Mähnen fliessen Feuer, und Feuer stiebt von ihrem Huf. Hinab zur Ebne kriecht der Frost. Und von der Berge Hochgemäuer ertönt der Aare Morgenruf.
Nun wach ich ganz. Vor meiner Schau erwölbt azurn sich ein Palast. Es bleicht der Felsenfliesen Grau und lädt den Purpur sich zu Gast. Des Quellgeäders dumpfes Blau verblitzt in heitren Silberglast. Und langsam taucht aus fahler Nacht der Ebnen bunte Teppichpracht.
All dies mein Lehn aus Phanta's Hand! Ein König ich ob Meer und Land, ob Wolkenraum, ob Firmament! Ein Gott, des Reich nicht Grenze kennt. Dies alles mein! Wohin ich schreite, begrüsst mich dienend die Natur: ein Nymphenheer gebiert die Flur aus ihrem Schoss mir zum Geleite;und Götter steigen aus der Weite des Alls herab auf meine Spur.
Das mächtigste, das feinste Klingen entlauscht dem Erdenrund mein Ohr. Es hört die Meere donnernd springen den felsgekränzten Strand empor, es hört der Menschenstimmen Chor und hört der Vögel helles Singen, der Quellen schüchternen Tenor, der Wälder Bass, der Glocken Schwingen.
Das ist das grosse Tafellied in Phanta's Schloss, die Mittagsweise. Vom Fugenwerk der Sphären-Kreise zwar freilich nur ein kleinstes Glied. Erst wenn mit breiten Nebelstreifen des Abends Hand die Welt verhängt und meiner Sinne masslos Schweifen in engere Bezirke zwängt – wenn sich die Dämmerungen schürzen zum wallenden Gewand der Nacht und aus der Himmel Kraterschacht Legionen Strahlenströme stürzen – wenn die Gefilde heilig stumm, und alles Sein ein tiefer Friede – dann erst erbebt vom Weltenliede, vom Sphärenklang mein Heiligtum.Auf Silberwellen kommt gegangen unsagbar süsse Harmonie, in eine Weise eingefangen, unendlichfache Melodie. Dem scheidet irdisches Verlangen, der solcher Schönheit bog das Knie. Ein Tänzer, wiegt sich, ohne Bangen, sein Geist in seliger Eurythmie.
Oh seltsam Schloss! bald kuppelprächtig gewölbt aus klarem Aetherblau; bald ein aus Quadern, nebelnächtig, um Bergeshaupt getürmter Bau; bald ein von Silberampeldämmer des Monds durchwobnes Schlafgemach; und bald ein Dom, von dessen Dach durch bleiche Weihrauch-Wolkenlämmer Sternmuster funkeln, tausendfach!
Das stille Haupt in Phanta's Schosse, er wart ich träumend Mitternacht: – da hat der Sturm mit rauhem Stosse die Kuppelfenster zugekracht. Kristallner Hagel glitzert nieder, die Wolken falten sich zum Zelt. Und Geisterhand entrückt mich wieder hinüber in des Schlummers Welt.
SONNENAUFGANG
Wer dich einmal sah vom Söller des Hochgebirgs, am Saum der Lande emporsteigen, aus schwarzem Waldschooss emporgeboren, oder purpurnen Meeren dich leicht entwiegend – wer dich einmal sah die bräutliche Erde aufküssen aus Morgenträumen, bis sie, von deiner Schwüre Flammenodem heiss errötend, dir entgegenblühte, in der zitternden Scham, in dem ahnenden Jubel jungfräulicher Liebe – der breitet die Arme nach dir aus, dem lösest die Seele du in Seufzer tiefer Ergriffenheit, oh, der betet dich an, wenn beten heisst: zu deiner lebenschaffenden Glutenliebe ein Ja und Amen jauchzen – wenn beten heisst:in den Aetherwellen des Alls bewusst mitschwingen, eins mit der Ewigkeit, leibvergessen, zeitlos, in sich der Ewigkeit flutende Akkorde – wenn beten heisst: stumm werden in Dankesarmut, wortlos sich segnen lassen, nur Empfangender, nur Geliebter ... Wer dich einmal sah vom Söller des Hochgebirgs!
WOLKENSPIELE
I
Eine grosse schwarze Katze schleicht über den Himmel. Zuweilen krümmt sie sich zornig auf. Dann wieder streckt sie sich lang, lauernd, sprungharrend. Ob ihr die Sonne wohl, die fern im West langsam sich fortstiehlt, ein bunter Vogel dünkt? Ein purpurner Kolibri, oder gar ein schimmernder Papagei? Lüstern dehnt sie sich lang und länger, und Phosphorgeleucht zuckt breit über das dunkle Fell der gierzitternden Katze.
II
Es ist, als hätte die Köchin des grossen Pan – und warum sollte der grosse Pan keine Köchin haben? Eine Leibnymphe, die ihm in Kratern und Gletschertöpfen köstliche Bissen brät und ihm des Winters Geysir-Pünsche sorglich kredenzt? – Als hätte diese Köchin eine Schüssel mit Rotkohl an die Messingwand des Abendhimmels geschleudert. Vielleicht im Zorn, weil ihn der grosse Pan nicht essen wollte ...
III
Wäsche ist heute wohl, grosse Wäsche, droben im Himmelreich. Denn seht nur, seht! wie viele Hemdlein, Höslein, Röcklein, und zierliche Strümpflein die gute Schaffnerin über die blaue Himmelswiese zum Trocknen breitet. Die kleinen Nixen, Gnomen, Eiben, Engelchen, Teufelchen, oder wie sie ihr Vater nennt, liegen wohl alle nun in ihren Bettchen, bis ans Kinn die Decken gezogen, und sehnlich lugend, ob denn die Alte ihren einzigen Staat, ihre weissen Kleidchen, nicht bald ihnen wiederbringe. Die aber legt ernst und bedächtig ein Stück nach dem andern noch auf den Rasen.
IV
Wie sie Ballet tanzen, die losen Panstöchter! Sie machen Phoebus den Abschied schwer, dass er den Trab seiner Hengste zum Schritt verzögert. Schmiegsam, wiegsam werfen und wiegen die rosigen Schleier sie zierlich sich zu, schürzen sie hoch empor, neigen sie tief hinab, drehn sich die wehende Seide ums Haupt.
Und Phoebus Apollo! Bezaubert vergisst er des heiligen Amts, springt vom Gefährt und treibt das Gespann, den Rest der Reise allein zu vollenden. Er selber, gehüllt in den grauen Mantel der Dämmrung, eilt voll Sehnsucht zurück zu den lieblichen, lockenden Tänzerinnen.
Zügellos rasen die Rosse von dannen. Der Gott erschrickt: Dort entschwindet sein Wagen, und hier – haben die schelmischen Töchter des Pan sich in waschende Mägde verwandelt. Durch riesige Tröge ziehen sie weisse, dampfende Linnen und hängen sie rings auf Felsen und Bäumen zum Trockenen auf und legen sie weit gleich einem Schutzwall auf Wiesen und Felder.
Ratlos steht der gefoppte Gott. Und leise kichern die Blätter im Winde.
V
Düstere Wolke, die du, ein Riesenfalter, um der abendrotglühenden Berge starrende Tannen wie um die Staubfäden blutiger Lilien schwebst: Dein Dunkel redet vom Leid der Welt.
Welchen Tales Tränen hast du gesogen? Wie viel angstvoller Seufzer heissen Hauch trankst du in dich? Düstere Wolke, wohin schüttest die Zähren du wieder aus? Schütte sie doch hinaus in die Ewigkeit! Denn wenn sie wieder zur Erde fallen, zeugen sie neue aus ihrem Samen. Nie dann bleiben der Sterblichen Augen trocken.
Ach! da wirfst du sie schon in den Abgrund ... Arme Erde, immer wieder aufs Neue getauft in den eigenen Tränen!
VI
Oh, oh! Zürnender Gott, schlage doch nicht Deine himmlische Harfe ganz in Stücke! Dumpfe Donnerakkorde reisst herrisch Dein Plektron. Zick, zack schnellen die springenden Saiten mit singendem Sausen silbergrell über die Himmel hin.
Holst Du auch manche der Flüchtlinge wieder zurück, viele fallen doch gleissend zur Erde nieder, ragenden Riesen des Tanns um den stöhnenden Leib sich wirbelnd, oder in zischender Flut sich für ewig ein Grab erkiesend.
Zürnender Gott! Wie lange: Da hast Du Dein Saitenspiel kläglich zerbrochen, und kein Sterblicher denkt mehr Deiner, des grollenden Rhapsoden Zeus-Odhin-Jehovah.
SONNENUNTERGANG
Am Untersaum des Wolkenvorhangs hängt der Sonne purpurne Kugel. Langsam zieht ihn die goldene Last zur Erde nieder, bis die bunten Falten das rotaufzuckende Grau des Meeres berühren.
Ausgerollt ist der gewaltige Vorhang. Der tiefblaue Grund, unten mit leuchtenden Farben breit gedeckt, bricht darüber in mächtiger Fläche hervor, karg mit verrötenden Wolkenguirlanden durchrankt und mit silbernen Sternchen glitzernd durchsät. Aus schimmernden Punkten schau ich das Bild einer ruhenden Sphinx kunstvoll gestickt.
Eine Ankerkugel, liegt die Sonne im Meer. Das eintauchende Tuch, schwer von der Nässe, dehnt sich hinein in die Flut. Die Farben blassen, mählig verwaschen. Und bald strahlt vom Himmel zur Erde nur noch der tiefe, satte Ton blauschwarzer Seide.
HOMO IMPERATOR
Gewandert bin ich auf andere Gipfel, deren Riesenfüsse, das Meer, wie ein Hund, demütig leckt; an deren Knöcheln es wohl auch manchmal bellend hinaufspringt, den brauenden Nebeln nach, als seien diese warme Dämpfe aus leckeren Schüsseln.
War ich der Mond, der Hunden verhasste, ich hülfe herauf dir auf den Berg. Doch Ich bin der Mensch, lasse dich lächelnd unten kläffen und übe an dir Meinen göttlichen Spott. Denn sieh, du armes, krauses Meer! was bist du denn ohne Mich? Ich gebe dir Namen und Rang und Bedeutung,wandle dich tausendfalt nach Meinem Gelüst. Meine Schönheit, Meinen Witz hauch Ich als Seele dir ein, werf Ich dir um als Kleid: und also geschmückt wogst du und wiegst du dich vor deinem König, ein trefflicher Tänzer, brausköpfiger Vasall! In Meine hohle Hand zwing Ich hinein dich und schütte dich aus, einem Kometen, der grade vorbeischiesst aufs eilige Haupt. Wie einen Becher fass Ich dein Becken und bringe dich als Morgentrunk Meinem Liebchen Phanta.
In dein graues Megärenhaar greift Mein lachender Uebermut und hält es gegen die Sonne: Da wird es eitel Goldhaar und Seide. Und nun wieder nenn Ich dich Jungfrau und Nymphe und Göttin,und deiner dämonischen Leidenschaft sing Ich ein Seemanns-Klagelied. Oder Ich deute den donnernden Prall dir aus als stöhnende Sehnsucht um Himmelsglück, als wühlenden Groll, als heulenden Hass: So redet Schwermut, flugohnmächtig, wenn sie der Krampf der Verzweiflung zu jagenden Fieberschauern schüttelt.
Aber du drohst: »Eitler Prahler, breite die Arme nur aus, und komm an mein nasses Herz! Dann wirst du künden, wer grösser und mächtiger, du oder ich!«
Drohe mir immer, doch wisse: Die Stunde, da du Mich sinnlosen Zornes verschlingst, tötet auch dich. Ein kaltes, totes Nichts, wertlos, namenlos, magst du dann in die Ewigkeit starren, entseelt, entgöttert.
Denn Ich, der Mensch, bin deine Seele, bin dein Herr und Gott, wie Ich des ganzen Alls Seele und Gottheit bin. Mit Mir vergehen Namen und Werte. Leer steht die Halle der Welt, schied Ich daraus. Gleich unermesslichem Aether füllt Mein Geist den Raum: In Seinen Wellen allein leuchtend, tönend, schwingt der unendliche Stoff.
Eine Harfe bin Ich in tausend Hauchen. Zertrümmere Mich: das Lied ist aus.
KOSMOGONIE
Ewiges Firmament, mit den feurigen Spielen deiner Gestirne, wie bist du entstanden?
Du blauer Sammet! Welch fleissige Göttin hat sich auf dir mit goldnen und silbernen Kreuzstichmustern verewigt?
Wie! oder wären die Sterne Perlen, tagesüber in Wolkenmuscheln gebettet: Aber des Nachts tuen die Schalen sich auf, und aus den schwarzen, angelspottenden Tiefen empor lachen und funkeln die schimmernden Schätze des Meers Unendlichkeit?
Oft auch ist mir, ein mächtig gewölbter kristallener Spiegel sei dieser Himmel, und was wir staunendGestirne nennen, das seien Millionen andächtiger Augen, die strahlend in seinem Dunkel sich spiegeln.
Oder wölbt eines Kerkers bläuliche Finsternis feindlich sich über uns? Von ungezählten Gedankenpfeilen durchbohrt, die von empörter Sehne der suchende Menschengeist rings um sich gestreut: Das Licht der Erkenntnis aber, die Sonne der Freiheit, quillt leuchtend durch die zerschossenen Wände.
Nein, nein! .. Mit spottenden Augen blinzt die Unendlichkeit auf den sterblichen Rätselrater ... Und dennoch rat ich das tiefe Geheimnis! Denn bei Phanta ist nichts unmöglich. – – – – – – – – – – –
In der leeren, dröhnenden Halle des Alls rauschte der Gott der Finsternis mit schwarzen, schleppenden Fittichen grollend dahin. So flügelschlug der düstere Dämon schon seit Aeonen: An seiner Seele frass das Nichts. Umsonst griffen die Pranken seines wühlenden Schaffenswahnsinns hinaus in die unsägliche Leere.
Vom eigenen Leibe musste er nehmen, wollte er schaffen –: das hatte ihn jüngst quälend durchzuckt. Und nun rang und rang er gegen sich selber, der einsame Weltgeist, daß er sich selbst verstümmle. Bis sein Wollen, ein Löwe, in seiner Seele aufstand und ihm die Hand ans Auge zwang, daß sie es ausriss mit rasendem Ruck. Ströme Blutes schossen nach. Der brüllende Gott aber krampfte in sinnloser Qual die Faust um das Auge, dass es zwischen den Fingern perlend herausquoll. Den glänzenden Tropfenregen rissen die fallenden Schleier des Bluts in wirrem Wirbeltanzehinab, hinaus in die eisigen Nächte des unausgründlichen Raums.
Und die perlenbesäten blutigen Schleier kamen in ewigem Kreislauf wieder, schlangen erstickend sich um des flüchtenden Gottes Haupt, zerrten ihn mit sich, warfen ihn aus, ein regelloses, tobendes Chaos. Tiefer noch zürnte der gramvolle Gott. Nicht Schöpfer und Herrscher, Spielball war er geworden, weil er, vom Schmerz bewältigt, den heiligen Lebensstoff, statt ihn zu formen, zerstört.
Aeonen hindurch trug er die Marter der glühenden Schleier, litt er in seiner eigenen Hölle. Dann aber stand zum anderen Male sein Wollen, ein Löwe, in seiner Seele auf. Sieben Kreisläufe des Chaos rang er und rang er noch, und dann gab er den Arm dem Wollen frei. Und er nahm sich auch nochdas andere Auge aus dem unsterblichen Gotteshaupt und warf die blutüberströmte, unversehrte Kugel mitten hinein ins unendliche All.
Da stand sie, glühend, in unermesslicher Purpurründung, und sammelte um sich die tanzenden Blutnebel, dass sie, ein einziger Riesenring von Flammenschleiern, um den gemeinsamen Kern sich wanden und kreisten. Der blinde Gott aber sass und lauschte dem Sausen der Glut.
Aeonen kreiste der Ring: Dann zerriss er. Und um die glasigen Perlen des zerkrampften Auges ballten sich Bälle kochenden Bluts, glühende, leuchtende Blutsonnen, und andere Bälle, die unter roten Dampfhüllen langsam gerannen. Durch die Unendlichkeit schwangen sich zahllose Reigenzahlloser Welten in tönender Ordnung um das geopferte, heile Auge.
Der blinde Gott aber lauschte dem Klang der Sphären, die seinen Preis jauchzten, den Preis des Schaffenden, und flog tastend mit seinen schwarzen, schleppenden Fittichen durch seine Schöpfung, ein Schrecken den Menschlein auf allen Gestirnen, der große Lucifer.
DAS HOHELIED
Singen will ich den Hochgesang, den mit Sterngoldlettern der heilige Geist der Erkenntnis in den schwarzen Riesenschiefer nächtigen Firmaments leuchtend gegraben, den jauchzenden Hochgesang, des Kehrreim von zahllosen Chören von Weltengeschlechtern das All durchtönt: Auf allen Sternen ist Liebe!
Siehe, ich mass auf dem Feuerfittich rascher Kometen die Bahnen der Ewigkeit, durch tausend Planetenreigen flog ich zitternden Geistes, spähte und lauschte hinab auf die kreisenden Bälle mit überirdischen Sehnsuchtsinnen. Und entgegen schwoll mir allewig aus unzählbarer Lebenden Brüsten: Auf allen Sternen ist Liebe!
Sahst du je ein liebendes Paar sich vereinen zu seligem Kuss, sahst du je der Mutterlippe stummes Segengebet des Kindes reinen Scheitel inbrünstig weihen, sahst du je die stille Flammeheiliger Freundschaft im Kusse brennen – oh dann sang auch deine Seele, stammelte schauernd die süsse Gewißheit: Auf allen Sternen ist Liebe!
Trunken bin ich von diesem Liede, das aus der Harfe der Ewigkeit hallt. Oh meine Brüder auf wandelnden Welten, deren Sonnen purpurne Kränze um die Muttersonne des Alls ewigen Rhythmus' Sturmschwung reisst, grüssen lasst euch durch Aeonen! Tausendgestaltiger Sterblicher Hymnen Ein' ich des Menschengeschlechts Dithyrambe. Auf allen Sternen ist Liebe!
Liebe! Liebe! durch die Unendlichkeit ausgegossen, ein Strom erlösenden Lichts, in das Nichts, die Nacht der Herzen deine glühenden Wogen schlagend – hebend aus dem Dumpfen das Heilige – aus dem Chaos rettend und schaffend den Gott – Gottheit auf die Stirn dem Menschen prägend und ins schimmernde Aug ihm Gottheit senkend – Liebe! Liebe! Auf allen Sternen ist Liebe!
Liebe! Liebe! bist du die Mutter auch aller Schmerzen, aller der Lebensqual, wer erträgt um dich nicht alles, stolzen Mutes, ein Held, ein Ringer! Heilig sprechen wir Hass und Leid und Schuld, denn wir lassen von dir nicht, oh Liebe! Träges Verschlummern lockt uns nicht, Leben und Tod soll ewig dauern, denn wir wollen dich ewig, oh Liebe! Auf allen Sternen ist Liebe!
Erden werden zu Eis erstarren und ineinander stürzen, Sonnen die eigene Brut verschlingen, tausend Geschlechter und aber tausend werden in Staub und Asche fallen: aber von Ewigkeit zu Ewigkeit bricht aus unzähliger Lebenden Brüsten dreimal heilig und hehr das hohe Lied, dreimal heilig des Lebens Preisgesang: Auf allen Sternen ist Liebe!
ZWISCHEN WEINEN UND LACHEN
Zwischen Weinen und Lachen schwingt die Schaukel des Lebens. Zwischen Weinen und Lachen fliegt in ihr der Mensch.
Eine Mondgöttin und eine Sonnengöttin stossen im Spiel sie hinüber, herüber. In der Mitte gelagert: Die breite Zone eintöniger Dämmerung.
Hält das Helioskind schelmisch die Schaukel an, übermütige Scherze, weiche Glückseligkeit dem Wiege-Gast ins Herz jubelnd, dann färbt sich rosig, schwingt er zurück, das graue Zwielicht, und jauchzend schwört er dem goldigen Dasein dankbare Treue.
Hat ihn die eisige Hand der Selenetochter berührt,hat ihn ihr starres Aug, Tod und Vergänglichkeit redend, schauerlich angeglast, dann senkt er das Haupt, und der Frost seiner Seele ruft nach erlösenden Tränen. Aschfahl und freudlos nüchtert ihm nun das Dämmer entgegen. Wie dünkt ihm die Welt nun öde und schal.
Aber je höher die eine Göttin die Schaukel zu sich emporzieht – je höher schiesst sie auch drüben empor. Höchstes Lachen und höchstes Weinen, eines Schaukelschwungs Gipfel sind sie.
Wenn die Himmlischen endlich des Spieles müde, dann wiegt sie sich langsam aus. Und zuletzt steht sie still und mit ihr das Herz des, der in ihr sass.
Zwischen Weinen und Lachen schwingt die Schaukel des Lebens. Zwischen Weinen und Lachen fliegt in ihr der Mensch.
IM TANN
Gestern bin ich weit gestiegen, abwärts, aufwärts, kreuz und quer; und am Ende, gliederschwer, blieb im Tannenforst ich liegen. Weil' ich gern in heitrer Buchen sonnengrünem Feierlichte, lieber noch, wo Tann und Fichte kerzenstarr den Himmel suchen.
Aufrecht wird mir selbst die Seele, läuft mein Aug empor den Stamm: Wie ein Kriegsvolk, straff und stramm, stehn sie da, ohn Furcht und Fehle; ernst, in selbstgewollter Busse, nicht zur Rechten nicht zur Linken: wer der Sonne Kuss will trinken, hat im Dämmer keine Musse.
Denksam sass ich. Moose stach ich aus des Waldgrunds braunem Tuch. Und der frische Erdgeruch tat mir wohl, und heiter sprach ich: Wahrlich, ich vergleich euch Riesen unerbittlichen Gedanken, die sich ohne weichlich Wanken Höhenluft der Wahrheit kiesen.
Philosophin Mutter Erde hat euch klar und schlicht gedacht, jeglichem zu Lehr und Acht, wie man teil des Lichtes werde. Stolz aus lauem Dämmer flüchten, Rast und Abweg herb verachten, nur das eine Ziel ertrachten – also muss der Geist sich züchten.
Lang noch an den schlanken Fichten sah ich auf mit ernstem Sinn. Erde! Grosse Meisterin bist du mir im Unterrichten! Besser als Folianten lehren, lehrst mich du, solang mein Leben. Unerschöpflich ist dein Geben, doch noch tiefer mein Verehren.
DER ZERTRÜMMERTE SPIEGEL
Am Himmel steht ein Spiegel, riesengross. Ein Wunderland, im klarsten Sonnenlichte, entwächst berückend dem kristallnen Schoss. Um bunter Tempel marmorne Gedichte ergrünt geheimnisvoller Haine Kranz; der Seen Silber dunkle Kähne spalten, und wallender Gewänder heller Glanz verrät dem Auge wandelnde Gestalten.
Wohl kenn ich dich, du seliges Gefild! .. Doch was in heitrer Ruh erglänzt dort oben, ist mehr als dein getreues Spiegelbild, ist Irdisches zu Göttlichem erhoben. Du zeigst ein friedsam wolkenloses Glück, um das umsonst die Staubgebornen werben ... Und doch! Auch du bist nur ein Schemenstück! Ein Hauch-: Du schläfst im Grund in tausend Scherben.
Ein Hauch! .. Von düstren Wolken löst ein Flug sich von der Felskluft Schautribünenstufen. Um meinen Gipfel streift ihr dumpfer Zug, als hätte sie mein fürchtend Herz gerufen. Hinunter weist beschwörend meine Hand, indes mein Aug nach oben bittet »Bleibe!« – Umsonst! Ein Stoss zermalmt des Spiegels Rand, und donnernd bäumt sich die gewaltige Scheibeund stürzt, von tausend Sprüngen überzackt, mit fürchterlichem Tosen in die Tiefen. Der Abgrund schreit, von wildem Graun gepackt. Blutüberströmt die Wolken talwärts triefen. Fahlgrüner Splitterregen spritzt umher, den Leib der Nacht zerschneidend und zerfleischend. Mordbrüllend wühlt der Sturm im Nebelmeer und heult in jede Höhle, wollustkreischend.
Der Berge Adern schwellen, brechen auf und schäumen graue Fülle ins Geklüfte. Ihr Flutsturz reisst verstreuter Scherben Hauf unhemmbar mit in finstre Waldnachtgrüfte. Es wogt der Forsten nasses Kronenhaar, durchblendet von demantnem Pfeilgewimmel .. Doch um die Höhen wird es langsam klar, durch Tränen lächelt der beraubte Himmel.
Und bald verblitzt der letzten Scherbe Schein, zum Grund gefegt vom Sturm- und Wellentanze. Nur feiner Glasstaub deckt noch Baum und Stein und funkelt tausendfach im Sonnenglanze ... Ich schau, ich sinne, hab der Zeit nicht acht –: Den Tag verscheuchte längst der Schattenriese. Und aus der Tiefe predigen durch die Nacht die Fälle vom versunknen Paradiese.
DAS KREUZ
Die gestürzten Engel schweben um den Berg. Mit weissen, bleiernen Riesenfittichen schleicht ihr Flug aus den Talen, dass er die Höhen der Erde auch todeskältend überfinstere, dass im Schweigen der Nacht endlich das Leben sterbe.
Lebendige Flammen entrief ich dem Fels zum Schutze. In goldenem Zorn leuchtet das Berghaupt. Aber die heisseste Stirn, das glühendste Aug ist nicht lange gefeit, wo solcher Flügel grabkalte Bahrtücher der Vernichtung eisige Schauer ins Haupt schatten.
Und fahles Grauen würgt mir die Kehle und reisst einen Schrei mir aus der Brust und wirft ihn hinaus in die Finsternisse ..Vom grauen Fittichgewölbe fällt er ohnmächtig in mich zurück.
Im Schein der mühsam kämpfenden Lohe trete ich, halb von Sinnen, zum Rande des Abgrunds und breite, wie prüfend, die Arme aus.
Da zucken die Nebelgespenster grausengepackt zusammen. Ihr schnürender Reigen löst sich, zerstreut sich. In wildem Entsetzen rasen heulend die Satane um den Gipfel. Ich aber erkenne auf der zitternden Wand ihrer Flügelflucht ein mächtiges, schwarzes Kreuz.
Meines Körpers kreuzförmiger Schatte quält triumphierend die Engel des Todeshinweg, hinab, zurück in ihr trauriges Reich.
Ich stehe noch lange, die Arme gebreitet, doch nicht mehr in Angst noch als Wehr, nein! jetzt als Gruss und heilige Ehrung den tausend lächelnden Lichtaugen des unsterblichen Alls.
DIE VERSUCHUNG
Der alte, ehrwürdige Herr mit dem grossen Bart war heute bei mir. »Ich habe dich gestern gerettet!« sagte er freundlich. »Den Einfall, die Arme zur Kreuzform zu strecken, hab ich dir gesteckt.« Ich schüttelte dankbar die biedere Rechte. Er aber drohte mir mit dem Finger: »Ein Schelm bleibst du doch! Ich traue dir nicht. Doch höre!« Und er kniff mir den Arm und zeigte mir rings die Lande –: »Dies alles soll dein sein, wenn du hier hinfällst und mich anbetest.« Der Arme, er wusste nicht, dass Erde und Himmel durch Phanta längst mein war. »Nun, willst du nicht?« rief er halb ängstlich halb ärgerlich. Ich aber machte ihm schnell eine kalte Kompresse um die erhitzten Schläfenund führte ihn sorgsam den Berg hinunter. Auf halber Höhe traf ich den großen Pan. Er wollte gerade eine Windhosen-Orgel bauen. Doch ich entriss ihn dem kühnen Projekte und stellte ihm seinen greisen Kollegen vor. »Alte Bekanntschaft!« rief Pan und zog die krumme Nase missmutig noch krümmer. »Vielleicht hilft er dir bei der Windhosen-Orgel!« schlug ich begütigend vor. Das leuchtete ein. Arm in Arm zogen die beiden ab. Ich aber stieg, ein freier, glückseliger Mensch, singend wieder empor auf meine herrlichen, klaren, einsamen Höhen.
DER NACHTWANDLER
Sanfter Mondsegen über den Landen. Schlafstumm Berge, Wälder, Tale. In den Hütten erstorben die Herde; an den Herden eingenickte Grossmütter, zu deren Knieen offne Enkel-Mäulerchen unter verhängten Aeuglein atmen. Auf Daunen und Strohsack schnarchendes Laster, schnarchende Tugend. Wachend allein: Diebe, Dichter, Wächter der Nacht, und auf Gassen, in Gärten und in verschwiegenen Kammern lispelnde Liebe.
Sanfter Mond! du segnest, weil du nichts andres kannst. Aber am Herzen zehren dir Neid und Groll, weil die Menschen dich also missachten, dass sie zu Bett gehn, wenn du kommst. Aergerlich ziehn sie die Vorhänge zu: und du stehst draussen und – segnest milde deine Verächter.
Sanfter Mond! manchmal auch lugen Herrschergelüste gefährlich vor unter deiner Demut. Dann rufst du in verträumte Gehirne:»Auf! auf! Ich bin die Sonne! Kommt: es ist Tag!« Und der blöden Schläfer glaubt es dir mancher und steigt ernsthaft aus seinen Kissen und geht gravitätisch über die Dächer. Scheel sehen die Kater ihn an. Er aber wandelt und klettert, als hätt ihm sein Arzt die Alpen verschrieben.
Wie? Freundchen! Hätt ich dich heut gar ertappt? Mir dünkt, da unten kam solch ein Wandler! Armer Fremdling, – besser: Hemdling –, wer bist du? Welchem Bette entflohst du? Opferlamm mondlicher Lüsternheit, meilenweit musst du gewandert sein!
Redet er nicht im Schlaf? horch!»Wer ich bin? ... Eine lebendige Litfass-Säule Etiquettiert von oben bis unten: – Staatsbürger, Gemeindemitglied, Protestant, Hausbesitzer, Ehemann, Familienvater, Vereinsvorstand, Reserveleutnant, Agrarier, Christlicher Germane, Antisemit, Deutschbündler, Socialmonarchist, Bimetallist, Wagnerianer, Antinaturalist, Spiritist, Kneippianer, Temperenzler –«
»Wie!« ruf ich, »und nie Mensch?«
Aber da reisst der Schläfer die Augen auf,und – »Mensch?« von verzerrten Lippen heulend, stürzt er, fehltretend, die Felswand hinab, von Zacke zu Zacke im Bogen geschleudert.
Ich aber, ich »Mörder«, muss unbändig lachen. Ich kann nicht anders – Gott helfe dem Armen! Amen!
ANDRE ZEITEN, ANDRE DRACHEN
Immer nicht an Mond und Sterne mag ich meine Blicke hängen –: Ach man kann mit Mond und Sternen, Wolken, Felsen, Wäldern, Bächen allzuleichtlich kokettieren, hat man solch ein schelmisch Weibchen stets um sich wie Phanta Sia.
Darum senk ich heut bescheiden meine Augen in die Tiefe. Hier und da ein Hüttenlichtlein; auch ein Feuer, dran sich Hirten nächtliche Kartoffeln braten – wenig sonst im dunklen Grunde. Doch! da drunten seh ich eine goldgeschuppte Schlange kriechen ...
Hocharomatisches Erspähnis! Kommst du wieder, trautes Gestern, da die Drachen mit den Kühen friedlich auf den Almen grasten, wenn sie nicht grad Flammen speien oder Ritter fressen mussten – da der Lindwurm in den Engpass seinen Boa-Hals hinabhing und mit grünem Augenaufschlag Dame, Knapp und Maultier schmauste kommst du wieder, trautes Gestern?Eitle Frage! Dieses Schuppen- Ungetüm da drunten ist ein ganz modernes Fabelwesen, unersättlich zwar, wie jene alten Schlangen, doch auch wieder jenem braven Walfisch ähnlich, der dem Jonas nur auf Tage seinen Bauch zur Herberg anbot.
Feuerwurm, ich grüsse froh dich von den Stufen meines Schlosses! Denn ob mancher dich auch schmähe als den Störer stiller Lande, und die gelben Humpeldrachen, die noch bliesen, noch nicht pfiffen, wiederwünschte, – ich bekenne, dass ich stolz bin, dich zu schauen. Höher schlägt mir oft das Herze, seh ich dich auf schmalen Pfaden deine Wucht in leichter Grazie mit dem Flug der Vögel messen und mit Triumphatorpose hallend durch die Nächte tragen.
Sinnbild bist du mir und Gleichnis Geistessiegs ob StofFesträgheit! Gleichnis bist du neuer Zeit mir, die, jahrtausendalter KräfteErbin, Sammlerin, sie spielend zwingt und formt, beherrscht und leitet!
Andre Zeiten, andre Drachen, andre Drachen, andre Märchen, andre Märchen, andre Mütter, andre Mütter, andre Jugend, andre Jugend, andre Männer –: Stark und stolz, gesund und fröhlich, leichten, kampfgeübten Geistes, Überwinder aller Schwerheit, Sieger, Tänzer, Spötter, Götter!
DIE WEIDE AM BACHE
Weißt du noch, Phanta, wie wir jüngst eine Nyade, eine der tausend Göttinnen der Nacht, bei ihrem Abendwerk belauschten?
Einer Weide half sie, sorglich wie eine Mutter, ins Nachthemd, das sie zuvor aus den Nebel-Linnen des Bachs kunstvoll gefertigt. Ungeschickt streckte der Baum die Arme aus, hineinzukriechen ins Schlafgewand. Da warf es die Nymphe lächelnd ihm über den Kopf, zog es herab, strich es ihm glatt an den Leib, knöpfte an Hals und Händen es ordentlich zu und eilte weiter.
Die Weide aber, in ihrem Nachtkleid, sah ganz stolz empor zu Lima. Und Lima lächelte, und der Bach murmelte, und wir beide, wir fanden wieder einmal die Welt sehr lustig.
ABENDDÄMMERUNG
Eine runzelige Alte, schleicht die Abenddämmerung, gebtickten Ganges durchs Gefild und sammelt und sammelt das letzte Licht in ihre Schürze.
Vom Wiesenrain, von den Hüttendächern, von den Stämmen des Walds, nimmt sie es fort. Und dann humpelt sie mühsam den Berg hinauf und sammelt und sammelt die letzte Sonne in ihre Schürze.
Droben umschlingt ihr mit Halsen und Küssen ihr Töchterchen Nacht den Nacken und greift begierig ins ängstlich verschlossene Schurztuch. Als es sein Händchen wieder herauszieht,ist es schneeweiss, als war es mit Mehl rings überpudert.
Und die Kleine, längst gewitzt, tupft mit dem niedlichen Zeigefinger den ganzen Himmel voll und jauchzt laut auf in kindlicher Freude. Ganz unten aber macht sie einen grossen, runden Tupfen – das ist der Mond. Mütterchen Dämmerung sieht ihr mit mildem Lächeln zu. Und dann geht es langsam zu Bette.
AUGUSTNACHT
Stille, herrliche Sommernacht! Silberfischlein springen lustig in dem himmlischen Meer. Hochauf schnellen die zierlichen Leibchen sich, blitzschnell. wieder verschwindend. Hinter grauen Wolkenklippen gleisst es verdächtig. Da kauert arglistig der Mann im Mond – und fischt. Verstohlene, seidene Angelschnüre wirft er hinab in die arglose Flut. Ach! und nun zappelt auch schon ein armer Weissling am Haken und fliegt im weiten Bogen hinauf zu den grauen, hässlichen Klippen ... mir ist, ich höre ein leises, behäbiges Lachen.
MÄDCHENTRÄNEN
Die schönen, blauen Augen des Himmels hängen voll trüber Nebelschleier, und unter verstohlenen Schluchzern strömen graue Güsse zur Erde nieder. Auf traurigen Häuptern tragen die Bäume das schwere Tränenweh, die Bäche hetzen verstört sich talwärts, mürrisch vermummt sich der Berg in weisser Wolle.
Und das alles? Weil mit allzuglühender Lippe der liebesrasende, ungestüme Sonnengott des Morgenhimmels reine, kühle Mädchenunschuld bestürmt und die tief errötende Geliebte mit allzuversengenden Küssen in ihrer jungfraustillen Seele fassungslos aufgewühlt. Wie ein Krampf packte die Leidenschaft den überwältigten Herzensfrieden ... Und all die verwirrten Gefühle lösten und schütteten sich aus in einem grossen Weinen.
Mählig verebben die Seufzer. Versöhnlicher, weicher wird das Herz. Und schon sehe ich wieder ein halbes Lächeln, ein warmes Winken undämmbar aufdrängender Liebe in den schönen, blauen Augen.
LANDREGEN
Auf der Erde steht eine hohe, gewaltige, tausendsaitige Regenharfe. Und Phanta greift mit beiden Händen hinein und singt dazu –: Monoton, wie ein Indianerweib, immer dasselbe. Die Lider werden mir schwer und schwerer. Nach langem Halbschlaf erwach ich wieder, – reibe verstört mir die trägen Augen –: auf der Erde steht eine hohe, gewaltige, tausendsaitige Regenharfe.
DER BELEIDIGTE PAN
Auf der Höhlung eines erstorbenen Kraters blies heute Pan, wie Schusterjungen auf Schlüsseln pfeifen. Er pfiff »die Welt« aus, dies sonderbare, zweideutige Stück eines Anonymus, das Tag für Tag uns vorgespielt wird und niemals endet. Oh pfeife doch minder, teuerer Waldgott! Halt Einkehr, Pan! Wer hiess Dich denn unter Menschen gehen? ..
MONDAUFGANG
In den Wipfeln des Walds, die starr und schwarz in den fahlen Dämmerhimmel gespenstern, hängt eine grosse, glänzende Seifenblase.
Langsam löst sie sich aus dem Geäst und schwebt hinauf in den Aether.
Unten im Dickicht liegt Pan, im Munde ein langes Schilfrohr, dran noch der Schaum des nahen Teiches verkrustet schillert.
Blasen blies er, der heitere Gott: die meisten aber platzten ihm tückisch. Nur eine hielt sich tapfer und flog hinaus aus den Kronen.
Da treibt sie schimmernd, vom Winde getragen, über die Lande. Immer höher steigt die zerbrechliche Kugel.
Pan aber blickt mit klopfendem Herzen – verhaltenen Atems – ihr nach.
MONDBILDER
I
Der Mond steht da wie ein alter van Dyck: ein rundes, gutmütiges Holländergesicht mit einer mächtigen, mühlsteinartigen, cremefarbenen Halskrause. Ich möcht ihn wohl kaufen, den alten van Dyck! Aber ich fürchte, er ist im Privatbesitz des Herrn Zebaoth. Ich müsste den Ablass wieder in Schwung bringen! Vielleicht liess er ihn dafür mir ab ... Hm. Hm.
II
Eine goldene Sichel in bräunlichen Garben, liegt der Mond im broncenen Gewölk. Mag da weit die Schnitterin sein? Ich meine, die Schwaden bewegen sich – oh, ich errate alles! Ins Aehrenversteck zog wohl ein Gott die emsige Göttermaid, – irgend ein himmlischer Schwerenöter der Liebe, Jupiter-Don Juan oder Wodan-Faust .. In frohem Schreck liess sie die Sichel fallen ... Oh, Ihr königlich freien, heiter geniessenden, seligen Götter!
III
Gross über schweigenden Wäldern und Wassern lastet der Vollmond, eine Aegis, mit düsterem Goldschein alles in reglosen Bann verstrickend. Die Winde halten den Atem. Die Wälder ducken sich scheu in sich selbst hinein. Das Auge des Sees wird stier und glasig –: als ob eine Ahnung die Erde durchfröre, dass dieser Gorgoschild einst ihren Leib zertrümmern werde .. Als ob eines Schreies sie schwanger läge, eines Schreies voll Grausen, Voll Todesentsetzen .. Εσσετι ηµαρ!
IV
Durch Abendwolken fliegt ein Bumerang, ein goldgelbes Bumerang. Und ich denke mir: Heda! Den hat ein Australneger-Engel aus den seligen Jagdgründen dorthin geschleudert – vielleicht aus Versehen!? Der arme Nigger! Am Ende verwehrt ihm ein Cherub, über den himmlischen Zaun zu klettern, damit seine Waffe er wieder hole ... Oh, lieber Cherub, ich bitte für den Nigger! Bedenke: es ist solch ein schönes, wertvolles, goldgelbes Bumerang!
ERSTER SCHNEE
Die in Wolkenkukuksheim zerreissen ihre Manuskripte, und in unzähligen, weissen Schnitzelchen flattert und fliegt es mir um die Schläfen. Die Unzufriednen! Nie noch blieben der Lieder sie froh, die im Lenz ihnen knospeten, nie noch der dithyrambischen Chöre, die durch glühende Julinächte von ihren Munden wie Donner brachen. Immer wieder zerstören gleichmütig sie, was sie gedichtet: und in unzähligen, weissen Stückchen flattert es aus dem grauen Papierkorb, den sie schelmisch zur Erde kehren. Grosse, redliche Geister! Ich, der Erde armer Poet, versteh Euch. Wenn wir uns selbst genügen wollen,ehrlich Schaffende wir, müssen wir unsren Gedanken wieder all die bunten Hüllen ausziehn. Ach! allein in der Maske des Worts wird unser Tiefstes dem Nächsten sichtbar!
Ihr Stolzen verschmäht es, den Wortewerken, die Ihr erschuft, Dauer zu leihen, und ihr könnt es – denn Ihr seid Götter! Keiner von Euch will Trost, will Erlösung, weiss von dem Wahnsinn Glückes und Leides: in Euch selbst seid Ihr Euch ewig genug!
Aber wir Menschen, wir Selig-Unseligen, tief in gemeinsame Lose verstrickten, müssen einander die Herzen erschliessen,müssen einander fragen, belehren, trösten, befreien, stärken, erheitern, und zu all Dem raten und planen, formen und bauen, rastlos, mühvoll, an dem Menschheitstempel »Kultur«.
Ich stehe stumm in den wirbelnden Flocken und denke mit Schwermut meines Stückwerks. Doch streue ich selbst nichts in den lustigen Tanz. Meine Werke, Ihr Götter, stürben wie roter Schnee, wollt ich sie opfern! Ich schrieb mit Herzblut ... Homo sum.
TALFAHRT
Die du im ersten jungfräulichen Schnee dort am fallenden Hang ahnungsvoll schläfst, talbrünstige Lawine! Wach auf! Und trage mich! wildestes Ross, wieder hinab in der Menschen Gefilde! – – – – – – – – – – –
Die zierliche Flocke bewegt sich .. wächst . Und stürmt immer toller von Fels zu Fels ... Ich springe ihr nach und fasse beherzt in ihr weisses, wehendes Mähnenhaar, indessen Phanta den Renner lenkt, wie auf rollender Kugel die Göttin des Glücks, hochaufgerichtet und furchtlos. – – – – – – – – – – –
Wir sind am Ziel. Vom Laufe ruht im Bach des Tals das Rösslein aus. Ich flieg auf weichen Wiesenplan, und lächelnd hilft mir Phanta auf. Und dann – zerbricht sie ihren Stab. – – – – – – – – – – –
EPILOG
Am Schreibtisch finde ich mich wieder, als wie aus krausem Traum erwacht ..: Vor mir ein Buch seltsamer Lieder, und um mich stille Mondesnacht. Ich schaue auf den kleinen Ort, aus dem mein Geist im Zorn geflohn: – Nachtwächter ruft sein Hirtenwort zu greiser Turmuhr biedrem Ton .. Wie knochige Philisterglatzen erglänzt des Pflasters holprig Beet .. Und auf den Giebeln weinen Katzen um ein versagtes tête-a-tête.
Euch also, winklige Gemäuer, durchschnarcht von edlen Atta Trolls, bewarf ich einst mit wildem Feuer aus den Vulkanen meines Grolls! Ich sah in eurer Kleinlichkeit die Welt, die in mir selbst ich trug: es war ein Stück Vergangenheit, das ich in eurem Bild zerschlug. Von oben hab ich lachen lernen auf euer enges Kreuz und Quer! Wer Kurzweil trieb mit Sonn und Sternen, dem seid ihr kein Memento mehr! In tiefentzückten Weihestunden fernab dem Staub der breiten Spur, hab ich mich wieder heimgefunden zum Mutterherzen der Natur!
In ihm ist alles gross und echt, von gut und böse unentweiht: Schönheit ist Kraft ihm, Kraft ihm Recht, sein Pulsschlag ist die Ewigkeit. Wen dieser Mutter Hände leiten vom Heut ins Ewige hinein, der lernt den Schritt des Siegers schreiten, und Mensch sein heisst ihm König sein!
Auf vielen Wegen
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Meinem Freunde Friedrich Kayssler
Wär' der Begriff des Echten verloren,
in Dir wär' er wiedergeboren.
Als Haß mir nach der Wurzel schlug,
warst Du bei mir, das war genug,
hast mir zu Deinem Leben
das meine neu gegeben.
Zehn Jahre zusammen!
Es löst sich der Dunst.
Auf schlagen die Flammen
Unserer Kunst.
Träume
Hirt Ahasver
Ich träumte jüngst, mir träumte, daß ich träumte,
daß ich geträumt, geträumt zu haben hätt',
wie Ahasver mit zweimal sieben Kühen,
den sieben magern und den sieben fetten,
im Mondschein übers Moor gewandert wär',
worüber selbst ein später Weg mich wies.
»Ei guten Abend, Meister Ahasver,« –
begrüßt ich keck ihn, daß ein magres Tier
erschreckt zur Seite setzte, – »Was ist das?
Ihr treibt die vierzehn Kühe durch die Welt?«
Verächtlich schoß des Alten Blick nach mir,
und zornig murmelnd zog er einer fetten
den lauten Stecken übers Hinterteil.
Heidi! wie sich die Rinderbeine regten,
die magern immer flink voran, dahinter
mit schwipp und schwapp der Hängebäuche Trott;
bis Fern' und Dämmrung endlich sie verschlang,
und nur des Hirten wehnder Weißbart noch
ein Weilchen aus den Weiten schimmerte ...
Doch mir verschob sich alles nun. Und weiter
flog hin und her das Webeschiff des Traums.
Die Irrlichter
Ein Irrlicht, schwebt ich heut im Traume
auf einem weiten, düstren Sumpfe,
und um mich der Gespielen Reigen
in wunderlich geschlungnen Kränzen.
Wir sangen traurig-süße Lieder
mit leisen, feinen Geisterstimmen,
viel feiner als die lauten Grillen,
die fern im Korn eintönig sangen.
Wir sangen, wie das harte Schicksal
uns wehre, daß wir Menschen würden:
So oft schon waren wir erschienen,
wo sich zwei Liebende vereinten,
doch immer, ach, war schon ein andres
Irr-Seelchen uns zuvorgekommen,
und seufzend hatten wir von neuem
zurück gemußt zum dunklen Sumpfe.
So sangen wir von unsern Leiden –
als uns mit einem Mal Entsetzen
in wirren Läufen huschen machte.
Ein Mensch entsprang dem nahen Walde
und lief verzweifelten Gebarens
gerade auf uns zu –: Der Boden
schlug schwankend, eine schwere Woge,
dem Armen überm Haupt zusammen.
Verstummt zu zitterndem Geflüster
umschwirrten wir die grause Stelle ...
Bald aber sangen wir von neuem
die alten traurig-süßen Lieder.
Mensch und Möwe
Eine neugierkranke Möwe,
kreiste ich zu Häupten eines
Wesens, das in einen weiten
dunklen Mantel eingewickelt,
von dem Kopfe einer Bune
auf die grüne See hinaussah.
Und ich wußte, daß ich selber
dieses Wesen sei, und war mir
dennoch selbst so problematisch,
wie nur je dem klugen Sinne
einer Möwe solch ein dunkler
Mantelvogel, Mensch geheißen.
Warum blickt dies große, stumme,
rätselhafte Tier so ernsthaft
auf der Wasser Flucht und Rückkehr?
Lauert es geheimer Beute?
Wird es plötzlich aus des Mantels
Schoß verborgne Schwingen strecken,
und mit schwerem Flügelschlag den
Schaum der weißen Kämme streifen?
So und anders fragte rastlos
mein beschränktes Möwenhirn sich,
und in immer frechern Kreisen
stieß ich, kläglich schreiend, oder
ärgerlich und höhnisch lachend,
um mich selber ... Da erhob sich
aus dem Meere eine Woge ...
stieg und stieg ... Und Mensch und Möwe
ward verschlungen und begraben.
Der Schuss
»Nimm die Fahne!« – »gib!« – und weiter –
Leichenhügel – Gräben – Hecken –
Donnern – Brausen – Knattern – Pfeifen –
Stöhnen – Schreien – Wimmern – Schnaufen –
Pulverschleier – Kugelregen –
»vorwärts, Kameraden!« – »hurra!« –
blaue Gruppen – springend – stürzend –
Flüche – Bitten – Seufzer – Pfiffe –
Tiergesichter – Fetzen Fleisches –
Blut in Rinseln – Bächen – Lachen –
wildgewälzte Pferdeleiber –
Sterbende – zerstampft – zerrissen –
Arme – Hände – hemmend – heischend –
fortgestoßen – »vorwärts!« –»hurra!« –
»nieder!« – »Feuer!« – »auf!« – »Attacke!« –
»ah!« – »da!« – »Mar–!« – »ich!« – »hier!« – »die Fahne!« – –
Und ich stürze tot zusammen.
Jäh schreck' ich auf –:
Im Hause fällt ein Schuß.
Der gläserne Sarg
Zwölf stumme Männer trugen mich
in einem Sarge von Kristall
hinunter an des Meeres Strand,
bis an der Brandung Rand hinaus.
So hatte ich's im Testament
bestimmt: Man bette meinen Leib
in einem Sarge von Kristall
und trage ihn der Ebbe nach,
bis sie den tiefsten Stand erreicht.
Der Sonne ungeheurer Gott
stand bis zum Gürtel schon im Meer:
An seinem Glanze tränkte sich
wollüstig noch einmal die Welt.
Ich selber lag in rotem Schein
wie ein Gebilde aus Porphyr.
Da streckte katzengleich die Flut
die erste Welle nach mir aus.
Und ging zurück und schob sich vor
und tastete am Sarg hinauf
und wandte flüsternd sich zur Flucht.
Und kam zurück und griff und stieß
und raunte lauter, warf sich kühn
darüber, einmal, viele mal.
Und blieb, und ihrer Macht gewiß,
umlief frohlockend sie mein Haus
und pochte dran und schäumte auf,
als ihrer Faust es widerstand.
Und hoch und höher wuchs und wuchs
das Wasser um mein gläsern Schloß.
Nun wankte es, als hätt' ein Arm
und noch ein Arm es rauh gepackt,
und scholl in allen Fugen, als
ein Wellenberg auf ihm sich brach
und es wie ein Lawinensturz
umdröhnte und verschüttete.
Und langsam wich der nasse Sand.
Und seitlings neigte sich der Sarg.
Und, unterwühlt und übertobt,
begann er um sich selber sich
schwerfällig in die See zu drehn.
Zu mächtig, daß die Brandung ihn
zum Strand zu schleppen hätt' vermocht,
vergrub er rollend sich und mich
in totenstillen Meeresgrund.
So lag ich denn, wie ich gewollt.
Und dunkle Fische zogen still
zu meinen Häupten hin und her.
Und schwarzer Seetang überschwamm
mein Grab. Und mein Bewußtsein schwand.
Der Stern
Ich träumt einmal, ich läg, ein blasser Knabe,
in einem Kahne schlafend ausgestreckt,
und meiner Lider fein Geweb durchflammte
der hohen Nacht geheimnisvoller Glanz.
Und all mein Innres wurde Licht und Schimmer,
und ein Entzücken, das ich nie gekannt,
durchglühte mich und hob mein ganzes Wesen
in eine höhere Ordnung der Natur.
Ein leises Tönen hielt mich hold umfangen,
als zitterte in jedem Sternenstrahl
der Ton der Heimat, die ihn hergesendet.
Ein Ton vor allen aber traf mein Herz
und ließ die andern mehr und mehr verstummen
und tat sich auseinander wie der Kelch
der Königin der Nacht und offenbarte
auf seinem Grunde mir sein süßes Lied ...
»Wir grüßen dich in deine stillen Nächte,
als deiner Zukunft tröstliche Gewähr,
es schalten ungeheure Willensmächte
in unsrer Tage blindem Ungefähr.
Sie ziehn dich von Gestaltung zu Gestaltung,
heut schleppst du dich noch schweren Schrittes hin,
doch bald begabt dich freiere Entfaltung
mit reicherer Natur und höherm Sinn.
So wandeln wir auf leichten Tänzerfüßen,
die wir dereinst auch dein Geschick geteilt,
und dürfen dich mit einem Liede grüßen,
das dich auf Strahlen unsres Sterns ereilt.
Oh flüchte bald nach unsern Lustgefilden,
und laß der kalten Erde grauen Dunst,
Oh sähst du, zu welch göttlichen Gebilden
uns schuf des Schicksals heiß ersehnte Gunst!
Auf Blumen wandeln wir wie leichte Falter,
aus Früchten saugen wir der Kräfte Saft,
uns ficht kein Elend an, zerbricht kein Alter,
der frühern Leiden lächelt unsre Kraft.
Denn allzu schön, als daß wir uns entzweiten,
erschuf uns das Gestirn, das uns gebar, –
wir können uns nicht Schmerz und Not bereiten,
die Schönheit macht uns aller Feindschaft bar!
Wir lieben uns aus tiefsten Herzensgründen,
wir trinken unsres Anblicks Glück und Huld,
wir wissen nichts wie ihr von fahlen Sünden,
und keinen ängstigt das Gespenst der Schuld.
Oh komm! daß sich die dornenlose Rose
auch deiner Schläfe duftend schmiegen kann!
Die schönste Schwester diene deinem Lose
und schenke dich dem schönsten Mann – oh komm –!«
Da unterbrach ein dumpfer Glockenton
die reinen, feinen Stimmen jener Welt.
Ich richtete mich halb im Bette auf –
und sah viel Sterne durch mein Fenster glühn ...
und sank zurück. Und weiter floß die Nacht.
Der Besuch
Wie doch ein Traum so traurig stimmt,
wenn unser Geist Vergangenheit
und Gegenwart als Eines nimmt!
Ich saß bei dir im Brautgemach
und sprach von deinem Bräutigam,
und wie so alles anders kam ...
Und lachte hell und scherzte laut ...
Doch endlich ward mein Sinn zu schwer –
du warst ja eines andern Braut!
Ein Garten lag vor deinem Haus,
da trug ich meinen Schmerz hinein
und weinte meine Wehmut aus.
Und als ich wiederkam, da schien,
als ahntest du, was mich erregt,
und selber wardst du sanft bewegt.
Dein Mütterlein umfing mich still,