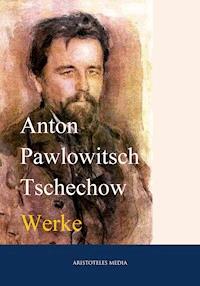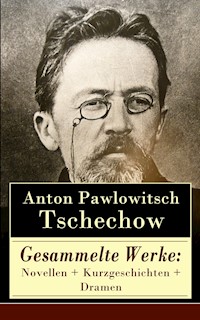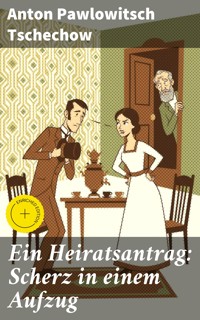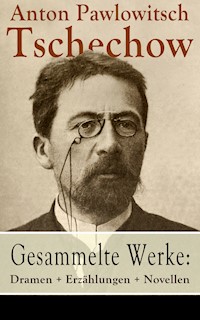1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Anton Pawlowitsch Tschechow, einer der bedeutendsten Vertreter der russischen Literatur, vereint in seinen "Gesammelten Werken: Dramen + Erzählungen + Novellen" eine Meisterschaft des Erzählens und eine tiefgründige gesellschaftliche Analyse. In seinen abwechslungsreichen Geschichten ergründet Tschechow die menschliche Natur und soziale Verhältnisse, oft in einem Stil, der sich durch eine feine Ironie und subtile Komik auszeichnet. Die Texte reflektieren den Übergang der russischen Gesellschaft im späten 19. Jahrhundert und stehen im Kontext des Realismus, gleichzeitig jedoch mit einer Vorahnung der neuen literarischen Strömungen des 20. Jahrhunderts. Die Kunst des Weglassens und die Konzentration auf das Alltägliche zeichnen Tschechows Werke aus, sodass sie sowohl emotional berührend als auch intellektuell herausfordernd sind. Tschechow, geboren 1860 in Sretensk, stellte die Komplexität menschlicher Beziehungen und die Absurditäten des Alltags in den Mittelpunkt seiner Schaffens. Als Arzt und Schriftsteller vereinte er in seinem Leben die Erfahrung medizinischer Einsicht mit einem scharfen Blick für psychologische Feinheiten und soziale Themen. Sein Engagement für die Theaterkunst, insbesondere mit Stücken wie "Die Möwe" und "Onkel Wanja", verdeutlichte seine revolutionäre Sichtweise, die das Drama von Figurenkonflikten und existenziellen Fragen stark beeinflusste. Dieses Buch ist nicht nur eine umfangreiche Sammlung, sondern ein unverzichtbares Werk für alle, die sich für die menschliche Psyche und die Dynamik der Gesellschaft interessieren. Tschechows sensibler und präziser Stil ermöglicht es dem Leser, in verschiedene Lebenswelten einzutauchen, während die zeitlosen Themen der Einsamkeit, Liebe und Verzweiflung ein ergreifendes Leseerlebnis bieten. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine umfassende Einführung skizziert die verbindenden Merkmale, Themen oder stilistischen Entwicklungen dieser ausgewählten Werke. - Die Autorenbiografie hebt persönliche Meilensteine und literarische Einflüsse hervor, die das gesamte Schaffen prägen. - Ein Abschnitt zum historischen Kontext verortet die Werke in ihrer Epoche – soziale Strömungen, kulturelle Trends und Schlüsselerlebnisse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen. - Eine knappe Synopsis (Auswahl) gibt einen zugänglichen Überblick über die enthaltenen Texte und hilft dabei, Handlungsverläufe und Hauptideen zu erfassen, ohne wichtige Wendepunkte zu verraten. - Eine vereinheitlichende Analyse untersucht wiederkehrende Motive und charakteristische Stilmittel in der Sammlung, verbindet die Erzählungen miteinander und beleuchtet zugleich die individuellen Stärken der einzelnen Werke. - Reflexionsfragen regen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der übergreifenden Botschaft des Autors an und laden dazu ein, Bezüge zwischen den verschiedenen Texten herzustellen sowie sie in einen modernen Kontext zu setzen. - Abschließend fassen unsere handverlesenen unvergesslichen Zitate zentrale Aussagen und Wendepunkte zusammen und verdeutlichen so die Kernthemen der gesamten Sammlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gesammelte Werke: Dramen + Erzählungen + Novellen
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Diese Ausgabe mit dem Titel „Gesammelte Werke: Dramen + Erzählungen + Novellen“ versammelt die zentralen Gattungen, in denen Anton Pawlowitsch Tschechow sein Œuvre geprägt hat. Sie führt die wichtigsten Bühnenwerke mit einer repräsentativen Auswahl seiner kürzeren Prosa zusammen und bietet so einen konzentrierten Zugang zu einem Autor, der die moderne Literatur nachhaltig geprägt hat. Ziel der Zusammenstellung ist es, die Spannweite seiner Kunst sichtbar zu machen: vom dicht erzählten Prosastück bis zur vielstimmigen Szene. Die Texte sind so gewählt, dass sie den Charakter seines Schreibens in unterschiedlichen Phasen zeigen, ohne den Anspruch zu erheben, jeden Einzeltext vollständig zu dokumentieren.
Tschechow hat keine Romane verfasst; sein Rang gründet vor allem auf Erzählungen, Novellen und Dramen. Diese Edition spiegelt diese Schwerpunktsetzung: Sie konzentriert sich auf die kürzere Prosa und die Theaterstücke, also auf jene Formen, in denen Tschechow seine ästhetischen Erneuerungen entwickelte. Andere Textsorten, etwa private Briefe oder journalistische Beiträge, bleiben bewusst außerhalb des Umfangs. Dadurch entsteht ein klares Profil: Die Leserinnen und Leser begegnen dem Autor dort, wo er seine Stimme am unverwechselbarsten erhob – in der präzisen Beobachtung der alltäglichen Welt und in Bühnenbildern, die das Unausgesprochene hörbar machen.
Die Novellen und Kurzgeschichten zeigen Tschechow als Meister der Verdichtung. Er beschränkt Handlung und Kommentar auf das Notwendige, setzt auf Andeutung, Zwischentöne und offene Enden. Figuren erscheinen in Momentaufnahmen, soziale Räume in wenigen Zügen, während die erzählerische Perspektive oft diskret bleibt. Das genaue Auge für Details, der rhythmische Einsatz von Szenen und die Ökonomie der Gestaltung formen eine Prosa, die ihren Reiz aus dem Unspektakulären bezieht. So entfaltet sich eine Welt, in der kleine Gesten und beiläufige Worte eine große Resonanz erzeugen, ohne dass sich die Texte auf eindeutige Deutungen festlegen lassen.
Die Dramen dokumentieren eine behutsame Revolution der Bühne. Tschechow setzt nicht auf spektakuläre Wendungen, sondern auf fein abgestufte Stimmungen, Pausen und Ensemble-Spiel. Konflikte verlaufen leise, verlagern sich in Untertöne, in Blicke, in die Temperatur eines Raumes. Die Handlung scheint oft zurückgenommen, doch gerade darin verdichten sich Beziehungen, Erwartungen und Enttäuschungen. Diese Art des Theaters, die das Alltägliche mit hoher Spannung auflädt, hat die moderne Spielweise nachhaltig beeinflusst. Das Ergebnis sind Stücke, die ein gemeinsames Atmen zwischen Text, Publikum und Darstellenden suchen und das Drama als Lebensnähe begreifen.
Was die Prosa und die Bühnenwerke verbindet, sind wiederkehrende Themen: die Reibung zwischen Wunsch und Wirklichkeit, verpasste Gelegenheiten, die Erfahrung von Zeit und Stillstand, das Nebeneinander von Komik und Melancholie. Tschechow beobachtet Arbeit und Muße, Provinz und Stadt, Nähe und Fremdheit, ohne dabei zu richten. In seinen Texten steht das menschliche Maß im Mittelpunkt – nicht das Außerordentliche, sondern die Gewohnheiten und Gewissheiten, die uns tragen oder lähmen. So entsteht ein Werk, das die Tragfähigkeit des Alltäglichen erprobt und darin existenzielle Fragen in eine leise, doch eindringliche Form bringt.
Stilistisch zeichnet Tschechow ein ausgeprägter Sinn für Lakonie, Ironie und rhythmische Komposition aus. Er vermeidet Pathos, verknappt Dialoge, vertraut auf die Wirkung von Pausen und Nebenbemerkungen. Das Ökonomische ist nicht karg, sondern sorgfältig gewichtet: Ein beiläufiger Gegenstand, eine unscheinbare Bewegung, ein kaum merklicher Tonfall können die innere Lage einer Figur präzise beleuchten. In der Prosa wie im Theater ist die Zeit selbst eine Figur – sie rinnt, stockt, weitet sich. Dadurch gewinnen alltägliche Abläufe eine poetische Spannung, die ohne große Effekte auskommt und doch anhaltend wirkt.
Die Figuren entstehen vor allem aus ihrem Verhalten, aus Redeflüssen und Schweigen, aus Stimmungslagen, die nicht erklärt, sondern erfahrbar gemacht werden. Tschechow zeigt Menschen im Übergang: kleinste Verschiebungen in Beziehungen, Gewohnheiten, Lebensentwürfen. Sein Mitgefühl ist unsentimental; die Heiterkeit, die aufblitzt, ist oft von Ernst gebrochen. Dadurch werden Klischees vermieden und Ambivalenzen bewahrt. Leserinnen, Leser und Zuschauer sind eingeladen, die Leerstellen zu füllen, Hypothesen zu bilden, Haltungen zu prüfen. So entsteht eine Ethik des Hinsehens: aufmerksam, geduldig, offen für die Möglichkeit, dass Mehrdeutigkeit der angemessene Ausdruck der Wirklichkeit ist.
Im historischen Kontext des späten 19. Jahrhunderts, geprägt von sozialen Veränderungen und intellektuellen Debatten, findet Tschechows Kunst ihre Form. Sein Beruf als Arzt schärfte den Blick für körperliche und seelische Zustände, für Symptome und Milieus, für Ursachen, die sich nicht immer eindeutig bestimmen lassen. Dieses diagnostische, zugleich beobachtende Verfahren prägt seine Erzählhaltung: nüchtern, aber nicht kalt; analytisch, ohne die Würde der Figuren zu verletzen. Die Texte vermeiden Bewältigungsrezepte und zeigen dennoch ein Vertrauen in Wahrnehmung, Mitgefühl und Sprache als Werkzeuge, das Leben zu verstehen.
Die anhaltende Bedeutung des Werks erklärt sich aus seiner Offenheit. Weil Tschechow selten Lösungen anbietet, bleiben seine Texte Gesprächsanlässe über Generationen hinweg. In der Literaturgeschichte haben seine Erzählverfahren die Kurzgeschichte modernisiert; im Theater beeinflussten seine Stücke Spielweisen, Regie und Dramaturgie weit über ihren Entstehungskontext hinaus. Zugleich sind sie lokal verankert und universell anschlussfähig: Die Situationen sind erkennbar konkret, die Fragen nach Sinn, Verantwortung und Möglichkeit gehören jedoch keiner Epoche allein. So bleibt das Werk lebendig – bis in heutige Lesarten, Inszenierungen und Übersetzungen hinein.
Diese Sammlung ist nicht als enzyklopädische Vollständigkeit angelegt, sondern als konzentrierte Öffnung. Indem sie Prosa und Drama zusammenführt, lässt sie die Gattungen miteinander sprechen: Motive, Tonlagen und Figurenkonstellationen spiegeln sich, widersprechen einander, vertiefen sich. Wer die Erzählungen liest, erkennt dramaturgische Verfahren wieder; wer die Dramen betrachtet, entdeckt prosaistische Feinheiten im Dialog. Der Wechsel zwischen den Formen schärft die Wahrnehmung für Tschechows Kern: die Kunst des Weglassens, die Genauigkeit der Beobachtung und das Vertrauen darauf, dass Sinn sich erst im Lesen und Spielen bildet.
Für die Lektüre empfiehlt sich Aufmerksamkeit für Übergänge: für die Art, wie Szenen beginnen und enden, wie Sätze abbrechen und an anderer Stelle weiterklingen, wie kleine Details Handlung ersetzen. Tschechows Texte belohnen langsames Lesen und wiederholte Begegnungen. Sie laden dazu ein, nicht sofort zu werten, sondern zunächst zu hören, zu sehen, zu spüren. Gerade die Zurückhaltung – das, was ungesagt bleibt – eröffnet einen weiten Resonanzraum. Diese Ausgabe bietet die Gelegenheit, solche Resonanzen quer zu den Gattungen zu verfolgen und die innere Architektur des Werks Schritt für Schritt freizulegen.
„Gesammelte Werke: Dramen + Erzählungen + Novellen“ versteht sich als Einladung, Tschechows literarische Welt in ihrer Breite und Konzentration zugleich zu erkunden. Wer neu einsteigt, findet hier eine prägnante Orientierung; wer zurückkehrt, entdeckt Verbindungen und Nuancen, die im Einzelband leicht übersehen werden. Zwischen Bühne und Prosa entsteht ein Panorama, das nicht durch Größe, sondern durch Genauigkeit imponiert. In dieser Genauigkeit liegt der humane Ton, der Tschechows Schreiben trägt – und der Grund, weshalb seine Texte auch heute noch sprechen, fragen, trösten und widersprechen.
Autorenbiografie
Anton Pawlowitsch Tschechow (1860–1904) gilt als Schlüsselfigur der russischen und europäischen Moderne. Als Prosaschriftsteller und Dramatiker erneuerte er Erzählform und Bühnenkunst, indem er das Ungesagte, die Andeutung und den Alltag in den Mittelpunkt rückte. Seine Novellen und Kurzgeschichten verfeinerten den psychologischen Realismus, seine Dramen etablierten eine subtile, spannungsarme Handlung, die innere Konflikte sichtbar macht. Zwischen Spätrealismus und frühen modernen Strömungen angesiedelt, verbindet sein Werk soziale Beobachtung mit ethischer Zurückhaltung. Tschechow prägte damit die Vorstellung, dass kleine Gesten und beiläufige Details große Wahrheiten tragen können – eine Einsicht, die bis heute Literatur und Theater beeinflusst.
Ausgebildet als Arzt an der Universitätsmedizin in Moskau, verband Tschechow wissenschaftliche Nüchternheit mit künstlerischer Sensibilität. Die Schulung in Diagnostik, Beobachtung und präziser Sprache formte seine Poetik: Symptome statt Deklamation, Verhalten statt Urteil. Literarisch stand er in der Tradition des russischen Realismus, zugleich offen für naturalistische Verfahren und die leise Modernität der 1890er Jahre. Theaterästhetische Entwicklungen seiner Zeit – stärkeres Ensemble-Spiel, szenische Untertöne, Alltagsdialoge – bestätigten seinen Weg. Ohne programmatische Manifeste zu verfassen, orientierte er sich an der strengen Aufmerksamkeit gegenüber Wirklichkeit und Charakter. Diese Verbindung von Empirie und Kunst wurde zum Markenzeichen seiner späteren Novellen, Kurzgeschichten und Dramen.
Seine ersten literarischen Schritte unternahm Tschechow mit kurzen, oft humorvollen Skizzen für Zeitschriften, in denen Pointen und präzise Beobachtung bereits zusammenfanden. Während der Studienjahre schrieb er neben der medizinischen Ausbildung kontinuierlich Prosa, erprobte Tonlagen und lernte, mit minimalen Mitteln Wirkung zu erzielen. Allmählich wurden die Stücke länger und psychologisch nuancierter, wodurch sich ein Publikum jenseits der Unterhaltungspresse erschloss. Die Doppelrolle als praktizierender Arzt und Autor hielt er über Jahre aufrecht, was seine nüchterne, nicht moralisierende Haltung bestärkte. Aus beiläufigen Alltagsmomenten entwickelte er eine Erzählweise, die Spannung aus Verzögerung, Schweigen und atmosphärischer Dichte gewinnt.
In den Novellen und Kurzgeschichten erreichte Tschechow eine neue Ökonomie des Erzählens. Die Handlung verdichtet sich in Gesten, Blicken und kleinen Verschiebungen; offenes Ende und ambivalente Motivierung ersetzen eindeutige Botschaften. Themen wie unerfüllte Wünsche, provinzielles Leben, institutionelle Trägheit und die Verletzlichkeit menschlicher Beziehungen treten ohne didaktische Rahmung hervor. Seine Erzählperspektiven vermeiden Pathos und suchen die genaue, oft ironische Beobachtung. Die Figuren sind weder Helden noch Schurken, sondern Menschen in Grenzlagen der Gewöhnlichkeit. Diese Form radikaler Kürze und Zurückhaltung machte seine Kurzprosa zu einem Modell moderner Erzählliteratur und beeinflusste Generationen von Autorinnen und Autoren weltweit.
Mit den Dramen verlagerte Tschechow seine Kunst auf die Bühne, ohne die leise Psychologie seiner Prosa aufzugeben. Er komponierte Szenen aus beiläufigen Gesprächen, Pausen und Nebentätigkeiten; die entscheidenden Ereignisse ereignen sich oft außerhalb des sichtbaren Geschehens. Die Figuren sprechen aneinander vorbei, während Stimmungen, Jahreszeiten und Geräusche die emotionale Topografie formen. Diese Bauweise stellte herkömmliche Konfliktdramaturgie infrage, wurde zunächst missverstanden und später zum Maßstab eines neuen Theaterrealismus. Ensemblegleichgewicht, subtextreiche Dialoge und die Kunst des Ungesagten prägten nachhaltig das Repertoire. Tschechows Dramen werden bis heute international gespielt und gelten als Prüfstein differenzierten, psychologisch genauen Schauspielens.
Zentral für Tschechows Schreiben ist eine ethische Zurückhaltung, die aus ärztlicher Praxis und realistischer Weltsicht erwächst. Er verzichtet auf programmatische Lösungen und verlagert moralische Fragen in die Leser- oder Zuschauerurteile. Seine Figuren erfahren Begrenzungen durch soziale Routinen, Armut, Bürokratie oder schlichte Müdigkeit; dennoch bleibt Mitgefühl leitend. Die Genauigkeit der Milieubeschreibung dient nicht Anklage, sondern Erkenntnis. Tschechows Prosa und Bühnenkunst zeigen, wie Menschen scheitern, sich arrangieren und Hoffnung in unscheinbaren Momenten finden. Diese Haltung, frei von Polemik und Überhöhung, begründete seinen Ruf als Chronist des Alltäglichen und als Autor, der Ambivalenz ernst nimmt.
In seinen letzten Jahren litt Tschechow an gesundheitlichen Einschränkungen, schrieb jedoch weiter an Prosa und Dramen und festigte sein Ansehen als Erneuerer. 1904 verstarb er, doch sein Werk blieb lebendig: Novellen und Kurzgeschichten sind Standard des modernen Erzählens, seine Dramen prägen Spielpläne weltweit. Übersetzungen, Neuinszenierungen und Adaptionen halten die Relevanz wach, weil seine Kunst die Zwischentöne menschlicher Erfahrung sichtbar macht. Die Wirkung zeigt sich in minimalistischen Erzählformen, psychologischem Ensembletheater und der Wertschätzung für subtiles Schreiben. Tschechow gilt heute als Autor, der mit sparsamen Mitteln nachhaltige Wahrheiten formulierte und damit ästhetische Maßstäbe setzte.
Historischer Kontext
Anton Pawlowitsch Tschechow (1860–1904) schrieb seine Dramen und Erzählungen in den letzten Jahrzehnten des Zarenreichs, einer Phase beschleunigter Umbrüche und anhaltender Autokratie. Die in der Sammlung vereinten Novellen, Kurzgeschichten und Bühnenstücke entstanden überwiegend zwischen den frühen 1880er Jahren und 1904. Sie spiegeln das Fin de Siècle in Russland, in dem Realismus und erste modernistische Verfahren aufeinandertrafen. Provinzstädte, Landgüter und aufstrebende Metropolen bilden die Schauplätze einer Gesellschaft, die zwischen Tradition, Reform und wachsender Unruhe oszilliert. Vor diesem historischen Hintergrund entwickelte Tschechow eine künstlerische Ökonomie, die Alltagsbeobachtung, psychologische Genauigkeit und soziale Topographie miteinander verknüpft.
Der tiefste Einschnitt für das ländliche Russland blieb die Bauernbefreiung von 1861, flankiert von den „großen Reformen“ unter Alexander II., darunter die Einrichtung der Zemstvos (1864) und die Justizreform. Diese Maßnahmen veränderten Eigentums- und Machtverhältnisse, ohne soziale Spannungen zu lösen. Tschechows Prosawelten greifen die neuen lokalen Eliten – Ärzte, Lehrer, Richter – ebenso auf wie die weiterhin prekären Lebenslagen der Landbevölkerung. Das Nebeneinander von neuem Verwaltungshandeln und alten Abhängigkeiten prägte die Erfahrungsräume seiner Figuren. Die Sammlung wird so zum Register einer Gesellschaft, die institutionell modernisiert wurde, deren soziale Mobilität jedoch häufig an ökonomischen Grenzen, Bildungszugang und Standesvorstellungen scheiterte.
Seit den 1870er Jahren beschleunigten Industrie und Eisenbahnbau die Urbanisierung. Fabrikviertel, Bahnhöfe und neue Kommunikationsmittel verbanden Provinz und Zentrum enger, ohne die Kluft im Lebensstandard zu schließen. Diese Verdichtung von Raum und Zeit lässt sich in Tschechows Motiven des Aufbruchs und der Entfremdung erkennen. Die wachsende städtische Mittelschicht, aber auch verarmte Kleinadlige und Beamte, bilden das Publikum und Personal seiner Texte. Reisen – dienstlich, gesundheitlich oder aus Sehnsucht – strukturieren Biografien. Gleichzeitig bleibt die Provinz als mentaler Raum bestehen: Beharrungsvermögen, Leerlauf und Routine kollidieren mit Modernisierungsversprechen, die oft am fehlenden Kapital, an Netzwerken oder an zögerlicher Verwaltungspraxis zerschellen.
Die literarische Öffentlichkeit des späten Zarenreichs wurde von Zeitungen und Zeitschriften getragen. In diesem Markt etablierte sich Tschechow zunächst mit kurzen humoristischen Skizzen unter dem Pseudonym „Antoscha Tschechonte“, publiziert in Blättern wie Oskolki und später in Suworins Nowoje Wremja. Vorzensur und Blattlinie setzten Grenzen, zugleich schärften enge Produktionsrhythmen seine präzise Kürze. Die Kurzform eignete sich, soziale Typen, Milieus und Stimmungen rasch und nuancenreich sichtbar zu machen. Die Sammlung dokumentiert diese Medienökologie: Sie bewahrt Texte, die im seriellen Druck erschienen, sich am Lesegeschmack einer breiten, zunehmend gebildeten städtischen Öffentlichkeit orientierten und dennoch Raum für stilistische Innovation eröffneten.
Als ausgebildeter Arzt (Moskauer Universität, Abschluss 1884) arbeitete Tschechow als Zemstvo-Mediziner und behandelte in armen ländlichen Regionen. Medizinische Praxis und Schriftstellerei standen nicht gegeneinander: Klinischer Blick, diagnostische Vorsicht und Aufmerksamkeit für Symptome prägten seine Erzählweise. Während der Choleraepidemie 1892 engagierte er sich im Moskauer Umland organisatorisch und praktisch. Diese Erfahrungen schärften sein Verständnis für Infrastruktur, Hygiene, Verantwortung und die Grenzen improvisierter Hilfe. In den Texten der Sammlung zeigt sich eine genaue Kenntnis medizinischer Routinen und sozialer Krankheitsverläufe, die ohne didaktischen Gestus Verhältnisse offenlegt: Mangel an Ärzten, unzureichende Finanzierung lokaler Verwaltungen und die Fragilität ländlicher Versorgungssysteme.
Die Hungerkrise von 1891/92, ausgelöst durch Missernten und administrative Fehlsteuerungen, mobilisierte Teile der Intelligenzija. Tschechow beteiligte sich an Hilfsaktionen, sammelte Spenden, unterstützte Schulen und Bibliotheken und engagierte sich in seinem Wohnort Melichowo für den Aufbau sozialer Infrastruktur. Die Krise machte die Verwundbarkeit von Subsistenzökonomien ebenso sichtbar wie die Reichweite zivilgesellschaftlicher Initiativen. In den Prosastücken der Sammlung treten Armut, Zufall und bürokratische Hürden ohne Anklagegestus, aber mit dokumentarischer Genauigkeit hervor. Der historische Kontext erklärt so die wiederkehrenden Motive prekärer Existenz, ungleicher Chancen und der subtilen Gewalt alltäglicher Engpässe in einem formal modern werdenden, sozial gespaltenen Reich.
1890 reiste Tschechow auf eigene Kosten zur Strafkolonie Sachalin, führte dort eine umfangreiche empirische Erhebung durch und publizierte die Ergebnisse zunächst in Fortsetzungen, später als Das Eiland Sachalin. Diese Unternehmung verband literarische Sensibilität mit statistischer und ethnografischer Methodik. Sie fügte der öffentlichen Debatte über Strafrecht, Zwangsarbeit und Verwaltungspraxis im Imperium konkrete Beobachtungen hinzu. In der Sammlung begegnen, teils indirekt, Motive von Recht, Schuld, Institutionenhandeln und moralischer Verantwortung, die aus solchen Recherchen genährt sind. Der Sachalin-Komplex markiert Tschechows Interesse an Faktenprüfung und an Formen der Zeugenschaft, die nicht in Pamphlete, sondern in künstlerische Verdichtung münden.
Das Theaterwesen durchlief in den 1880er und 1890er Jahren einschneidende Veränderungen. Mit der Aufhebung des kaiserlichen Theatermonopols 1882 konnten private Bühnen in den Hauptstädten entstehen; Bühnenbild, Regie und Beleuchtung professionalisierten sich. Tschechows Die Möwe erlitt 1896 an einem kaiserlichen Haus in Sankt Petersburg ein Fiasko, wurde jedoch 1898 am neu gegründeten Moskauer Künstlertheater unter Konstantin Stanislawski und Wladimir Nemirowitsch-Dantschenko zum Wendepunkt. Diese Produktionsbedingungen erklären, warum die in der Sammlung enthaltenen Dramen auf Ensemblekunst und subtile Zeichenökonomie setzen: Sie verlangten Probenarbeit, subtiles Licht und eine neue Aufmerksamkeit, die bürgerliche Zuschauer erst erlernen mussten.
Das Moskauer Künstlertheater prägte die Rezeptionsgeschichte von Tschechows Bühnenwerken. Sein Ensemble- und Regiekonzept zielte auf psychologische Plausibilität, Pausen, Untertöne und choreografierte Alltäglichkeit. Diese Spielweise machte es möglich, Werke wie Onkel Wanja, Drei Schwestern und Der Kirschgarten als Studien sozialer Bewegungen zu lesen, nicht als melodramatische Handlungstheater. Die strukturelle Modernisierung des Theaters – längere Proben, detaillierte Regiebücher, präzise Ausstattung – verschob Kriterien von Erfolg. Der stille Konflikt, die verfehlte Gelegenheit, die vertagte Entscheidung wurden bühnenfähig. Die Sammlung tritt so auch als Archiv eines Regiewandels auf, der die Wahrnehmung dramatischer Formen nachhaltig veränderte.
Intellektuell bewegte sich Tschechow zwischen einem nüchternen Empirismus, literarischem Realismus und der Sensibilität des Fin de Siècle. Der Einfluss der Naturwissenschaften – Statistik, Psychiatrie, Physiologie – strukturierte Diskurse über Mensch und Gesellschaft. Parallel gewannen religiös-ethische Debatten, etwa um Tolstojs Lehre, an Sichtbarkeit, ohne die Heterogenität der Intelligenzija aufzuheben. In den 1890er Jahren trat der Symbolismus hervor und erneuerte Bildsprache und Theaterästhetik. Tschechows Texte, in der Sammlung greifbar, vermeiden programmatische Lager, reagieren jedoch auf diese Spannungsfelder: Sie registrieren den Erosionsprozess fester Gewissheiten und zeigen Figuren, deren Sprache und Wahrnehmung von wissenschaftlichen, moralischen und ästhetischen Diskursen geprägt sind.
Die soziale Hierarchie des Imperiums war in Bewegung. Der alte Gutsadel verlor ökonomischen Halt; Kreditwesen und Landbanken veränderten Besitzverhältnisse, während städtische Unternehmer- und Beamtenmilieus wuchsen. Diese Verschiebungen spiegeln sich in Tschechows immer wiederkehrenden Räumen: verfallende Landhäuser, Amtsstuben, Schulen, Kliniken. In ihnen kreuzen sich Ansprüche auf Bildung, Kultur und Lebensstandard mit den Grenzen provinzieller Ökonomien. Die Sammlung zeigt einen historischen Moment, in dem Erbe, Titel und Ländereien an symbolischer Bedeutung gewinnen, während ihre materielle Basis bröckelt. Daraus resultieren Verzögerungen, wegweisende Entscheidungen bleiben aus; soziale Mobilität verbindet sich mit Verlustgefühlen und einem historisch begründeten Beharrungswillen.
Reformen im Bildungswesen erweiterten den Zugang zu höherer Bildung, wenn auch ungleich. Die 1878 eröffneten Bestuschew-Kurse boten Frauen in Sankt Petersburg akademische Ausbildung; Lehrerinnen-, Ärztinnen- und Büroberufe entstanden im späten 19. Jahrhundert als neue Optionen. Diese Entwicklungen prägten Publikum und Figurenhorizont. Tschechow entwarf Frauenfiguren, deren Ambitionen, Professionalisierung und kulturelle Teilhabe vor dem Hintergrund realer Chancen und Schranken lesbar werden. Gleichzeitig verschärfte das Universitätsstatut von 1884 die staatliche Kontrolle über Hochschulen, was studentische Milieus politisierte. Die Sammlung dokumentiert, indirekt, diesen Doppelprozess: wachsende Bildungsaspirationen und administrative Begrenzungen, die Erwartungen formen, ohne sie planmäßig zu erfüllen.
Die politische Öffentlichkeit blieb bis 1905 vom autokratischen System bestimmt: keine repräsentative Volksvertretung, ausgebauter Polizeiapparat, Vorzensur für Presse und Theater. Autoren und Bühnen navigierten zwischen Genehmigungen, Kürzungen und gesellschaftlichen Erwartungen. Tschechows Dramen reagierten mit Andeutung, Ellipse und subtextueller Spannung auf diese Bedingungen. In der Presse kam es zudem zu weltanschaulichen Konflikten; Tschechow arbeitete lange mit dem konservativen Verleger Alexej Suworin zusammen und distanzierte sich Ende der 1890er Jahre, auch vor dem Hintergrund der Dreyfus-Affäre. Die Sammlung trägt Spuren dieser Konstellation: Sie favorisiert Ambiguität und genaue Beobachtung statt programmatischer Politik, ohne soziale Wirklichkeit zu verharmlosen.
Topografisch reicht Tschechows Werk von der russischen Steppe bis zur Schwarzmeerküste. Nach Jahren in Melichowo (1892–1899), wo er medizinisch und sozial aktiv war, zog er aus gesundheitlichen Gründen nach Jalta. Die Krim entwickelte sich damals zu einem Kurort für Lungenkranke; klimatische Schonung und Seebäder galten als Therapie. Von dort reiste Tschechow regelmäßig zu Proben nach Moskau. 1904 starb er im badischen Badenweiler. Diese Bewegungen erklären, warum in der Sammlung Räume des Übergangs dominieren: Bahnhöfe, Pensionen, Landstraßen, Wartezimmer. Sie machen eine Gesellschaft sichtbar, deren Mobilität von Krankheit, Klima, Infrastruktur und kulturellen Institutionen gleichermaßen strukturiert ist.
Die unmittelbare Rezeption war ambivalent und dynamisch. Für die Sammlung Im Dämmer (V sumerkakh) erhielt Tschechow 1888 den Puschkin-Preis; Die Steppe festigte im selben Jahr seinen Ruf. Der Erfolg der Möwe am Künstlertheater veränderte den Ton der Kritik: Subtile Dialogführung, entdramatisierte Konflikte und die Genauigkeit der Alltagsbeobachtung wurden zum Maßstab. In der Presse stritt man über „Handlungslosigkeit“ und „Stimmungskunst“, zugleich wuchs das Publikum. Die Sammlung dokumentiert diesen Wandel: Prosa und Drama nähern sich an, indem beide auf Verdichtung, Untertöne und präzise Milieuschilderung setzen. Damit rückt eine neue Dramaturgie ins Zentrum, die weniger an Ereignissen als an Zuständen interessiert ist.
Nach 1905 und insbesondere nach 1917 wurden Tschechows Texte in Russland neu gelesen. In der Sowjetunion erhielten sie kanonischen Status und galten vielen als schonungslose Diagnose der spätimperialen Gesellschaft. Das Moskauer Künstlertheater hielt seine Stücke im Repertoire; Regisseure weltweit übernahmen die Inszenierungstradition oder konfrontierten sie mit neuen Schulen. Übersetzungen verbreiteten die Prosa breit; im englischsprachigen Raum prägten ab den 1910er Jahren maßgebliche Übertragungen die Wahrnehmung. International wurden Tschechows Kurzformen und seine dramatische Subtexttechnik zu Bezugspunkten einer modernen, ökonomischen Erzähl- und Theaterpraxis. Die Sammlung steht damit im Zentrum globaler Ästhetik- und Rezeptionsgeschichten des 20. Jahrhunderts.
Die Gesammelten Werke kommentieren ihre Entstehungszeit, indem sie Transformationen, Ambivalenzen und Stillstände des späten Zarenreichs in präzise Szenen überführen. Politische Großereignisse erscheinen als soziale Mikroveränderungen: Berufsrollen, Bildungswege, Besitzverhältnisse, Reise- und Kommunikationsformen. Spätere Deutungen sahen darin existenzielle Befunde, sozialkritische Analysen oder Wegmarken der Moderne. Die anhaltende Wirkung erklärt sich aus der historischen Nüchternheit: Tschechow liefert keine Thesenprosa, sondern beobachtet, wie Institutionen und Gewohnheiten Lebensentwürfe formen. In dieser Sammlung wird dies quer durch Dramen, Novellen und Kurzgeschichten erfahrbar – als historisch informierte Kunst, die fortwährend neue Lesarten im Licht veränderter Zeiten ermöglicht.
Synopsis (Auswahl)
Novellen und Kurzgeschichten – Frühe Satiren und Skizzen
Kurze, pointierte Stücke, die Alltagsfiguren und kleinbürgerliche Rituale mit leichtem Spott und beobachtender Genauigkeit zeigen. Missverständnisse und kleine moralische Verfehlungen treiben die Episoden voran, oft hin zu einer überraschenden, aber unsentimentalen Pointe. Der Ton ist heiter-ironisch und lakonisch.
Novellen und Kurzgeschichten – Psychologische Erzählungen der Reifezeit
Ausgreifendere Erzählungen rücken innere Konflikte, unerhörte Begebenheiten im Kleinen und die Ambivalenz von Motiven in den Mittelpunkt. Entscheidungen entstehen weniger aus äußeren Ereignissen als aus fein verfolgten Stimmungswechseln und sozialen Zwängen. Der Ton ist nüchtern, empathisch und von präziser Situationsbeobachtung geprägt.
Novellen und Kurzgeschichten – Späte Novellen und melancholische Prosa
Späte Texte kreisen um verpasste Möglichkeiten, Zeitverlust und die leise Erosion von Beziehungen. Naturbilder und Jahreszeiten verschieben die Stimmung, während offene Enden moralische Eindeutigkeiten vermeiden. Der Grundton wird stiller und elegischer, ohne den klaren Blick auf soziale Wirklichkeiten zu verlieren.
Dramen – Komödien des Alltags
Bühnenbilder des täglichen Lebens, in denen kleine Anlässe, Etikette und Missverständnisse das komische Potenzial entfalten. Dialoge enthüllen Wünsche und Eitelkeiten, während die Handlung scheinbar auf der Stelle tritt. Die Leichtigkeit der Form überdeckt eine latente Unzufriedenheit und gibt den Stücken eine bittersüße Note.
Dramen – Familiendramen und Provinztragikomödien
Ensemblestücke in Guts- und Provinzmilieus, in denen Besitzfragen, Erwartungen und unerfüllte Liebe konkurrieren. Figuren reden aneinander vorbei, und Konflikte erscheinen in verschobenen Akzenten statt in großen Ausbrüchen. Der Ton verbindet Melancholie mit trockener Komik und zeigt, wie Träume an der Realität reiben.
Dramen – Späte Stücke der leisen Katastrophen
Späte Bühnenarbeiten zeigen Übergänge und Abschiede, in denen gesellschaftlicher Wandel eher gespürt als ausgesprochen wird. Wesentliches geschieht in Untertönen, Pausen und Nebenhandlungen; die äußere Handlung bleibt reduziert. Die Tragik ist leise, das Finale offen genug, um Nachhall statt Auflösung zu erzeugen.
Gesamtwerk – Wiederkehrende Themen und Stilentwicklung
Wiederkehrend sind Sinnsuche, verfehlte Chancen, soziale Reibungen und Mitgefühl ohne Sentimentalität. Stilistisch prägen Ökonomie, Untertext und der präzise, beinahe klinische Blick die Texte, die Lachen und Schmerz dicht nebeneinanderstellen. Vom frühen satirischen Zugriff hin zur späten Elegie verdichtet sich die Kunst des Weglassens.
Gesammelte Werke: Dramen + Erzählungen + Novellen
Novellen und Kurzgeschichten
Geschichten in Grau
Der Taugenichts
Übersetzt von Alexander Eliasberg
I
Mein Chef sagte mir: »Ich behalte Sie nur mit Rücksicht auf Ihren ehrenwerten Herrn Vater, sonst wären Sie schon längst hinausgeflogen.« Ich antwortete: »Exzellenz tun mir zu viel Ehre an, wenn Sie annehmen, daß ich fliegen kann.« Und dann hörte ich ihn noch sagen: »Schaffen Sie diesen Herrn fort, er geht mir auf die Nerven.«
Nach zwei Tagen war ich entlassen. So habe ich, seitdem ich sozusagen erwachsen bin, zum großen Kummer meines Vaters, des Stadtarchitekten, bereits neun Stellungen gewechselt. Ich war in allen möglichen Ressorts angestellt gewesen, aber alle neun Stellungen glichen sich wie die Wassertropfen: überall mußte ich sitzen, schreiben, dumme oder rohe Bemerkungen anhören und warten, daß man mich entläßt.
Mein Vater saß, als ich zu ihm kam, tief in seinem Sessel und hielt die Augen geschlossen. Sein mageres, trockenes Gesicht mit einem bläulichen Schimmer auf den rasierten Stellen – (er hatte einige Ähnlichkeit mit einem katholischen Organisten) drückte Demut und Ergebenheit aus. Ohne meinen Gruß zu erwidern und ohne die Augen zu öffnen, sagte er zu mir:
»Wenn meine teure Frau, deine Mutter, noch lebte, so wäre dein Leben für sie eine Quelle unaufhörlicher Schmerzen. In ihrem frühen Tode erblicke ich Gottes Vorsehung. Ich bitte dich, du Elender,« fuhr er fort, die Augen öffnend, »sag' einmal selbst, was soll ich mit dir machen?«
In früheren Jahren, als ich noch jünger war, wußten alle meine Verwandten und Bekannten sehr gut, was mit mir zu machen wäre: die einen rieten zum Einjährigendienst, andere zu einer Stellung in einer Apotheke, und die dritten zu einer am Telegraph. Jetzt, wo ich fünfundzwanzig Jahre alt bin und die ersten grauen Haare an den Schläfen habe, wo ich bereits Einjähriger, Apothekerlehrling und Telegraphist gewesen bin, scheint alles Irdische für mich erschöpft, und man rät mir nichts mehr, sondern seufzt nur oder schüttelt den Kopf.
»Was denkst du dir eigentlich?« fuhr mein Vater fort. »Andere junge Leute haben in deinem Alter schon eine sichere soziale Position; aber was bist du? Ein Proletarier, ein Bettler, der seinem Vater zur Last fällt!«
Und er begann, seiner Gewohnheit gemäß, davon zu sprechen, daß die Jugend von heute an Unglauben, Materialismus und übermäßiger Einbildung zugrunde gehe und daß man die Liebhaberaufführungen verbieten müsse, weil sie die jungen Leute von der Religion und von ihren Pflichten ablenkten.
»Morgen gehen wir zusammen hin, du wirst deinen Chef um Entschuldigung bitten und ihm versprechen, deine Pflicht gewissenhaft zu tun,« so schloß er seine Rede. »Keinen einzigen Tag darfst du ohne eine soziale Position bleiben.«
»Ich bitte Sie, hören Sie mich an, sagte ich mürrisch. Ich erwartete nichts Gutes von diesem Gespräch. »Das, was Sie eine gesellschaftliche Position nennen, ist ein Privileg des Kapitals und der Bildung. Aber die Besitzlosen und die Ungebildeten verdienen sich ihr Stück Brot durch körperliche Arbeit, und ich sehe gar nicht ein, warum ich eine Ausnahme bilden soll.«
»Wenn du von körperlicher Arbeit zu sprechen anfängst, so sind deine Worte immer dumm und abgeschmackt!« sagte mein Vater gereizt. »Begreif es doch, du stumpfsinniger Mensch, begreife es doch, du Schafskopf, daß du außer der rohen körperlichen Kraft auch noch einen Geist Gottes, ein heiliges Feuer in dir hast, das dich im höchsten Maße vom Esel oder vom Reptil unterscheidet und der Gottheit nahebringt! Dieses Feuer ist im Laufe von Jahrtausenden von den besten unter den Menschen gewonnen worden. Dein Urgroßvater, der General Polosnjew hat bei Borodino gekämpft, dein Großvater war Dichter, Redner und Adelsmarschall, dein Onkel – Schulmann, und endlich ich, dein Vater, bin Architekt. Alle Polosnjews haben das heilige Feuer gehütet, nur damit du es auslöschst!«
»Man muß gerecht sein,« sagte ich. »Der körperlichen Arbeit unterziehen sich Millionen von Menschen.«
»Sollen sie sich ihr nur unterzieben! Sie können eben nichts anderes. Körperliche Arbeit kann jeder leisten, selbst der größte Dummkopf und Verbrecher, sie charakterisiert den Sklaven und den Barbaren, während das heilige Feuer nur wenigen gegeben ist!«
Dieses Gespräch fortzusetzen, hatte gar keinen Zweck. Mein Vater vergötterte sich, und für ihn war nur das überzeugend, was er selbst sagte. Außerdem wußte ich sehr gut, daß der Hochmut, mit dem er über die körperliche Arbeit sprach, weniger auf den Erwägungen bezüglich des heiligen Feuers beruhte, als auf der Angst, daß ich wirklich Arbeiter und der ganzen Stadt zum Spott werden könnte; vor allen Dinge aber hatten schon alle meine Altersgenossen die Universität absolviert und waren auf dem besten Wege, Karriere zu machen; der Sohn des Reichsbankdirektors z. B. besaß schon den Rang eines Kollegienassessors, ich aber, sein einziger Sohn, war noch nichts! Dieses Gespräch fortzusetzen, war zwecklos und unangenehm, aber ich saß noch immer da und machte schwächliche Einwendungen in der Hoffnung, daß er mich vielleicht am Ende doch verstehen würde. Für mich war ja die ganze Frage ganz einfach und sonnenklar: es handelte sich nur noch darum, auf welche Weise ich mein Stück Brot verdienen könnte. Aber mein Vater wollte das Einfache nicht einsehen, sondern sprach in gedrechselten, süßlichen Sätzen von Borodino, vom heiligen Feuer, von meinem Onkel, dem vergessenen Dichter, der einst schlechte, verlogene Gedichte geschrieben, und nannte mich in seiner rohen Art einen Schafskopf und einen stumpfsinnigen Menschen. Und ich sehnte mich so sehr danach, verstanden zu werden! Trotz alledem liebe ich aber meinen Vater und meine Schwester, und die kindliche Gewohnheit, sie in allen Dingen um Erlaubnis zu fragen, ist in mir so tief eingewurzelt, daß ich mich von ihr wohl kaum jemals freimache; ganz gleich, ob ich im Recht oder Unrecht bin, ich fürchte immer, ihnen Kummer zu bereiten, fürchte, daß mein Vater einen roten Hals bekommt oder daß ihn gar der Schlag trifft.
»In einem dumpfen Zimmer zu sitzen,« sagte ich, »Papiere abzuschreiben und mit einer Schreibmaschine zu konkurrieren, ist für einen Menschen in meinem Alter beschämend und beleidigend. Wie kann da überhaupt von einem heiligen Feuer die Rede sein!«
»Es ist immerhin geistige Arbeit,« entgegnete mein Vater. »Aber genug, brechen wir dieses Gespräch ab. Doch für jeden Fall muß ich dich warnen: wenn du deinen Dienst nicht wieder antrittst und deinen verächtlichen Neigungen folgst, so entziehen wir dir, ich und meine Tochter, unsere Liebe. Ich werde dich enterben, das schwöre ich dir bei Gott!«
Ich sagte darauf ganz aufrichtig, nur um die Reinheit der Motive, von denen ich mich mein Leben lang leiten lassen wollte, zu zeigen:
»Diese Frage erscheint mir nicht so wichtig. Ich verzichte auf die Erbschaft schon von vornherein.«
Diese Worte verletzten meinen Vater ganz wider Erwarten äußerst schwer. Er wurde über und über rot.
»Untersteh dich nicht, mit mir so zu sprechen, Dummkopf!« schrie er mit einer dünnen, kreischenden Stimme. »Du Taugenichts!« Und er versetzte mir mit einer geschickten, gewohnten Bewegung schnell hintereinander zwei Ohrfeigen. »Du vergißt dich letztens gar zu oft!«
In meiner Kindheit mußte ich, wenn mich mein Vater schlug, stramm, die Hände an der Hosennaht, stehen und ihm gerade ins Gesicht sehen. Und wie er mich jetzt schlug, fiel ich gleichsam in meine Kinderjahre zurück, und stand stramm und sah ihm in die Augen. Mein Vater war alt und sehr mager, seine Muskeln waren aber wohl dünn und zäh wie Riemen, denn seine Schlägt taten sehr weh.
Ich zog mich ins Vorzimmer zurück, aber hier ergriff er seinen Regenschirm und schlug mich damit einigemal auf Kopf und Schultern; in diesem Augenblick öffnete meine Schwester die Wohnzimmertüre, um zu sehen, woher der Lärm komme; als sie die Szene sah, wandte sie sich sofort mit einem Ausdruck von Mitleid und Schreck wieder fort, ohne auch nur ein Wort für mich einzulegen.
Mein Entschluß, in die Kanzlei nicht zurückzukehren, sondern ein neues Arbeitsleben zu beginnen, stand unwankbar fest. Es blieb mir nur noch übrig, die Art der Arbeit zu wählen, und das erschien mir nicht sonderlich schwer, da ich mich für außerordentlich stark, ausdauernd und jeder Arbeit gewachsen hielt. Mir stand ein eintöniges Arbeitsleben mit Hunger, Armeleutegeruch, Roheit und der ständigen Sorge um das tägliche Brot bevor, Und – wer weiß? – vielleicht werde ich, wenn ich durch die Große Adelsstraße von der Arbeit heimgehe, mehr als einmal den Ingenieur Dolschikow beneiden, der von geistiger Arbeit lebt; aber jetzt freute es mich nur, an alle meine zukünftigen Schwierigkeiten zu denken. Einst hatte ich von einer geistigen Tätigkeit geträumt und mich schon als Lehrer, Arzt oder Dichter gesehen, aber die Träume blieben eben Träume. Der Hunger nach geistigen Genüssen – z. B. nach Theater und Büchern, war in mir bis zur Leidenschaft entwickelt, ob ich aber auch die Fähigkeit besaß, mich auf diesen Gebieten selbst zu betätigen, das weiß ich nicht. Auf dem Gymnasium hatte ich eine unüberwindliche Abneigung gegen Griechisch, so daß ich aus der vierten Klasse austreten mußte. Lange Zeit nahm ich Privatunterricht und bereitete mich für die fünfte Klasse vor; dann diente ich in den verschiedenen Ressorts, wobei ich den größten Teil des Tages nichts zu tun hatte, aber das nannte man geistige Arbeit! Das Studium und der Staatsdienst erforderten weder Geistesanspannung, noch Talente, weder persönliche Fähigkeiten, noch schöpferischen Aufschwung: sie waren rein mechanisch. Solche geistige Arbeit schätze ich aber viel niedriger als die körperliche ein, ich verachte sie und glaube nicht, daß sie ein müßiges, sorgloses Leben auch nur einen Augenblick lang zu rechtfertigen vermag, da sie doch selbst nur Betrug und eine Form von Müßiggang ist. Die wahre geistige Arbeit habe ich wahrscheinlich nie gekannt. Der Abend brach an. Wir wohnten in der Großen Adelsstraße, der Hauptstraße unserer Stadt, auf der in den Abendstunden in Ermangelung eines ordentlichen Stadtgartens unsere vornehme Welt zu promenieren pflegte. Diese schöne Straße ersetzte zum Teil einen Garten, da sie zu beiden Seiten von Pappeln eingefaßt war, die, besonders nach einem Regen, herrlich dufteten, und aus den Gartenzäunen Akazien, Fliederbüsche, Faul- und Apfelbäume hervorlugten. Die Maiendämmerung, das zarte, junge Grün voller Schatten, der Fliederduft, das Summen der Käfer, die Stille, die Wärme – wie neu und ungewöhnlich war das alles, obwohl es sich jedes Jahr wiederholte! Ich stand vor der Gartenpforte, und sah mir die Spaziergänger an. Mit den meisten von ihnen war ich aufgewachsen und hatte als Kind gespielt; jetzt wäre ihnen aber meine Bekanntschaft peinlich gewesen, denn ich war ärmlich und nicht nach der Mode gekleidet, und meine engen Hosen und plumpen Stiefel waren allen zum Spott. Zudem stand ich überhaupt in schlechtem Ruf, da ich keine gesellschaftliche Position besaß und oft in billigen Gasthäusern Billard spiele; außerdem vielleicht auch aus dem Grunde, weil man mich zweimal ohne den geringsten Anlaß meinerseits auf die Gendarmerie vorgeladen hatte.
Im großen Hause gegenüber, beim Ingenieur Dolschikow, spielte man Klavier. Es dunkelte, und am Himmel leuchteten die Sterne auf. Da kommt langsam, in seinem altmodischen Zylinder mit breiter, nach oben gebogener Krempe, nach allen Seiten grüßend, Arm in Arm mit meiner Schwester mein Vater gegangen.
»Sieh einmal!« sagt er zu meiner Schwester und zeigt mit demselben Regenschirm, mit dem er mich vorhin geprügelt, nach oben: »Sieh den Himmel! Die Sterne, selbst die winzigsten unter ihnen sind ganze Welten! Wie nichtig ist doch der Mensch im Vergleich zum Weltall!«
Und das sagte er in einem Ton, als ob es ihm schmeichelhaft und angenehm wäre, so nichtig zu sein. Was war er doch für ein talentloser, unbedeutender Mensch! Leider war er unser einziger Architekt, und aus diesem Grunde ist bei uns in den letzten fünfzehn – zwanzig Jahren kein einziges anständiges Haus erstanden. Wenn man bei ihm einen Plan bestellte, so zeichnete er immer zuerst einen Saal und ein Wohnzimmer; ebenso wie die Institutschülerinnen der guten alten Zeit nur von einer bestimmten Stelle des Zimmers, nämlich vom Ofen zu tanzen verstanden, so vermochte sich die künstlerische Phantasie meines Vaters nur vom Saal und Wohnzimer aus zu entfalten. Daran zeichnete er ein Eßzimmer, ein Kinderzimmer und ein Kabinett und verband alle diese Räume durch Türen, so daß jedes Zimmer zu einem Durchgangszimmer wurde und je zwei oder auch drei Türen zuviel hatte. Seine Phantasie war augenscheinlich verworren und dürftig; als fühlte er, daß irgend etwas fehlte, griff er jedesmal zu allerlei Anbauten, die er einfach aneinanderreihte. Ich sehe auch heute noch die engen Vorzimmer und Korridore, die krummen Treppchen zum Zwischenstock, wo man nur gebückt stehen konnte und wo drei Riesenstufen in der Größe von Pritschen den Fußboden ersetzten. Die Küche befand sich aber unbedingt im Kellergeschoß und hatte eine gewölbte Decke und einen Ziegelfußboden. Die Fassade blickte eigensinnig und langweilig drein und hatte trockene, nichtssagende Linien; das Dach war niedrig und flach, und auf den dicken, gleichsam geschwollenen Schornsteinen saßen unbedingt Drahtkappen mit schwarzen quietschenden Wetterfahnen. Alle diese von meinem Vater erbauten Häuser ähnelten sich und erinnerten mich aus irgendeinem Grunde an seinen Zylinderhut und seinen trockenen und eigensinnigen Nacken. Im Laufe der Zeit gewöhnte man sich in der Stadt an die Geschmacklosigkeit meines Vaters, sie faßte Wurzeln und wurde zu unserm Stil.
Nach dem gleichen Stil gestaltete er auch das Leben meiner Schwester. Es begann damit, daß er sie Kleopatra taufte (mich hatte er aber Missail genannt). Als sie noch ein Kind war, machte er ihr mit seinen Reden über die Sterne, über die alten Weisen und über unsere Ahnen Angst, erklärte ihr lang und breit, was das Leben und was die Pflicht sei; und auch jetzt, da sie bereits sechsundzwanzig Jahre alt war, betrieb er ihre Erziehung auf die gleiche Weise und erlaubte ihr, nur mit ihm allein Arm in Arm zu gehen. Aus irgendeinem Grunde bildete er sich ein, es müsse früher oder später ein anständiger junger Mann kommen, der sie aus Achtung vor den Tugenden ihres Vaters heiraten würde. Sie aber betete den Vater an und glaubte an seinen ungewöhnlichen Geist.
Es war ganz dunkel geworden, und die Straße leerte sich allmählich. Im Hause war das Klavierspiel verstummt. Das Tor wurde weit geöffnet, und über unsere Straße rollte mit gedämpftem Schellengeläute eine Troika. Der Ingenieur fuhr mit seiner Tochter spazieren. Es war Zeit zum Schlafen.
Ich hatte zwar im Hause mein eigenes Zimmer, wohnte aber auf dem Hofe in einer Hütte, die an einen Stall angebaut war. Die Hütte hatte einst zum Aufbewahren von Pferdegeschirr gedient, und in den Wänden steckten große Haken. Jetzt stand sie leer, und mein Vater benutzte sie als Ablage für seine Zeitungen, die er halbjährlich binden ließ und die niemand anrühren durfte. Wenn ich hier wohnte, kam ich meinem Vater und seinen Gästen weniger unter die Augen, und es schien mir, daß, wenn ich nicht in einem richtigen Zimmer wohnte und nicht jeden Tag zu Hause zu Mittag aß, die Worte meines Vaters, daß ich ihm zur Last falle, weniger verletzend seien.
Meine Schwester erwartete mich schon. Sie brachte mir heimlich mein Abendessen: ein kleines Stück kaltes Kalbfleisch und eine Scheibe Brot. Bei uns zu Hause hieß es immer: »Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.« Meine Schwester stand unter dem Drucke solcher Redensarten und dachte nur noch daran, wie sie die Ausgaben vermindern könnte; deshalb aß man bei uns im allgemeinen schlecht. Sie stellte den Teller auf den Tisch, setzte sich auf mein Bett und fing zu weinen an.
»Missail,« sagte sie, »was tust du uns an?«
Sie bedeckte ihr Gesicht nicht, die Tränen fielen ihr auf Brust und Hände, und ihre Züge drückten tiefe Trauer aus. Sie sank auf das Kissen, ließ den Tränen freien Lauf, zitterte am ganzen Leibe und schluchzte.
»Du hast schon wieder deine Stellung verloren,« sagte sie. »Wie schrecklich ist das!«
»Aber so höre doch, Schwester, begreife mich ...« fing ich an. Ihre Tränen brachten mich zur Verzweiflung.
Wie zum Trotz war das Petroleum in meinem Lämpchen ausgebrannt; es qualmte und wollte verlöschen. Die alten Haken an den Wänden blickten streng drein, und ihre Schatten bewegten sich.
»Erbarme dich unser!« sagte meine Schwester, sich vom Bette erhebend. »Unser Vater ist tief unglücklich, und ich bin krank und fürchte den Verstand zu verlieren. Was wird aus dir?« fragte sie schluchzend, die Hände nach mir ausstreckend. »Ich bitte dich, ich flehe dich im Namen unserer verstorbenen Mutter an: geh wieder in Stellung!«
»Ich kann nicht, Kleopatra!« sagte ich, obwohl ich fühlte, daß nicht mehr viel fehlte, daß ich mich ergebe. »Ich kann nicht!«
»Warum dene nicht?« fuhr meine Schwester fort. »Warum? Nun, wenn du dich mit deinem Chef nicht vertragen kannst, so suche dir eine andere Stellung. Warum sollst du zum Beispiel nicht zur Eisenbahn gehen? Ich habe eben mit Anjuta Blagowo gesprochen; sie behauptet, daß man dich bei der Eisenbahn ganz bestimmt nehmen wird, und verspricht sogar, sich für dich zu verwenden. Um Gottes willen, Missail, überlege es dir! Ich flehe dich an!«
Wir sprachen noch ein Weilchen, und ich gab schließlich nach. Ich sagte ihr, daß der Gedanke an eine Stellung beim Eisenbahnbau mir noch gar nicht gekommen und daß ich nicht abgeneigt sei, die Sache zu probieren.
Sie lächelte freudig unter Tränen und drückte mir die Hand. Sie weinte fort und konnte sich lange nicht beruhigen. Ich aber ging in die Küche nach Petroleum.
II
Unter den Veranstaltern von Liebhaberaufführungen, Konzerten und lebenden Bildern zu wohltätigen Zwecken spielten in unserer Stadt die Aschogins, die im eigenen Hause auf der Großen Adelstraße wohnten, die erste Rolle; sie gaben jedesmal ihre Räume her und übernahmen alle Scherereien und Auslagen. Diese reiche Gutsbesitzersfamilie besaß im Landkreise ein Gut von dreitausend Deßjatinen mit einem herrlichen Herrenhause, liebte aber das Landleben nicht und wohnte im Winter wie im Sommer in der Stadt. Die Familie bestand aus der Mutter, einer groß gewachsenen, hageren, vornehmen Dame, die die Haare kurz geschoren trug und sich nach englischer Mode kleidete, und aus drei Töchtern, die man niemals bei ihren Namen nannte, sondern einfach mit die Aelteste, die Mittlere, die Jüngste bezeichnete. Alle drei Töchter hatten ein spitzes Kinn, waren unschön und kurzsichtig, hielten sich gebückt, kleideten sich wie die Mutter und lispelten höchst unangenehm. Trotzdem nahmen sie unbedingt an jeder Vorstellung teil und betätigten sich immer zu wohltätigen Zwecken; entweder spielten sie, rezitierten oder sangen. Sie waren sehr ernst und lächelten niemals; selbst in Possen mit Gesang spielten sie ohne den leisesten Humor, mit einem so geschäftsmäßigen Ausdruck, als wenn sie Buchhaltung trieben.
Ich liebte unsere Aufführungen und ganz besonders die häufigen, etwas unordentlichen, geräuschvollen Proben, nach denen man immer ein Abendbrot bekam. An der Auswahl der Stücke und der Verteilung der Rollen beteiligte ich mich nicht. Ich betätigte mich nur hinter den Kulissen. Ich malte die Dekorationen, schrieb die Rollen ab, soufflierte, schminkte die Darsteller und sorgte für solche Effekte wie Donner, Nachtigallenschlag usw. Da ich weder eine gesellschaftliche Position noch anständige Kleider besaß, hielt ich mich bei den Proben abseits, im Schatten der Kulissen und schwieg.
Die Dekorationen malte ich bei den Aschogins auf dem Hofe oder im Stall. Mir half dabei der Maler oder »Unternehmer für Malerarbeiten«, wie er sich nannte, Andrej Iwanow. Es war ein Mann von etwa fünfzig Jahren, groß, sehr mager und blaß; er hatte eine eingefallene Brust, eingedrückte Schläfen und blaue Ringe um die Augen und sah sogar etwas unheimlich aus. Er litt an irgendeiner auszehrenden Krankheit, und jeden Herbst und Frühling hieß es von ihm, daß er sterbe. Aber er stand immer wieder auf und sagte dann verwundert: »Ich bin nun wieder nicht gestorben!«
In der Stadt nannte man ihn »Rettich« und behauptete, daß das sein richtiger Name sei. Er liebte das Theater ebenso wie ich, und sobald er hörte, daß man wieder eine Liebhaberaufführung plane, ließ er alle seine Arbeiten liegen und ging zu den Aschogins, um Dekorationen zu malen.
Am Tage nach der Aussprache mit meiner Schwester arbeitete ich vom frühen Morgen an bei den Aschogins. Die Probe war auf sieben Uhr abends angesetzt, und eine Stunde vor Beginn hatten sich schon alle Liebhaber im Saale versammelt. Die Aelteste, die Mittlere und die Jüngste gingen auf und ab und lasen ihre Rollen. Rettich lehnte schon in seinem langen rotbraunen Mantel mit einem Tuch um den Hals an der Wand und blickte mit andächtigen Augen auf die Bühne. Frau Aschogina-Mutter ging bald auf den einen, bald auf den anderen Gast zu und sagte einem jeden etwas Angenehmes. Sie hatte die Manier, einen jeden scharf ins Gesicht zu blicken und so leise zu sprechen, als wären es lauter Geheimnisse.
»Es muß doch recht schwer sein, Dekorationen zu malen,« sagte sie leise zu mir. »Als Sie eintraten, sprach ich gerade mit Madame Muffke von den Vorurteilen. Mein Gott, ich habe mein ganzes Leben lang gegen die Vorurteile gekämpft! Um die Dienstboten von der Grundlosigkeit des Aberglaubens zu überzeugen, pflege ich stets drei Lichter anzuzünden und alles Wichtige am Dreizehnten zu beginnen.«
Nun kam die Tochter des Ingenieurs Dolschikow, eine üppige, schöne Blondine, die, wie man sich erzählte, lauter Pariser Sachen trug. Sie spielte nicht mit, aber bei allen Proben stand stets ein Stuhl für sie auf der Bühne bereit, und man begann mit der Vorstellung nicht eher, als bis sie, strahlend und alle durch ihre Toiletten in Verwunderung versetzend, in der ersten Reihe erschien. Als Großstädterin hatte sie das Privilegium, während der Proben Bemerkungen zu machen, und sie machte sie mit einem freundlichen, herablassenden Lächeln, dem man ansehen konnte, daß sie unsere Aufführungen als ein Kinderspiel betrachten, Man erzählte sich, sie hätte am Petersburger Konservatorium Gesang studiert und wäre sogar einen ganzen Winter lang in einer Operntruppe aufgetreten. Sie gefiel mir außerordentlich, und ich pflegte sie bei den Proben und Aufführungen nicht aus den Augen zu lassen.
Ich hatte schon das Heft in die Hand genommen, um mit dem Soufflieren zu beginnen, als plötzlich meine Schwester erschien. Ohne Mantel und Hut abzulegen, ging sie auf mich zu und sagte:
»Ich bitte dich, komm mit!«
Ich folgte ihr. Hinter der Bühne stand in der Türe Anjuta Blagowo, gleichfalls in Hut, mit einem dunklen Schleier vor dem Gesicht. Sie war die Tochter des Vizepräsidenten des Kreisgerichts, der schon sehr lange, fast seit der Gründung des Gerichtshofes in unserer Stadt amtierte. Da sie groß und schön gewachsen war, wirkte sie obligatorisch an den lebenden Bildern mit, und wenn sie irgendeine Fee oder Ruhmesgöttin darstellte, glühte ihr Gesicht vor Scham; aber in den Stücken spielte sie nicht mit und kam zu den Proben immer nur im Vorbeigehen, wenn sie jemand sprechen mußte. Auch jetzt war sie offenbar nur auf dem Sprunge hier.
»Mein Vater hat von Ihnen erzählt,« sagte sie trocken, ohne mich anzusehen und errötete. »Dolschikow hat eine Stelle für Sie bei der Bahn in Aussicht gestellt. Gehen Sie morgen zu ihm hin, er wird zu Hause sein.«
Ich verbeugte mich und dankte für die Bemühungen.
»Das können Sie übrigens lassen,« sagte sie, auf mein Soufflierheft zeigend.
Dann gingen sie und meine Schwester auf die Frau Aschogina zu und tuschelten eine Weile mit ihr, zu mir herüberblickend. Sie schienen etwas zu beraten.
»In der Tat,« sagte Frau Aschogina leise, an mich herantretend und mir gerade ins Gesicht blickend: »in der Tat, wenn Sie das von ernsthafter Beschäftigung ablenkt,« sie nahm mir das Heft aus der Hand, »so können Sie das jemand anders übergeben. Machen Sie sich darüber keine Sorgen, lieber Freund, gehen Sie mit Gott.«
Ich verabschiedete mich von ihr und ging verlegen hinaus. Auf der Treppe sah ich auch meine Schwester und Anjuta Blagowo weggehen. Sie sprachen eifrig über etwas, wahrscheinlich über meinen Eintritt in den Eisenbahndienst, und hatten es sehr eilig. Meine Schwester war bisher noch niemals bei einer Probe gewesen; daher hatte sie wohl jetzt Gewissensbisse und fürchtete, der Vater könnte erfahren, daß sie ohne seine Erlaubnis bei den Aschogins gewesen war.
Ich ging zu Dolschikow am nächsten Tag, bald nach zwölf. Ein Diener führte mich in ein sehr schönes Zimmer, das dem Ingenieur als Empfangszimmer und zugleich als Arbeitszimmer diente. Hier war alles weich, elegant und kam einem Menschen wie mir, der so etwas noch nie gesehen hatte, sogar seltsam vor. Lauter teure Teppiche, riesengroße Sessel, Bronzen, Bilder in Gold- und Plüschrahmen; an den Wänden Photographien, die sehr schöne Frauen mit klugen Gesichtern in ungezwungenen Posen darstellten; eine Tür führte aus dem Empfangszimmer auf die Veranda und in den Garten, und ich sah Fliederbüsche, einen gedeckten Tisch mit vielen Flaschen und einem Rosenstrauß; alles duftete nach Frühling, nach teuren Zigarren, alles atmete Glück und alles schien sagen zu wollen: siehst du, dieser Mensch hat sein Leben lang gearbeitet und schließlich alles Glück erreicht, das auf dieser Welt möglich ist. Am Schreibtische saß die Tochter des Ingenieurs und las in einer Zeitung.
»Sie kommen zu meinem Vater?« fragte sie. »Er nimmt gerade eine Dusche, gleich wird er kommen. Bitte, setzen Sie sich.«
Ich setzte mich.
»Sie wohnen, glaube ich, uns gegenüber?« fragte sie wieder nach einer Pause.
»Jawohl.«
»Vor Langweile schaue ich oft zum Fenster hinaus. Sie müssen es entschuldigen,« fuhr sie fort, in die Zeitung blickend, »ich sehe oft Sie und Ihre Schwester. Sie hat einen so gutmütigen und besorgten Gesichtsausdruck.«
Nun kam Dolschikow herein. Er trocknete sich mit einem Handtuch den Hals ab.
»Papa, es ist Herr Polosnjew,« sagte die Tochter.
»Ja, ja, Blagowo hat mir schon von Ihnen erzählt,« wandte er sich lebhaft an mich, ohne mir die Hand zu reichen. »Aber, hören Sie einmal, was soll ich für Sie tun? Was habe ich für Stellen zu vergeben? Ihr seid doch wirklich merkwürdige Menschen!« fuhr er sehr laut fort, in einem Tone, als ob er mir eine Rüge erteilte. »Täglich kommen an die zwanzig Menschen zu mir, die sich einbilden, daß ich hier ein Ministerium habe! Ich habe ja nur die Bauarbeiten unter mir, meine Herren, und kann nur Schwerarbeiter brauchen: Mechaniker, Schlosser, Erdarbeiter, Tischler, Brunnengräber. Ihr alle versteht aber nur in den Schreibstuben zu hocken. Ihr seid alle nichts als Schreiber!«
Er atmete dasselbe Glück wie seine Teppiche und Sessel. Voll, gesund, rotbackig, mit breiter Brust, frisch gewaschen, in farbigem Kattunhemd und Pluderhose, sah er wie ein Spielzeug, wie ein Kutscher aus Porzellan aus. Er hatte ein rundes, lockiges Bärtchen ohne ein einziges graues Haar, eine Adlernase und dunkle, klare, unschuldige Augen.
»Was verstehen Sie zu tun?« fuhr er fort. »Gar nichts verstehen Sie! Ich bin Ingenieur und gut versorgt, aber bevor ich diese Eisenbahn bekam, mußte ich lange schuften. Ich bin als Maschinist auf der Lokomotive herumgefahren und habe ganze zwei Jahre als einfacher Wagenschmierer in Belgien gearbeitet. Urteilen Sie nun selbst, mein Bester, was für eine Arbeit soll ich Ihnen anbieten?«
»Gewiß, das stimmt ...« stotterte ich in höchster Aufregung. Der Blick seiner klaren, unschuldigen Augen irritierte mich.
»Verstehen Sie wenigstens mit einem Telegraphenapparat umzugehen?« fragte er nach einiger Überlegung.
»Ja, ich habe schon den Telegraphen bedient.«
»Hm ... Nun, wir wollen sehen. Gehen Sie vorläufig nach Dubetschnja. Ich habe dort schon einen sitzen, aber der ist ein ganz unmöglicher Kerl.«
»Worin wird meine Tätigkeit bestehen?« fragte ich.
»Das wird sich schon zeigen. Gehen Sie nur hin, ich werde das Nötige anordnen. Aber um das eine muß ich Sie bitten: daß Sie mir nicht trinken und mich mit keinen Bittschriften behelligen. Sonst jage ich Sie gleich hinaus.«
Er ließ mich stehen und nickte mir nicht einmal mit dem Kopf. Ich verbeugte mich vor ihm und seiner Tochter, die in der Zeitung las, und ging. Es war mir so traurig zumute, und ich hatte so wenig Lust, die Stadt zu verlassen. Ich liebte meine Vaterstadt. Sie schien mir so hübsch und heimlich. Ich liebte dieses Grün, die stillen sonnigen Morgenstunden, das Läuten unserer Kirchenglocken; aber die Menschen, mit denen ich in dieser Stadt zusammenwohnte, langweilten mich und waren mir fremd, zuweilen sogar widerlich. Ich liebte sie nicht und verstand sie auch nicht.
Ich konnte nicht verstehen, wozu und wovon alle diese fünfundzwanzigtausend Menschen existierten. Ich wußte, daß die Stadt Kimry von Stiefeln lebte, daß Tula Samowars und Gewehre produzierte, daß Odessa eine Hafenstadt war, was aber unsere Stadt darstellte und was sie leistete, das war mir unbekannt. Die Große Adelsstraße und noch zwei andere bessere Straßen lebten von Zinsen und von den Gehältern, die der Staat den Beamten zahlte; wovon aber die übrigen acht Straßen lebten, die parallel zueinander drei Werst weit liefen und hinter dem Hügel verschwanden, das war für mich immer ein unlösbares Rätsel.
Und wie diese Menschen lebten, das war die reinste Schande! Es gab weder einen Stadtgarten, noch ein Theater, noch ein anständiges Orchester; die Stadt- und die Klubbibliothek wurden ausschließlich von halbwüchsigen Jungen besucht, und die Zeitschriften und neuen Bücher lagen monatelang unaufgeschnitten herum; selbst die reichen und gebildeten Menschen schliefen in schwülen, engen Räumen auf Holzbetten mit Ungeziefer, hielten ihre Kinder in scheußlichen, schmutzigen Löchern, die sie Kinderzimmer nannten, und die Dienstboten, selbst die alten und geachteten, mußten in der Küche auf dem Fußboden schlafen und sich mit elenden Lumpen zudecken. An Fleischtagen roch es in allen Häusern nach Kohlsuppe, und an Fasttagen – nach Stör und Sonnenblumenöl. Man aß schlecht zubereitete Speisen und trank ungesundes Wasser. Im Rathause, beim Gouverneur, beim Bischof, in allen Häusern sprach man jahrelang davon, daß wir in unserer Stadt kein billiges gutes Trinkwasser haben und daß man beim Staate eine Anleihe von zweihunderttausend Rubel machen sollte, um eine Wasserleitung zu bauen; auch die sehr reichen Leute, von denen es in unserer Stadt an die drei Dutzend gab, und die manchmal ganze Güter am Kartentisch verspielten, tranken das schlechte Wasser und sprachen ihr Leben lang mit großem Eifer von der Anleihe. Ich konnte das nicht verstehen: mir schien es viel einfacher, die zweihunderttausend Rubel aus eigener Tasche zu zahlen.
Ich kannte in unserer Stadt keinen einzigen ehrlichen Menschen. Mein Vater nahm Bestechungsgelder an und bildete sich ein, daß man sie ihm aus Achtung für seine seelischen Eigenschaften schenke; die Gymnasiasten mußten, um alljährlich versetzt zu werden, zu ihren Lehrern in Pension gehen, wofür sich diese ordentlich bezahlen ließen; die Frau des Stadtkommandanten ließ sich zur Zeit der Einberufungen von den Rekruten bestechen und sogar mit Alkohol traktieren, und einmal passierte es, daß sie in der Kirche beim Gottesdienst unmöglich von den Knien aufstehen konnte, da sie betrunken war; auch die Ärzte mußten bei den Einberufungen geschmiert werden, und der Bezirksarzt und der Veterinär hatten alle Fleischläden mit einer Steuer belegt; an der Kreisschule konnte man Atteste kaufen, die die Berechtigung zum Freiwilligendienst gaben; die Pröpste nahmen von den ihnen unterstellten Geistlichen und Kirchenvorstehern Geldgeschenke an; in allen Ämtern rief man jedem Besucher nach: »Es ist üblich, sich zu bedanken!«, und der Besucher kehrte um, um dreißig oder vierzig Kopeken zu geben. Diejenigen aber, die keine Bestechungsgelder annahmen, wie die Gerichtsbeamten, waren hochmütig, reichten bei der Begrüßung nur zwei Finger, zeichneten sich durch die Kälte und Beschränktheit ihrer Urteile aus, waren dem Kartenspiel und dem Trunke ergeben, heirateten reich und wirkten auf ihre Umgebung zweifellos schädlich und demoralisierend. Nur die jungen Mädchen atmeten Reinheit; die meisten von ihnen hatten hohe Bestrebungen und ehrliche, keusche Seelen; aber sie verstanden das Leben nicht und glaubten, daß die Bestechungsgelder in Anerkennung der seelischen Eigenschaften gegeben werden. Wenn sie aber heirateten, alterten sie früh, versumpften schnell und versanken hoffnungslos im Schlamme der trivialen, kleinbürgerlichen Existenz.
III
In unserer Gegend wurde eine Eisenbahn gebaut. An den Abenden vor den Feiertagen zogen Banden von zerlumpten Kerlen durch die Stadt, die man »Eisenbahner« nannte und vor denen man sich fürchtete. Gar oft sah ich, wie man so einen Kerl mit blutendem Gesicht, ohne Mütze zur Polizei führte, während hinter ihm als corpus delicti ein Samowar oder frischgewaschene, noch neue Wäsche getragen wurde. Die »Eisenbahner« drängten sich meistens bei den Schenken und auf den Märkten herum. Sie aßen und tranken, schimpften unflätig und begleiteten jede Dirne mit gellendem Pfeifen. Zur Unterhaltung dieser immer hungrigen Lumpen pflegten unsere Ladenbesitzer Katzen und Hunde mit Schnaps betrunken zu machen oder einem Hunde eine leere Petroleumkanne an den Schwanz zu binden; dann fingen sie zu pfeifen an, und der Hund raste, vor Entsetzen heulend, durch die Straße, während die Kanne dröhnte. Dem Hunde schien es, daß er von einem Ungeheuer verfolgt werde, er lief weit vor die Stadt ins freie Feld hinaus, bis ihn die Kräfte verließen; es gab in unserer Stadt mehrere Hunde, die immer zitterten und die Schweife eingezogen hielten; von ihnen sagte man, daß sie dieses Spiel nicht hatten ertragen können und verrückt geworden seien.
Der Bahnhof wurde fünf Werst von der Stadt erbaut. Man erzählte sich, daß die Ingenieure fünfzigtausend Rubel dafür gefordert hätten, daß der Bahnhof näher bei der Stadt läge; die Stadtverwaltung hätte dafür aber nur vierzigtausend geben wollen; wegen der zehntausend Rubel hätte sich das Geschäft zerschlagen; die Stadtverwaltung bereute es nun schwer, da sie bis zum Bahnhof eine Chaussee anlegen mußte, die viel teurer zu stehen kam. Auf der ganzen Strecke lagen schon die Schwellen und die Schienen und verkehrten Dienstzüge, die das Baumaterial beförderten; es fehlten nur noch die Brücken, die Dolschikow zu bauen hatte, und auch einige Stationsgebäude waren noch nicht ganz fertig.
Dubetschnja – so hieß unsere erste Station – lag siebzehn Werst von der Stadt entfernt. Ich ging zu Fuß. Die Saaten leuchteten grün in der Morgensonne. Die Gegend war flach und freundlich, und in der Ferne hoben sich klar der Bahnhof, die Hügel und entfernte Gutsgebäude ab ... Wie schön war es hier in Gottes freier Natur! Und wie gern wollte ich diese Freiheit genießen, wenigstens diesen einen Morgen lang, und nicht daran denken müssen, was in der Stadt vorging, nicht an meine Schwierigkeiten und an den Hunger, der mich quälte, denken müssen! Nichts hinderte mich am Lebensgenuß so sehr wie dieses nagende Hungergefühl, wenn meine besten Gedanken sich sonderbar mit den Vorstellungen von Buchweizengrütze, Koteletts und Bratfischen verquickten. Da stehe ich allein im Felde, blicke auf eine Lerche, die in der Luft unbeweglich zu schweben scheint und wie in einem hysterischen Anfall schmettert, und denke mir dabei: »Wie gut wäre es jetzt, ein Stück Butterbrot zu essen!« Oder ich setze mich am Straßenrande nieder, schließe die Augen, um auszuruhen und diesen herrlichen Frühlingsgeräuschen zu lauschen, und plötzlich muß ich an den Geruch gebratener Kartoffeln denken. Obwohl ich groß gewachsen und kräftig gebaut bin, bekam ich im allgemeinen wenig zu essen, und daher war der Hunger meine wesentlichste Empfindung im Laufe des Tages; darum verstand ich vielleicht auch so gut, weshalb so viele Menschen nur des Brotes wegen arbeiten und nur vom Essen sprachen.
In Dubetschnja arbeitete man gerade am Verputz der Innenwände des Stationsgebäudes und baute eine hölzernen Oberstock am Wasserturm. Es war heiß, es roch nach Kalk, und die Arbeiter trieben sich träge zwischen den Haufen von Schutt und Spänen herum; der Weichensteller schlief vor seinem Häuschen, und die Sonne brannte ihm gerade ins Gesicht. Kein einziger Baum war zu sehen. Leise summten die Telegraphendrähte, auf denen hie und da Habichte ausruhten. Ich drückte mich zwischen dem Schutt umher, wußte nicht, was anzufangen und dachte an die Antwort des Ingenieurs auf meine Frage, was ich hier zu tun haben würde: »Das wird sich schon zeigen.« Was konnte sich aber in dieser Wüste zeigen? Die Maurer sprachen von irgendeinem Polier und von einem gewissen Fedot Wassiljew; ich verstand es nicht, und meiner bemächtigte sich allmählich ein Unlustgefühl, – ein körperliches Unlustgefühl, bei dem man seine Arme und Beine und seinen ganzen großen Körper fühlt und nicht weiß, was mit ihnen anzufangen.
Nachdem ich mindestens zwei Stunden so herumgebummelt, bemerkte ich eine Reihe von Telegraphenstangen, die rechts von der Strecke abbogen und vor einer weißen Mauer aufhörten; die Arbeiter sagten mir, daß dort die Baukanzlei sei, und nun begriff ich endlich, daß ich mich dorthin zu wenden hatte.
Es war ein sehr altes, verwahrlostes Gutshaus. Die Mauer aus weißem porösem Stein war verwittert und stellenweise eingefallen. Der Seitenflügel, dessen blinde Wand nach dem Felde lag, hatte ein rostiges Eisendach, auf dem hie und da einige frisch geflickte Stellen glänzten. Durch das Tor sah ich einen sehr geräumigen Hof, der mit wildem Steppengras bewachsen war, und ein altes Herrenhaus mit Jalousien an den Fenstern und einem hohen, vor Rost ganz roten Dach. Rechts und links standen zwei vollkommen gleiche Seitenflügel; die Fenster des einen waren mit Brettern vernagelt, vor dem andern aber, dessen Fenster offen standen, war Wäsche zum Trocknen aufgehängt und weideten Kälber. Der letzte Telegraphenpfahl stand auf dem Hofe, und der Draht ging in eines der Fenster des Flügels, der mit seiner blinden Wand nach dem Felde lag. Die Türe war offen, und ich trat ein. Am Tisch mit dem Telegraphenapparat saß ein Herr mit dunklem Lockenkopf, mit einer Leinenjacke bekleidet; er blickte mich erst streng und mürrisch an, lächelte aber dann gleich und sagte:
»Guten Tag, kleiner Nutzen!«
Es war Iwan Tscheprakow, mein ehemaliger Schulkollege, den man aus der zweiten Klasse wegen Rauchens relegiert hatte. Wir pflegten einst zusammen zur Herbstzeit Stieglitze, Zeisige und Kernbeißer zu fangen und am frühen Morgen, wenn die Eltern noch schliefen, auf dem Markte zu verkaufen. Wir lauerten auch den Staren auf, schossen sie mit seinem Schrot an und sammelten dann die verwundeten. Die einen starben bei uns in schrecklichen Qualen (ich erinnere mich auch heute noch, wie sie nachts in ihrem Käfig stöhnten), die anderen aber, die wieder gesund wurden, verkauften wir und schworen dabei, daß es lauter Männchen seien. Einmal war mir auf dem Markte nur ein einziger Star übriggeblieben, den ich lange nicht anbringen konnte und schließlich für eine Kopeke verkaufte, »Es ist ja immerhin ein kleiner Nutzen!« sagte ich damals zum Trost, die Kopeke in die Tasche steckend, und von nun an hieß ich bei den Gassenjungen und Gymnasiasten »kleiner Nutzen«. Es kam auch jetzt noch vor, daß Gassenjungen und Händler mich damit neckten, obgleich wohl niemand mehr den Ursprung dieses Spitznamens kannte.