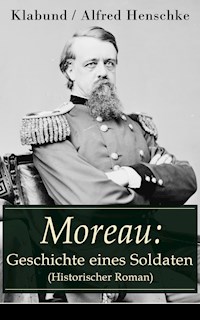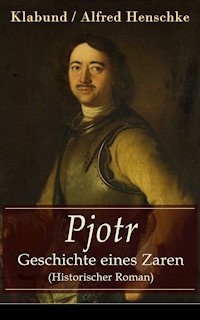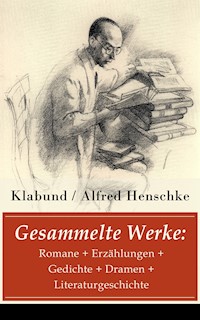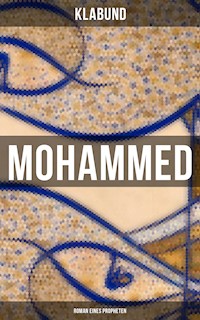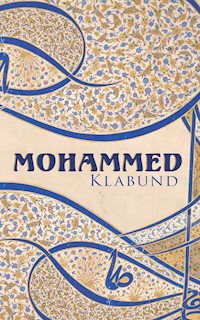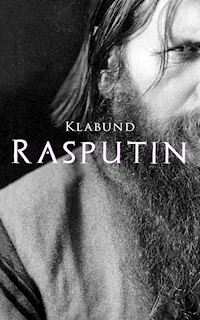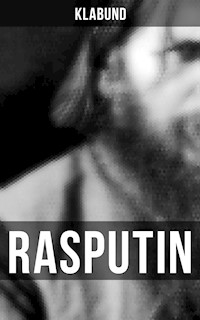0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die 'Geschichte der Weltliteratur in einer Stunde' ist eine ambitionierte Anthologie, die den Lesern einen schnellen, doch tiefgreifenden Einblick in die globale literarische Landschaft bietet. Unter der Federführung von Klabund, dem Pseudonym des deutschen Autors Alfred Henschke, vereint diese Sammlung essenzielle literarische Werke und Stile aus verschiedenen Epochen und Kulturen. Sie zielt darauf ab, einen kohärenten Überblick über die Evolution der literarischen Ausdrucksformen und deren universelle Bedeutungen zu geben. Die Auswahl der Texte demonstriert nicht nur die Vielfalt der literarischen Genres, sondern auch deren Fähigkeit, kulturelle und historische Kontexte widerzuspiegeln und zu beeinflussen. Alfred Henschke, bekannt als Klabund, war eine Schlüsselfigur der literarischen Moderne in Deutschland. Sein breites Werk und seine umfangreichen Einflüsse sind tief verwurzelt in der literarischen Tradition und Innovation. In dieser Anthologie repräsentieren seine sorgfältig ausgewählten Werke verschiedener Autoren eine kulturelle und epochemachende Diversität, die zu einem besseren Verständnis der kollektiven menschlichen Erfahrung beiträgt. Klabunds Ziel war es, eine Brücke zwischen den literarischen Kulturen zu schlagen und somit das globale literarische Erbe zugänglich zu machen. Diese Sammlung ist ideal für Leser, die an einem kompakten, aber umfassenden Überblick über die Weltliteratur interessiert sind. Sie bietet eine einzigartige Chance, in kurzer Zeit ein breites Spektrum an literarischen Stilen und Themen zu erleben und dabei kulturelle Grenzen zu überschreiten. Die Anthologie lädt dazu ein, den intertextuellen Dialog zwischen den Werken zu erkunden, wodurch ein tieferes Verständnis der literarischen Kunst und ihrer Rolle in der menschlichen Geschichte gefördert wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Geschichte der Weltliteratur in einer Stunde
Books
Inhaltsverzeichnis
Die Sehnsucht nach dem Licht Das Volk der Mitte und der Vermittlung
Inhaltsverzeichnis
Einleitung Als untrüglicher Beweis für das Dasein Gottes ragt das mystische Gebäude der Weltliteratur in Raum und Zeit, Traum und Ewigkeit. Mag beim Brand von Alexandria die kostbare Bibliothek in Flammen aufgehen, mit ihr das edelste Erbe der altgriechischen und altägyptischen Dichtung, mögen chinesische Kaiser die alten Schriften verbrennen, um jede Brücke nach der Vergangenheit abzubrechen um der Zukunft willen, mögen katholische Bischöfe die Dichtungen der Azteken oder Araber oder Germanen dem Autodafé überliefern: die Säulen, die aus dem Dom gebrochen wurden, sind längst ersetzt, und er wird als Realität und Idealität stehen, solange es Menschen gibt.
Ich schreibe diese Zeilen im Angesicht des Vesuv. Nachts spielt ein rötlicher Glanz um seinen Krater: ein neuer Ausbruch steht bevor. Die Bewohner der umliegenden Ortschaften sehen dem mit Gleichmut entgegen. Torre de Greco ist unzählige Male zerstört und immer wieder aufgebaut worden. So können die vulkanischen Ausbrüche der Geschichte wohl die Kulturen, aber niemals den Geist treffen, der sie erzeugt. Der ist unzerstörbar und wird aus den Trümmern immer neue Dome und Tempel erstehen lassen. Die Dichtung ist der höchste Ausdruck jener Kraft, die sich im Protoplasma dunkel regt und die der Pflanze die Sehnsucht nach dem Licht verlieh. Die Dramen Shakespeares, die Epen Homers, die Lieder Li-tai-pes sind wie Rosenöl, gepresst aus Milliarden Rosen.
Aber keine Rose blüht umsonst, auch die unscheinbarste nicht. In der Dichtung schlägt das Herz eines Volkes und sein Gewissen. Man könnte, ein Wort Spinozas variierend, sagen: Die Dichtung ist nicht die Vorstufe zu einem seligen Jenseits, sie ist dieses Jenseits selbst. Oder, wie du Prel sagt: Das Jenseits ist nur das anders angeschaute Diesseits. Denn jenseits dieser Welt gibt es nichts. Noch das Nirwana… ist diesseits. Die Sterne leuchten auch den Toten, diese Blumen blühen auch für sie. Nur daß die verklärten Geister sie anders sehen. Mit übermenschlichen oder unmenschlichen Augen. So sehen auch die Dichter diese Welt mit überoder unterirdischen Blicken. Gott ist der Geist. Und seine Geister sind die Dichter.
Die Dichtung jedes Volkes ist national und übernational zugleich. National in dem Sinn, daß sie auf der Sprache beruht: dem eigensten, was ein Volk schaffen kann. Übernational, indem sie seelische Strömungen, die von anderen Völkern kommen, aufnimmt, staut, für sich verarbeitet und weitergibt. Engstirnige Patrioten wollen die Völker voneinander abschließen. Ein solcher Abschluß würde nur die seelische Verkümmerung und Verkrüppelung eines Volkes zur Folge haben; abgesehen davon, daß es kaum möglich ist. Wir sehen heute alle Völker der Erde sich gegen den Bolschewismus wehren, mit den verzweifelsten Mitteln. Trotz geographischer und geistiger Blockade hat er aber eine Wirkung getan, die aus der Geschichte unserer Zeit nicht mehr wegzudenken ist. Die reiche deutsche Literatur des Mittelalters ist ohne den Einfluß der französischen Troubadoure (die heutige ohne Flaubert und Dostojewski), die englische Literatur ohne die Italiener, die italienische ohne den Einbruch des deutschen Blutes in Italien (Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen: der auch der erste Dichter in italienischer Sprache und vielleicht der Erfinder des Sonettes war), Goethe ohne die Antike nicht vorstellbar. Es gibt nur ein Volk, das, soweit uns bekannt, ohne den Einfluß anderer Kulturen zu seinen höchsten Leistungen kam: China. Selbst die Bibel wäre nichts ohne die indischen Mythen, die über Ägypten den Weg nach Jerusalem fanden. Und Christus wandelt in den Spuren Krischnas. Wir wollen unser geistiges Auge öffnen und es den Sonnenstrahlen der Kulturen darbieten. „Wir sind Deutsche,“ sagt einmal Hofmannsthal, „und unserer Sprache, die ja unser Schicksal ist, ist dies Merkmal gegeben, daß in ihr wie in keiner die geistigen Schöpfungen anderer Völker in ihrer Herrlichkeit wieder auferstehen und ihr eigenstes Wesen offenbaren können, wodurch wir als das Volk der Mitte und der Vermittlung auserlesen und beglaubigt sind.“
Urzeit Im Anfang war das Wort
Inhaltsverzeichnis
Woher kommt die Sprache? Die alten Inder meinen, sie sei ein Geschenk der Götter. Die ersten Menschen haben nicht anders gesprochen, als Hunde bellen. Es gibt auch heute noch Menschen, die wie Hunde bellen: das Volk der Orang-Kubu, das in Sumatra lebt, von der übrigen Insel durch Gebirge und Sümpfe getrennt. Die Kubu haben eine Sprache, die ein paar Dutzend primitive Laute kennt. Sie haben keine Dichtung, denn sie kennen kein „Jenseits“. Sie haben keinerlei religiöse Vorstellungen. Sie wissen nichts vom Tod. Sie glauben an nichts. Sie haben keine Grabzeremonie, und wenn einer stirbt, dann lassen sie ihn liegen, wo er liegt. Die Dichtung der Völker beginnt mit der mündlichen, später schriftlichen Fixierung religiöser Vorstellungen. Die Schöpfung der Idee „Gott“ war die erste. Im Anfang war das Wort. Und das Wort schuf den Gott. Und Gott wurde das Wort. Die ältesten Dichtungen, die wir kennen: die ägyptischen, babylonischen, indischen Dichtungen: sind religiöse Dichtungen fetischistischer, mythologischer, ahnenkultlicher Art. Ihnen gesellten sich bald das Liebeslied und das Märchen. Glaube und Aberglaube sind die Eltern der Dichtung. Der Glaube wird zur Voraussetzung der Gestaltung.
Die Urmenschen kennen keine Sünde. Sie wissen nichts von Gut und Böse. Sie leben vor dem Sündenfall. Erst durch den Sündenfall, durch das Bewußtwerden von Gut und Böse, kam die Religion und in ihrem Gefolge die Dichtung in die Welt. Ein babylonisches Gedicht beginnt: „Die Sünde, die ich sündigte, kannte ich nicht.“ Die Erkenntnis der Polaritäten des Daseins schuf die Dichtung, die sich zu allen Zeiten zwischen den Polen Gott und Teufel, Tod und Leben, Mann und Frau bewegt. „Wahrheit läßt sich nur durch Erfassen der Gegensätze begreifen,“ sagt ein alter chinesischer Spruch. Diese Wahrheit sucht die Dichtung.
Es gibt Leute, die sich über die kühnen Bilder unserer jungen Dichter aufregen. Sie vergessen, daß die älteste Dichtung noch ungleich kühnere wagt. Daß in den Psalmen die Berge hüpfen, die Flüsse in die Hände schlagen und die Morgenröte Flügel bekommt. Wir leben in einer Zeit, die außer Rand und Band geriet, wir leben in einer ekstatischen Zeit, ähnlich der Urzeit der Dichtung oder der Zeit der jüdischen Psalmen. Wir leben in einer „ver-rückten“ Zeit, und damit ist mehr gesagt, als zuerst erscheinen mag. Denn das gemeinsame Kennzeichen aller ekstatischen Epochen ist der schizophrene Geisteszustand. Der assoziative Zusammenhang ist gespalten (Dadaismus, Futurismus). Wirklichkeit und Traum werden auseinandergehalten (Expressionismus). Raum und Zeit werden relativiert (Einstein). Bestimmte Vorstellungen wiederholen sich monoton wie der Refrain eines Gassenhauers (der religiöse Kommunismus!). Man vergleiche ein Bild von Paul Klee mit einer Negerund Irrenzeichnung. Die Verwandtschaft der drei ist überzeugend.
Wir leben in einer chaotischen, in einer romantischen Zeit, wie sie immer wieder über die Erde kommt, aus der Versuche zu einer neuen Klassik schon wie Tauben aus der Arche Noah aufsteigen.
Indien Indien ist der Menschheit Vaterland
Inhaltsverzeichnis
Indien ist der heutigen Menschheit Mutterund Vaterland. Vom ihm stammen die Grundlagen aller westlichen Kulturen: die Mythologie und die Sprache. Die alten Griechen, in ihrer formalen Begabung zu Recht so hoch geschätzt, sind nur die Mittler der Ideen, die zuerst in Indien auftauchten. Aus dem indischen Harakala wurde Herkules, aus Thasaa Theseus, aus Dyaus Zeus, aus Manu Minos und so fort. Die Ilias ist eine Variation der Ramayana, des indischen Heldengedichtes, das die Kriegsfahrt Ramas gegen den König Ravasa von Ceylon verherrlicht, der ihm seine Frau Sita entführt hatte. (Der Sage nach 7500 v.Chr.) In den Veden finden sich astronomische Zeitangaben, die bis etwa 14 000 v. Chr. zurückgehen. Zu dieser Zeit gab es schon eine hochentwickelte Kultur, die unsere heutige Schein-Kultur vermutlich weit übertraf. Inder, die nach dem Westen und Norden zogen (vergleiche den Anfang des Kapitels Skandinavien), brachten ihre Sprache mit. In den Veden wird die Entstehung der Erde als ein Mythos geschildert, den Darwin im 19. Jahrhundert wissenschaftlich zu begründen trachtete.
Die Legenden und Dichtungen der Rigveda gehören zu den wunder-vollsten Dichtungen der Weltliteratur. Noch ist nichts abstrahiert: alle Vorstellungen sind konkret, plastisch. Idee und Bild sind eins. Gott zieht den Menschen zu sich empor wie einen Brunneneimer, er nimmt die Sünde von ihm wie den Strick vom Kalbe. Der Mensch sendet seine Gebete wie schwärmende Bienen. Man sieht: die Bilder sind dem engsten Vorstellungskreis der indischen Bauern entnommen. Die Sonne dreht sich wie ein Wagenrad. (Aus dem Zeichen der Sonne ist das ominöse Hakenkreuz entstanden.) Das zweite große Epos ist Mahabaratha. Karna ist der Held, eine Gestalt wie Siegfried und Achilleus. Die schönsten Episoden sind: Savitri, das Lied von der Gattentreue, und Nal und Damajanti, das Lied der durch dämonische Schuld des Gatten getrennten und wieder vereinigten Liebenden. In der Brautwerbung des Nal für einen Gott klingt das Tristanmotiv an. Auch das kleine Epos Bhagavad-Gita ist im Mahabaratha enthalten: das Lied des Gottmenschen Krischna.
Buddha wird 600 v. Chr. als Reinkarnation Krischnas wie ein Lichtstrahl empfangen. Er lehrt die alte Lehre, die der Kastengeist der Brahmanen geschändet hatte. Immer wieder muß Gottes Sohn Gott gegen seine eigenen Priester zu neuem Leben erwecken. Die Lieder der buddhistischen Mönche und Nonnen enthalten das Wichtigste der indischen Gedankenlyrik, die nicht von Individuen, sondern von der Gemeinschaft gedichtet scheint. Im Suttapitaka finden sich die prosaischen, im Suttanipata die hymnischen Reden des Meisters. Sprüche tiefster Weisheit enthält der „Pfad der Wahrheit“ (Dhaumapada). Pantschatanira ist das älteste der indischen Märchenbücher. Es ist die Quelle zahlloser Nachahmungen bei allen Völkern. Boccaccio hat es so gut benutzt wie Shakespeare, Goethe wie Lafontaine. Somadewa läßt im 12. Jahrhundert das „Meer der Märchenströme“ wallen. Indiens größter Dichter ist Kalidasa (5. Jahrhundert n. Chr.), der Dichter der „Jahreszeiten“, des „Wolkenboten“, der im Epos, im Drama, in der Lyrik sich gleicherweise hervortat. Goethe sagt von seinem Drama „Sakuntala“:
Willst du den Himmel, die Erde mit einem Namen begreifen, Nenn ich Sakontala dir, und so ist alles gesagt.
In den „Jahreszeiten“ ist die tropische Glut Indiens wie in einen Brennspiegel gefaßt. Im 12. Jahrhundert dichtet Jajad e wa die Gitagovinda: Gott Krischna liebt als Hirt die Hirtin Radha. Die sinnliche Leidenschaft wird, wie in den katholischen Marienliedern, zum religiösen Hymnus, der Sexus zum Eros, der Eros zum Theos gesteigert. Das Drama setzen im 8. Jahrhundert der Brahmane Bhava but i („Malati und Madhava“) und der König Sudrak a („Das Tonwägelchen“ oder Vasantasena) fort. Die Gattung der in Indien sehr beliebten allegorischen Dramen vertritt Krischna Misra (11. Jahrhundert) in seinem „Mondaufgang der Erkenntnis“. Die Figuren der Handlung sind Abstrakte: Heuchelei, Wollust, Ruhe, Mitleid, Erkenntnis. Der strenge indische Kastengeist schafft sich ein Ventil in satirischen Possen und Komödien, die Könige und Priester verspotten. In der „Versammlung der Strolche“ raufen sich zwei niedere Mönche um eine Dirne. Sie bitten einen Brahmanen zum Schiedsrichter, der, salomonisch, das hübsche Mädchen sich selber zuspricht…
Im 20. Jahrhundert wird die westliche Welt durch Verleihung des Nobelpreises an Rabindranath Tagore wieder auf die indische Dichtung hingewiesen. Tagore gründet eine Akademie „Die Stimme der Wälder“ und lehrt die jungen Inder sein wie er selbst: sanft, leise, gütig. Er schreibt aus der Tradition seines Volkes kleine und große Dichtungen, die nichts Besonderes, sondern nur Indisch-Typisches darstellen und nur dem an indische Symbolik nicht gewöhnten Europäer unerhört klingen. Es wäre zu begrüßen, wenn die Tagoremode den Europäer zu den großen indischen Büchern: zu den Veden, Mahabaratha, den Dichtungen Kalidasa’s, den Legenden um Buddha führte. Tagore wie die übrigen heutigen indischen Dichter wollen die politische und soziale Freiheit ihres Volkes. Aber der Unterschied zwischen ihrer Art zu revoltieren, und der europäischen, bezeichnet zugleich den Unterschied zwischen östlicher und westlicher Seele. Die Inder schaffen in s ich eine neue Weltordnung und Weltanschauung, die Europäer außer sich. Der Europäer will den anderen überreden, bekehren – geht’s anders nicht: mit Gewalt. Der Inder bietet nur ein Beispiel. Und dieses Beispiel wirkt. Der Europäer kennt nur die Propaganda der Tat, der Inder die des Seins. Der bengalische Dramatiker der Gegenwart ist Dwijendral al Roy. Die indische Revolution von 1905 fand ihren Schilderer in Satyen dra Nath Datta. Sie ging zurück auf Gandi, den sein Volk den Heiligen nennt. Er ist Führer der indischen revolutionären Bewegung. Er verpönt jede Gewalt; seine Waffe ist der passive Widerstand, und seine Erfolge sind nicht gering. Es gelang ihm, die Aufhebung der Ausnahmegesetze gegen die Inder in Südafrika durchzusetzen. Er organisierte den Boykott der englischen Verwaltung 1905. Und heute spricht er die Worte, die Deutschland, das in den Ketten der Entente liegt, trösten und auf den rechten Weg weisen können, der einzig zum wahren Frieden führt.
„Wir müssen unseren Kampf mit reinen Waffen führen, Bosheit durch Güte, Lüge durch Wahrheit besiegen. Der List müssen wir mit Offenheit, der Gewalt mit Geduld begegnen.“ Dies fordert Gandi, nicht weil Indien schwach, sondern weil es stark ist.
Assyrien und Babylon Gilgamesch, wohin läufst du? Dem unbekannten Gott
Inhaltsverzeichnis
Das Stromland des Euphrat und Tigris wurde einst die Wiege der babylonisch-assyrischen Kultur. Die Gegend war feucht und sumpfig, Papyrus oder Pergament verfielen sofort der Verfaulung und Verwesung. Deshalb gruben die Babylonier ihre Dichtungen mittels Keilschrift in Stein. Eine solche Tontafelbibliothek besaß der König Assurbanipal (650 v.Chr.), deren Auffindung in Ninive uns die Hauptdokumente der babylonisch-assyrischen Dichtung vermittelte, leider nur in Fragmenten. Eines der ältesten ist das gewaltige Gilgamesch-Epos. „Alles sah er, der Herr des Lande“, beginnt es. Er brachte Kunde aus der Zeit vor der großen Sturmflut. (Die Geschichte der Sintflut, die Utnapischtim erzählt, hat die Bibel übernommen.) „In Keilen ließ schreiben der Dulder (wer denkt hier nicht an den Dulder Odysseus) die ganze Mühsal.“ Gilg, genannt der Weh-froh, ist der Held: zu zwei Dritteln Gott, zu einem Drittel Mensch, wie alle Heroen des Epos. Enkidu ist sein Genosse, den er sich im Kampf erobert. Es herrscht eine mystisch-erotische Liebe zwischen ihnen wie zwischen Achilleus und Patroklus. Sie bekämpfen gemeinsam Chumbaba, den Hüter der heiligen Zeder, der Krallen wie Geier hat und Hörner wie ein Wildstier. (Aus der heiligen Zeder wurde bei den Germanen die Weltesche, aus Chumbaba der Drache.) Weiter ziehen Gilg und Enkidu nach Vernichtung des Drachen. Schamasch, der Sonnengott, den Gilgamesch in einer Schale aus Lapislazuli Butter trinken läßt, strahlt zu ihm hernieder: „Gilgamesch, wohin läufst du? Das Leben, das du suchst, findest du nicht!“ Aber die Freunde ziehen weiter und erblicken den Weltberg, Wohnsitz der Götter. Istar, die Göttin der Liebe, entbrennt in Lust zu Gilgamesch. Der aber verwünscht sie. Da fordert sie ihre Eltern Anu und Antu auf, sie zu rächen. Die senden den Himmelsstier, den Gilg tötet. Enkidu stirbt im Fieber. Gilgamesch kommt zu den Skorpionmenschen. Durch lauter Weh führt sein Weg, bis er den Park der Götter, das Paradies, erreicht, wo Schamasch ihn zu Göttin Siduri weist, die ihm den „Pfad zum Fernen“ zeigen wird, über das Meer, über die Wasser des Todes. Er gelangt in seine Heimat zurück, aber Ruhe findet er nicht. Er beschwört Enkidus Geist aus der Unterwelt, das Gesetz der Erde zu künden und ihm den Frieden der Seele zu geben. Enkidu, der Schatten, lächelt traurig. „Ich kann es nicht sagen. Kündete ich dir das Gesetz der Erde, die ich schaute, du würdest dich hinsetzen und weinen…“
Da kehrt Gilgamesch in seinen Palast zurück und legt sich nieder zum Sterben. – Eine erhabene Melancholie tönt aus dem Ende des Liedes. Kampf und Trotz und Liebe und ewige Wanderung und wildes Ringen um den „Sinn“ des Lebens: es ist alles vergebens…Den Helden fressen die Würmer „wie ein altes Hemd“. Er sinkt wie Staub in den Staub.
Die Lyrik der Babylonier und Assyrer erschöpft sich in Hymnen an den Sonnengott Schamasch, den Mondgott Siu, den Wettergott Adad und den Gott des Blühens und Werdens, den Frühlingsgott Tamuz. Beim Aufleuchten Sius jauchzen die Sterne, freut sich die Nacht. Ein hehres Linnen legt er an. In der glänzenden Barke des Himmels fährt er dahin. Um den Tod des Tamuz werden Klagehymnen gesungen, die die Adonis-Klagen der Griechen vorwegnehmen.
Diese Klage ist um das Feld, worauf Korn und Kraut nicht mehr wächst.
Diese Klage ist um den Teich, worin die Fische nicht mehr glänzen, Diese Klage ist um die Wälder, worin Tamarisken nicht mehr wachsen.
Die Babylonier zuerst prägen den Begriff der „Sünde“. In erschütternden Psalmen flehen sie „den unbekannten Gott“ um Gnade für begangene Missetaten an, die er wie Spreu im Winde entführen solle. Aber den Samen des Guten möge er auf ewig in ihre Herzen senken. Und ihre Schlechtigkeit möge er zerreißen wie ein altes Kleid, das zum Tragen nicht mehr nütze, und ihnen den goldenen Mantel seiner Gnade umhängen.