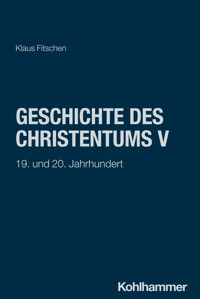
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das "lange 19. Jahrhundert" & vom Beginn der Französischen Revolution bis zum Ende des 1. Weltkrieges - kann auch in kirchenhistorischer Perspektive als eine Epoche wahrgenommen werden, in der Brüche wie Neuaufbrüche, Traditionsorientierungen wie Modernisierungen zu verzeichnen sind. Das "kurze 20. Jahrhundert" - geprägt von den Folgen zweier Weltkriege und faschistischer wie kommunistischer Diktaturen - stellte die Kirchen vor neue Herausforderungen, nicht zuletzt die der Säkularisierung. Es war jedoch in gleicher Weise geprägt von einer ökumenischen Annäherung der Konfessionen, von einer intensiven Vergangenheitsbewältigung der Kirchen und von ihrer Teilnahme am demokratischen Neuaufbau. Das Studienbuch legt den Fokus auf die Entwicklungen im deutschsprachigen Protestantismus dieser Jahrhunderte, eingebettet in seine ökumenischen Verflechtungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theologische Wissenschaft
Sammelwerk für Studium und Beruf
Herausgegeben von:
Traugott Jähnichen
Adolf Martin Ritter †
Udo Rüterswörden
Ulrich Schwab
Loren T. Stuckenbruck
Band 8,3
Klaus Fitschen
Geschichte des Christentums V
19. und 20. Jahrhundert
Verlag W. Kohlhammer
1. Auflage 2026
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-031534-1
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-031535-8
epub: ISBN 978-3-17-031536-5
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Cover
Vorwort
Teil I: Das 19. Jahrhundert
1 Das »lange« 19. Jahrhundert: zeitliche Abgrenzung und Charakteristik der Epoche
2 Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 und die territoriale Umgestaltung Deutschlands
3 Die Erneuerung der Staatskirchenhoheit
4 Theologie und Frömmigkeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
5 Das Aufbrechen des Bündnisses von Staat, Kirche, Religion und Gesellschaft
6 Kirche und Religion in der Revolution von 1848/49
7 Neue Ansätze in Kirche und Theologie nach 1848
8 Theologie und Kirchen im Deutschen Kaiserreich
9 Der Protestantismus im Spannungsfeld des modernen Pluralismus
10 Antisemitismus und Christentum
11 Soziale Frage und Innere Mission
12 Europäische Entwicklungen im 19. Jahrhundert
13 Ökumene und Mission
14 Die Kirchen und der Erste Weltkrieg
Teil II: Das 20. Jahrhundert
Vorbemerkung
15 Das Ende des I. Weltkriegs und die Folgen für das Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland
16 Staat und Kirche in der Weimarer Republik
17 Die staatliche Neuordnung Europas und ihre Folgen für die Kirchen
18 Theologische Entwicklungen
19 Außerkirchliche religiöse Strömungen
20 Die Kirchen im Nationalsozialismus
21 Die Jahre 1945–1949
22 Die Kirche in den beiden deutschen Staaten bis zum Mauerbau
23 Abbrüche und Umbrüche: die langen 1960er Jahre
24 Die katholische Kirche vor und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
25 Die 1970er Jahre
26 Kirche, Friedens- und Bürgerbewegungen
27 Die Kirchen und das Ende der DDR: eine offene Frage
28 Die kirchliche Wiedervereinigung
29 Theologische Aufbrüche nach dem II. Weltkrieg
30 Ökumenische Entwicklungen im 20. Jahrhundert
Anhang
Stichwortverzeichnis
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Register
Vorwort
Jede Gesamtdarstellung zu einer kirchengeschichtlichen Epoche muss defizitär sein. Schon ganz selbstkritisch würde man die hier vorliegende Darstellung zum 19. und 20. Jahrhundert für zu zentriert auf die deutsche Kirchengeschichte halten, für zu sehr auf den Protestantismus fokussiert, für zu wenig bezogen auf den politischen und gesellschaftlichen Kontext, für zu wenig ausgreifend auf die Entwicklungen seit den 1990er Jahren.
Pragmatisch gesehen ist diese Darstellung, die ja ein „Studienbuch“ sein soll, hervorgegangen aus Vorlesungen, die ich seit rund 20 Jahren regelmäßig für Studierende der Evangelischen Theologie in Leipzig halte, und so ist sie auch zuerst gedacht für Studierende, natürlich auch für solche an anderen Theologischen Fakultäten, an denen wohl das 19. Jahrhundert, weniger aber das 20. in der Lehre eine Rolle spielt. Es ist ein Leipziger Spezifikum, dass im Vorlesungsturnus jeweils ein Semester für das 19. und ein Semester für das 20. Jahrhundert vorgesehen sind – ein Privileg, das durch den Schwerpunkt Kirchliche Zeitgeschichte am Leipziger Institut für Kirchengeschichte gegeben ist und das hoffentlich erhalten bleibt.
Über den engeren Kreis der Theologiestudierenden hinaus ist die Darstellung aber auch gedacht für Studierende der Geschichtswissenschaft und nicht zuletzt – dem Konzept der Reihe entsprechend – für jene, die schon in der beruflichen Praxis stehen, vor allem in Kirche und Schule. Als ich begann, diese Vorlesungen zu halten, schien vieles noch selbstverständlich in Kirche und Politik. Spätestens seit dem Reformationsjubiläum 2017 hat sich dies erheblich verändert. Gerade deshalb soll diese Darstellung Orientierungswissen bieten, nicht zuletzt da, wo es um die Kirche und die beiden deutschen Diktaturen geht.
Angereichert worden sind diese Vorlesungen durch die Ergebnisse eigener Forschungen für Aufsätze und Vorträge, vor allem aber durch den Ertrag von Seminaren zu einzelnen Themen der neuzeitlichen Kirchengeschichte. So bestand die Herausforderung darin, einerseits den Hauptlinien zu folgen, andererseits auch Schwerpunkte der geschichtlichen Entwicklung besonders zu beachten, die aber vielleicht nur aus ganz eigenen wissenschaftlichen Interessen hervorgingen. Durch die selbst gesetzte Vorgabe, den Stoff der Vorlesung in einem Semester abzuhandeln, und durch die Zeichenvorgabe des Verlages (der der selbst gesetzten Vorgabe ziemlich genau entsprach) sind der Darstellung räumliche und somit inhaltliche Grenzen gesetzt gewesen. Die Kunst – wenn es denn eine ist – bestand darin, die Fülle des kirchengeschichtlichen Stoffs so zu komprimieren, dass die Darstellung lesbar bleibt, Schwerpunkte kenntlich macht und erkennen lässt, dass Kirchengeschichte keine weltfremde Sondergeschichte ist, nur weil sie unter dem Dach der Theologie betrieben wird.
Die Lehrpraxis hat es mit sich gebracht, dass der konfessionelle Standort des Verfassers unübersehbar ist. Ausflüge in die katholische Kirchengeschichte sind auf das Nötigste beschränkt worden, Ausflüge in die Geschichte der Freikirchen kaum zu finden. Hier spiegelt sich das eigene Bemühen einer interkonfessionellen Perspektive gerade nicht wider, das sich über all die Jahre eigentlich nur in Publikationen verwirklichen ließ.
Der historisch-politische Kontext konnte nur ansatzweise in die Darstellung einbezogen werden, ganz anders, als es meinem Rat für Dissertationsprojekte entspricht, diesen Kontext nie außer Acht zu lassen. Gerade im Blick auf die Kirchliche Zeitgeschichte ist dieser Rat zu beherzigen, solange die Kirchengeschichte auch in einer Zeit dynamischer Säkularisierung noch Teil einer gesellschaftlichen und politischen Gesamtgeschichte ist. Vielleicht ist erkennbar, dass das Verhältnis von Staat und Kirche einen Schwerpunkt der Darstellung bildet.
Zu den Vorlesungen gehörte am Schluss immer auch ein großes Kapitel zur weltweiten Ökumene. Die häufige Frage „Müssen wir das auch lernen?“ forderte zu einer Antwort heraus, die deutlich zu machen versuchte, dass die Welt des Christentums nicht da endet, wo der Blick vom eigenen Kirchturm gerade noch hinreicht.
Die in den Text integrierten Quellenverweise sollen dazu anregen, der Sache an der einen oder anderen Stelle weiter auf den Grund zu gehen. Auch sie haben ihren Ursprung in der Lehrpraxis.
Dass die Darstellung der deutschen Kirchengeschichte mit der kirchlichen Wiedervereinigung von EKD und Kirchenbund der DDR endet, ist Teil des Pragmatismus des Lehrbetriebs. Seither sind über 30 Jahre vergangen, die gezeigt haben, dass diese kirchliche Wiedervereinigung – jedenfalls aus ostdeutscher Perspektive – an vielen Stellen nicht gelungen ist. Allerdings ist die Transformationsgeschichte der 1990er Jahre bisher auch nur ansatzweise erforscht, zumal im Blick auf die Kirchengeschichte. Andere werden aus größerem Abstand einmal darüber schreiben können.
Leipzig, im September 2025
Klaus Fitschen
Teil I: Das 19. Jahrhundert
Quellensammlungen
Manfred Baumotte, Die Frage nach dem historischen Jesus. Texte aus drei Jahrhunderten, Gütersloh 1984 [Baumotte]. – Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und Lehrentscheidungen (Hg. Peter Hünermann), zuletzt Freiburg 2017 [DH]. – Ernst Rudolf Huber / Wolfgang Huber, Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert. Dokumente zur Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts, Bd. I–III, Berlin 1973; 1976; 1983 [Huber/Huber]. – Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen, Bd. IV (Vom Konfessionalismus zur Moderne, Hg. Martin Greschat), [KTGQ IV], Göttingen 6. Aufl. 2021. – Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen, Bd. V (Das Zeitalter der Weltkriege und Revolutionen, Hg. Martin Greschat und Hans-Walter Krumwiede), Neukirchen 1999 [KTGQ V]. – Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen, Bd. VI (Außereuropäische Christentumsgeschichte, Hg. Klaus Koschorke, Frieder Ludwig und Manuel Delgado), Göttingen 2021 [KTGQ VI]. – Michael Weinrich (Hg.), Religionskritik in der Neuzeit. philosophische, soziologische und psychologische Texte, Gütersloh 1985 [Weinrich, Religionskritik]. – Michael Weinrich (Hg.), Theologiekritik in der Neuzeit. Theologische Texte aus dem 18. bis 20. Jahrhundert, Gütersloh 1988 [Weinrich, Theologiekritik].
Überblicksliteratur
Gerhard Besier, Kirche, Politik und Gesellschaft im 19. Jahrhundert, München 1998. – Gerhard Besier (Hg.), Religion, Nation, Kultur. Die Geschichte der christlichen Kirchen in den gesellschaftlichen Umbrüchen des 19. Jahrhunderts, Neukirchen 1992. – Olaf Blaschke (Hg.), Konfessionen im Konflikt. Deutschland zwischen 1800 und 1970: ein zweites konfessionelles Zeitalter, Göttingen 2002. – Klaus Fitschen, Der Katholizismus 1648–1870 (KGE III/8), Leipzig 1997. – Martin Friedrich, Kirche im gesellschaftlichen Umbruch. Das 19. Jahrhundert, Göttingen 2006. – Heinrich Fries (Hg.), Katholische Theologen im 19. Jahrhundert, 3 Bde., München 1975. – Ulrich Gäbler (Hg.), Der Pietismus im 19. und 20. Jahrhundert (Geschichte des Pietismus, Bd. 3), Göttingen 2000. – Erwin Gatz, Die Katholische Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert, Freiburg 2009. – Johann F. Gerhard Goeters / Joachim Rogge (Hg.), Geschichte der Evangelischen Kirche der Union, Bd. I; II, Leipzig 1992; 1994. – Friedrich Wilhelm Graf (Hg.), Profile des neuzeitlichen Protestantismus, 2 Bde., Gütersloh 1990; 1993. – Leif Grane, Die Kirche im 19. Jahrhundert. Europäische Perspektiven, Göttingen 1987. – Martin Greschat, Gestalten der Kirchengeschichte, Bd. 9,1; 9,2; 10,1; 12, Stuttgart 1984. – Heinrich Hermelink, Das Christentum in der Menschheitsgeschichte. Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart, Bd. I–III, Tübingen/Stuttgart 1951; 1955; 1953. – Klaus Hock, Das Christentum in Afrika und dem Nahen Osten (KGE IV/7), Leipzig 2005. – Lucian Hölscher, Geschichte der protestantischen Frömmigkeit in Deutschland, München 2005. – Friedrich Huber, Das Christentum in Ost-, Süd- und Südostasien sowie Australien (KGE IV/8), Leipzig 2005. – Heinz Hürten, Kurze Geschichte des deutschen Katholizismus 1800–1960, Mainz 1986. – Hubert Jedin (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. VI,1.2, Freiburg 1971; 1973. – Martin H. Jung, Der Protestantismus in Deutschland von 1815 bis 1870 (KGE III/3), Leipzig 2000. – Martin H. Jung, Der Protestantismus in Deutschland von 1870 bis 1945 (KGE III/5), Leipzig 2002. – Hubert Kirchner, Das Papsttum und der deutsche Katholizismus 1870–1958 (KGE III/9), Leipzig 1992. – Eckhard Lessing, Geschichte der deutschsprachigen evangelischen Theologie von Albrecht Ritschl bis zur Gegenwart, Bd. 1 (1870 bis 1918), Göttingen 2000. – Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800–1866. Bürgerwelt und starker Staat, München, 6. Aufl. 1993. – Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918, Bd. I: Arbeitswelt und Bürgergeist / Bd. II: Machtstaat vor der Demokratie, München, 2. Aufl. 1993. – Mark A. Noll, Das Christentum in Nordamerika (KGE IV/5), Leipzig 2000. – Kurt Nowak, Geschichte des Christentums in Deutschland: Religion, Politik und Gesellschaft vom Ende der Aufklärung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, München 1995. – René Remond, Religion und Gesellschaft in Europa. Von 1789 bis zur Gegenwart, München 2000. – Jan Rohls, Protestantische Theologie der Neuzeit, Bd. 1 (Die Voraussetzungen und das 19. Jahrhundert), Tübingen 1997 (Studienausgabe 2018). – Wolfgang Schieder (Hg.), Religion und Gesellschaft im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1993. – Rudolf Schlögl, Alter Glaube und moderne Welt. Europäisches Christentum im Umbruch 1750–1850, Frankfurt a. M. 2013. – Franz Schnabel, Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, Bd. IV (Die religiösen Kräfte), Freiburg, 2. Aufl. 1951. – Manfred Weitlauff (Hg.), Kirche im 19. Jahrhundert, Regensburg 1998.
1Das »lange« 19. Jahrhundert: zeitliche Abgrenzung und Charakteristik der Epoche
Die Mittelachse des 19. Jahrhunderts wird von zwei Daten gebildet: Das Revolutionsjahr 1848/49 markiert den Durchbruch liberaler Kräfte, die auf eine Entflechtung von Staat und Kirche drängten und damit in Teilen der Kirchen Resonanz fanden. Das Jahr 1870/71 wiederum markiert die Manifestation des ultramontanen Katholizismus auf dem I. Vatikanischen Konzil und die Gründung des Deutschen Kaiserreiches mit den damit verbundenen Herausforderungen an die christlichen Kirchen. Die gelegentlich in den Raum gestellte »Sattelzeit« um 1850 oder 1870, die die Moderne einleitet, ließe sich also auch hier finden.
Die weltgeschichtlichen und innereuropäischen Erschütterungen, die von der Französischen Revolution ausgingen, hatten allenthalben ihre Auswirkungen auf die Kirche und die christliche Religion. Die alten Bündnisse zwischen Staat und Kirche waren in vielen Staaten inzwischen zerbrochen oder jedenfalls brüchig geworden. Die Selbstverständigung der gesellschaftlichen Eliten über den Stellenwert der Religion war seit der Aufklärung längst kontrovers geworden. Nun aber waren die politischen Voraussetzungen geschaffen, diese Kontroversen offen auszutragen: Sollten Religion und Kirche überhaupt noch zu den tragenden Fundamenten von Staat und Gesellschaft gehören? Und wenn ja: Wie ließe sich dies mit der Gewissensfreiheit und der Volkssouveränität vereinbaren, die – so schien es jedenfalls – mit kirchlichen und christlichen Ansprüchen unvereinbar waren? Allerdings lässt sich daraus nicht einfach folgern, Religion und Kirche hätten im 19. Jahrhundert kontinuierlich an Bedeutung verloren, auch wenn der Trend zur Säkularisierung eindeutig ist. Die Vielzahl von religiösen Aufbrüchen und kirchlichen Reformversuchen deutet aber darauf hin, dass sich innerhalb der Kirchen, vor allem aber an ihren Rändern, die verfestigten Strukturen der Frühen Neuzeit verflüssigten. Das Staatskirchentum, in dem der Staat entschieden den Stellenwert von Religion und Kirche nach dem Nützlichkeitsaspekt bestimmte, geriet zunehmend in eine Krise.
Insofern ist die Zeit des »langen« 19. Jahrhunderts von 1789 oder 1803 bis 1918 jedenfalls kirchengeschichtlich gesehen für Deutschland und Europa eine eigenständige Epoche, auch wenn unter sozial-, wirtschafts- oder globalgeschichtlichen Aspekten andere Einteilungen möglich sind. In dieser Zeitspanne bereiteten sich die Entwicklungen vor, die lange in Kirche, Theologie, Politik und Gesellschaft wirksam waren, bevor sie von einer massiven Säkularisierung in Frage gestellt wurden. Wendet man zudem den Blick gewissermaßen nach innen, also auf die Kirchen- und Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts, so fallen schon auf den ersten Blick einige Eigentümlichkeiten auf: Da ist die zum Teil scharf ausgeprägte konfessionelle Trennung. Sie ging einerseits einher mit der Neuformierung einer protestantischen Identität, die sich unter anderem der Neuentdeckung Martin Luthers verdankte, und andererseits mit der Neuformierung einer katholischen Identität, die in Vereinen und politischen Bewegungen neue Kraft gewann und ein katholisches Milieu formte. »Protestantisch« wurde in dieser Zeit ein populärer Begriff, da er Lutheraner, Reformierte und Unierte umfasste. Der im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts aufkommende Begriff »neuprotestantisch« wiederum verband sich mit einem nicht nur aus der Reformation, sondern aus Bildung und Aufklärung kommenden protestantischen Selbstbewusstsein. Das Luthertum begann andererseits, sich seiner eigenen Identität innerhalb des Protestantismus zu vergewissern. Trotz vieler Verfestigungen und einer – angesichts der Herausforderungen der Zeit – starken Neigung zum Konservativen, ist auf beiden Seiten der konfessionellen Grenze eine große Pluralität von Vorstellungen zu beobachten, gelegentlich sogar eine gewisse Experimentierfreude, die den Geist der Aufklärung lebendig hielt und den Kontakt zu den geistigen Entwicklungen der Zeit nicht zu verlieren versuchte. In kirchengeschichtlicher Hinsicht könnte man diese Zeit als eine Transformationsepoche ansehen, in der sich die Entwicklungen der Frühen Neuzeit intensivierten und auf die Gegenwart hin zuspitzten: Die Folgen der Aufklärung, der Ausdifferenzierung von Staat und Kirche, der Hinterfragung der Legitimität von politischer und kirchlicher Macht werden seit dieser Zeit deutlich sichtbar.
2Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 und die territoriale Umgestaltung Deutschlands
Ingo Knecht, Der Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803. Rechtmäßigkeit, Rechtswirksamkeit und verfassungsgeschichtliche Bedeutung, Berlin 2007.
Auf die kirchlichen Verhältnisse in Deutschland wirkten sich die Ereignisse in Frankreich mit einer gewissen Verzögerung aus. In den von Frankreich besetzten Gebieten sollte sich die revolutionäre Kirchenpolitik zwar ganz unmittelbar bemerkbar machen, doch war von wesentlich nachhaltigerer Bedeutung, dass die deutschen Fürsten und ihre Beamten die von Frankreich ausgehenden Impulse in ganz eigener Weise in konkrete Kirchenpolitik umsetzten und damit die politische und konfessionelle Landkarte Deutschlands entscheidend veränderten.
2.1Die revolutionäre und nachrevolutionäre Expansion Frankreichs
Die Französische Revolution hatte die alten Mächte Europas in Unruhe versetzt, und dies besonders in dem Moment, als der französische König Ludwig XVI. durch seine missglückte Flucht nach Varennes im Juni 1791 den Revolutionären den Gehorsam aufkündigte. Die Folge waren die »Koalitionskriege« der alten europäischen Mächte, allen voran Preußens und Österreichs, gegen das revolutionäre Frankreich. Unerwartet war der heftige Gegenschlag: Die französischen Truppen stießen nach Osten vor und besetzten das linke Rheinufer. Preußen, das zu dieser Zeit leichtere Beute durch die Teilungen Polens fand, gab seinen Kampf gegen Frankreich auf und suchte nach einem Sonderfrieden, der 1795 in Basel abgeschlossen wurde. In einer geheimen Zusatzklausel erklärte Preußen seine Neutralität und gab Frankreich links des Rheins freie Hand. Dafür wurde ihm erlaubt, sich mit französischer Rückendeckung rechts des Rheins für eigene Verluste am Niederrhein schadlos zu halten. Preußen bediente sich nun unter den schutzlosen rechtsrheinischen Kleinstaaten und gewann dabei wesentlich mehr als es links des Rheins verlor. Besonders einfach war dies bei den Besitzungen geistlicher Reichsfürsten, also den Territorien katholischer Bischöfe, Erzbischöfe und Reichsäbte. Das territoriale, politische und konfessionelle Gefüge des alten, auf das Mittelalter zurückgehenden Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation wurde so von innen her zerstört.
Dass dies der Fall war, zeigte sich nach 1795 noch deutlicher, als auch Österreich 1797 mit dem Frieden von Campo Formio den Kampf gegen Frankreich aufgab. Auch dieser Vertrag wurde um ein geheimes Zusatzprotokoll ergänzt. Darin wurde Österreich erlaubt, sich innerhalb des Reiches für die eigenen Gebietsverluste schadlos zu halten, so etwa durch die Einverleibung des Fürsterzbistums Salzburg.
Damit war nun endgültig klar, dass das alte Reichsgefüge sich auflösen würde und diegeistlichen Fürstentümer(vor allem die Kurfürst-Erzbistümer Köln, Mainz und Trier) dabei untergehen würden. Die Besetzung des linken Rheinufers hatte diese ohnehin schwer geschädigt und den größten Teil ihrer Territorien unter französische Herrschaft gebracht. Durch die weiteren französischen Erfolge unter Napoleon wurde die Lage für die deutschen Staaten immer dramatischer, doch hatte man der französischen Expansion wenig entgegenzusetzen. Bald gab es nicht mehr viel zu verhandeln; das Deutsche Reich musste 1801 in Lunéville in Lothringen mit Frankreich Frieden schließen (→ Huber/Huber I, 15). Der Lunéviller Vertrag verpflichtete das Deutsche Reich insgemein (»collectivement«), für die Entschädigung solcher Fürsten zu sorgen, die durch die Abtretung der linksrheinischen Gebiete Verluste erlitten hatten. Als Entschädigungsmasse waren dabei von französischer Seite aus vorwiegend die Besitzungen der geistlichen Fürsten eingeplant. Der Lunéviller Vertrag sah vor, dass dies durch weiterhin zu beschließende Regelungen in geordnete Bahnen gelenkt werden sollte – diese Regelungen machten dann den »Reichsdeputationshauptschluss« aus.
2.2Inhalt und Folgen des Reichsdeputationshauptschlusses
Die 1802 gebildete außerordentliche »Reichsdeputation«, d. h. ein Sonderausschuss des Reichstages, konnte diese Vorgänge mit ihrem »Hauptschluss«, also dem finalen Beschluss, nur noch besiegeln. So war der Reichsdeputationshauptschluss (→ KTGQ IV, 158f; Huber/Huber I, 18f) im Wesentlichen ein groß angelegter Entschädigungsplan, der aber weit über die Kompensation für den Verlust linksrheinischer Gebiete hinausging. Inzwischen war schon eine groß angelegte Säkularisation in Gang gekommen, da die geistlichen Fürstentümer teilweise besetzt und anderen Staaten einverleibt waren. Zugleich gingen diese größeren Staaten daran, sich kleinere weltliche Territorien einzugliedern. Durch diese »Mediatisierung« verlorenauch die meisten der ehrwürdigen Reichsstädte ihre Reichsunmittelbarkeit. Die Aufhebung der geistlichen Fürstentümer hatte sich schon lange vorbereitet: Man empfand sie als unmodern, und gewiss war auch die territoriale Zersplitterung Deutschlands nach dem Westfälischen Frieden im europäischen Vergleich ein Anachronismus. Die Protestanten betraf die Säkularisation der geistlichen Staaten nicht: In den evangelischen Gebieten Deutschlands hatte dieser Prozess schon in der Reformationszeit stattgefunden. Auf katholischer Seite wurde die Säkularisation von Territorienvon manchen auch als Befreiung empfunden: Bistümer waren nun keine Versorgungseinrichtungen für zweitgeborene Adelssöhne mehr. Vorläufig aber war die Säkularisation für die katholische Kirche ein ungeheurer Machtverlust: Die katholische Mehrheit unter den Reichsfürsten war dahin, und als 1806 Kaiser Franz II. die Kaiserwürde des Heiligen Römischen Reiches ablegte und sich auf die schon 1804 proklamierte österreichische zurückzog, war auch das katholische Kaisertum in Deutschland erloschen. Insgesamt veränderte der Reichsdeputationshauptschluss die Landkarte Deutschlands radikal: 112 geistliche und viele kleinere weltliche Territorien verschwanden.
Hinzu kam nun aber noch eine ganz andere Form der Säkularisation, die nicht die geistlichen Territorien, sondern den materiellen Besitz der Kirche betraf. Hier kamen jahrzehntelange Bemühungen zum Erfolg, das Kirchenvermögen zu kontrollieren und nach Belieben für staatliche Zwecke einzuziehen. So wurde durch § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses eine umfängliche Vermögenssäkularisation festgelegt. Behalten durften die Kirchen nur noch das Ortskirchenvermögen, das für die unmittelbaren Aufgaben in Gottesdienst, Seelsorge und Armenfürsorge notwendig war. Klöster, die der Kontemplation und nicht der tätigen Nächstenliebe dienten, oder Kirchen, die nicht unmittelbar gemeindlichen Zwecken gewidmet waren, schienen überflüssig. Von großer Bedeutung war § 63 des Reichsdeputationshauptschlusses, der auf die Gewährung von Religionsfreiheit zielte. Durch die Aufhebung der geistlichen und kleinerer weltlicher Staaten waren vielfach Katholiken unter die Herrschaft evangelischer oder Evangelische unter die Herrschaft katholischer Fürsten gekommen. Der Westfälische Friede hatte im Wesentlichen das Prinzip konfessioneller Geschlossenheit für die Territorien im Sinne des »cuius regio – eius religio«festgeschrieben. Nun war unübersehbar, dass für die konfessionelle Mischung in den neu zugeschnittenen deutschen Staaten eine Lösung gefunden werden musste.
Ein Vorreiter hierfür war Bayern: 1803 wurden allen Konfessionen in einem Religionsedikt die gleichen Rechte gewährt, und die Schließung gemischtkonfessioneller Ehen wurde erlaubt – dabei war der Protestantismus noch kurz zuvor im alten Bayern schlichtweg verboten gewesen. Den Kirchen und vor allem der katholischen Kirche wurde durch die Verfassung von 1808 und durch ein weiteres Religionsedikt aus dem Jahre 1809 eine strenge Staatsaufsicht auferlegt. Die durch die Säkularisation und die Mediatisierungen zu Bayern gekommenen evangelischen Bevölkerungsteile sollten integriert und vor der Dominanz der katholischen Kirche geschützt werden. Dabei musste der Protestantismus, der zuvor in einer Vielzahl von Kleinterritorien und Reichsstädten beheimatet war, in Bayern erst einmal zusammenwachsen; daran hatte eine neue, vom Staat verordnete Kirchenorganisation nicht unerheblichen Anteil. Der Eindruck eines dezidiert katholischen Bayern stellte sich erst später wieder ein: König Ludwig I. betrieb eine deutlich prokatholische Politik, die durch den von 1837–1847 amtierenden Innenminister Karl von Abel forciert wurde. Symbolisch dafür wurde die 1838 ergangene »Kniebeugungsordre«, die protestantische Soldaten am Fronleichnamsfest zwang, mit den katholischen Kameraden gemeinsam vor dem Allerheiligsten in die Knie zu gehen. Das Ringen des bayrischen Protestantismus um seine Integration wurde damit auf eine harte Probe gestellt, die er aber durch Proteste, Widerstand und publizistischen wie politischen Rückhalt bestand.
3Die Erneuerung der Staatskirchenhoheit
Michael Fischer, Religion, Nation, Krieg. Der Lutherchoral Ein feste Burg ist unser Gott zwischen Befreiungskriegen und Erstem Weltkrieg, Münster 2014. – Gerhard Graf: Gottesbild und Politik. Eine Studie zur Frömmigkeit in Preußen während der Befreiungskriege 1813–1815, Göttingen 1993. – Rudolf Mau (Hg.), Protestantismus in Preußen. Lebensbilder aus seiner Geschichte, Bd. II (Vom Unionsaufruf 1817 bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts), Leipzig 2009.
Mit Napoleons endgültiger Niederlage und Verbannung 1815 wurde der Weg zu einer territorialen Neuordnung Europas frei. Mit dem Ende der geistlichen Fürstentümer 1803, dem Ende des ›deutschen‹ Kaisertums und mit der Gründung des Rheinbundes 1806 war Deutschland ein Gefüge von weltlich regierten Monarchien geworden, unter denen Preußen und Bayern das größte Gewicht hatten. Dies wurde 1815 mit der Gründung des Deutschen Bundes festgeschrieben. Die Bundesakte (→ KTGQ IV, 178) garantierte den Angehörigen der großen christlichen Konfessionen Gleichheit vor dem Gesetz, überließ die Regelung des Verhältnisses von Staat und Kirche aber den Einzelstaaten.
Die »Heilige Allianz« (→ KTGQ IV, 178f), die eher ein unheiliges Bündnis zur Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten war, war ein Baustein der Außenpolitik des österreichischen Staatskanzlers Klemens Wenzel Fürst von Metternich. Sie wurde 1815 von den drei die antinapoleonische Koalition repräsentierenden europäischen Monarchen geschlossen: dem russischen Zaren, dem österreichischen Kaiser und dem preußischen König. Das Programm dieser Allianz war ein Bündnis im christlichen, überkonfessionellen Geist, denn hier gelobten ein orthodoxer, ein katholischer und ein protestantischer Monarch Brüderlichkeit und Frieden. Die Kehrseite der im Programm formulierten väterlichen Haltung gegenüber den Völkern war ihre Entmündigung. Als der Zerfall des Osmanischen Reiches Begehrlichkeiten bei den europäischen Mächten weckte, trafen die Interessen Russlands und Frankreichs schon bald aufeinander.
3.1Die Amalgamierung von Nation und Religion in der Festkultur
Im Zuge der territorialen Neuordnung Deutschlands und vor allem im Zuge der Befreiungskriege erwachte das deutsche Nationalbewusstsein, zu dessen Popularisierung eine eigene Festkultur beitragen sollte. Mit Gott war man in die Befreiungskriege gezogen, »mit Gott für König und Vaterland«, und es ließ sich in Predigten und Aufrufen sogar davon reden, dies sei ein Heiliger Krieg und man kämpfe für eine gerechte Sache. Andererseits hatte die hier massiv aufbrechende christliche Legitimation militärischer Gewalt eine nachdenkliche Seite gehabt. Dieser Krieg war auch eine Gelegenheit, zu Buße und Demut zu rufen, dazu eben, es dem Eroberer Napoleon nicht gleichzutun. Ernst Moritz Arndt, der in einem Gedicht die Völkerschlacht bei Leipzig 1813 besungen hatte, empfahl, den Gedenktag der Völkerschlacht zum nationalen Feiertag zu machen. So sollten in jedem Jahr am 18. und 19. Oktober umfängliche Feiern stattfinden, zu denen Umzüge, Gottesdienste und weltliche Festlichkeiten gehören sollten. Tatsächlich wurden Arndts Vorstellungen schon 1814 umgesetzt. Dabei hatten Pfarrer als Organisatoren, Prediger und Festredner eine wichtige Funktion.
Im Zusammenhang mit der in den Befreiungskriegen erstarkten deutschen Nationalbewegung bot sich Luther, schon angesichts des Jubiläumsjahres 1817, als Identifikationsfigur für das protestantische Deutschland an, allerdings nicht mit seiner Theologie, sondern als Freiheitskämpfer. So wurde er zum Bestandteil eines romantischen Geschichtsbildes: Die eine deutsche Nation unter einem Kaiser bedurfte wieder eines Reformators, der die Kirche erneuerte. Das allerdings, so die Meinung vieler, hatten die Katholiken nicht verstanden. Nun begann die Zeit der Luther-Denkmäler. Das Denkmal wurde im 19. Jahrhundert ohnehin zur Mode und durch die daran geknüpften Feierlichkeiten zu einer Art öffentlichem Altar. Nur kurz kam die Idee auf, das Reformationsfest zu einem überkonfessionellen Nationalfest zu machen. So schlug Goethe in einer Schrift zum Reformationstag 1817 vor, dieses Fest mit dem Gedenktag an die Völkerschlacht zusammenzulegen und ein überkonfessionelles Nationalfest zu etablieren.
Zum Reformationsjubiläum luden die Studenten der Jenaer Universität die Studenten anderer deutscher Universitäten zu einem Fest auf die Wartburg ein. Der Tag dieses Wartburgfestes war der 18. Oktober 1817, der vierte Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig. Hier manifestierte sich ein revolutionäres und zugleich typisch protestantisches Potential. Viele Studenten waren republikanisch gesonnen, und sie wollten in ihren Burschenschaften die Einheit Deutschlands darstellen. Schon die zeitliche Nähe zum Gedenktag des Thesenanschlags Luthers wies aber darauf hin, dass dies ein protestantisches Fest war – Studenten von Universitäten in katholischen deutschen Landen waren gar nicht eingeladen worden. Protestantische Choräle wie »Ein feste Burg ist unser Gott« und »Nun danket alle Gott« wurden gesungen.
Nachhaltige Wirkung hatte ein Feiertag, der 1816 von Friedrich Wilhelm III. zum Gedenken an die Gefallenen der Befreiungskriege eingeführt worden war. Er erhielt als »Totensonntag« oder später als »Ewigkeitssonntag« einen festen liturgischen Ort am Ende des Kirchenjahres. In oder bei den Kirchen wurden nun Denkmäler für die Gefallenen errichtet, denen später – mit immer längeren Namenslisten – die Namen der Gefallenen aus dem Krieg von 1870/71 und den Weltkriegen an die Seite gestellt wurden.
3.2Das Rechtsverhältnis von Staat und Kirche in ausgewählten deutschen Einzelstaaten
Die Stellung der Kirchen und der christlichen Religion war von der politischen Reorganisation unmittelbar betroffen. Eine Revision des Reichsdeputationshauptschlusses, wie sie von katholischen Kirchenvertretern auf dem Wiener Kongress vorgeschlagen worden war, stand nicht zur Debatte. Das landesherrliche Kirchenregiment kam in einer abgewandelten Form des aus dem Absolutismus ererbten Staatskirchentums zu neuem Leben. Gewiss war die Zeit des »Absolutismus« vorbei; die Fürsten waren gezwungen, wenigstens auf ihre Regierungen und Ständevertretungen zu hören, doch sahen sich die Monarchen immer noch nicht nur als Spitze des Staates, sondern auch der Kirche an, sei sie protestantisch oder katholisch. Dementsprechend blieben die Leitungen der evangelischen Landeskirchen Teil der Staatsverwaltung, und es blieb beim Anspruch der Staatskirchenhoheit. Dies konnte sein Gutes haben, da von staatlicher Seite aus häufig die Modernisierung der Kirche betrieben wurde. So war es ein Anliegen Friedrich Wilhelms III., den preußischen Pfarrern eine bessere praktische Vorbildung zu verschaffen – das Ergebnis war 1817 die Gründung des Predigerseminars Wittenberg auf königliches Geheiß.
Durch die Auflösung vieler geistlicher und weltlicher Kleinterritorien im Reichsdeputationshauptschluss und ihre Eingliederung in größere Staaten – wie Preußen, Baden, Württemberg oder Bayern – mussten auch die Kirchenverwaltungen auf der Ebene der Neugründungen organisiert werden. So entstanden die Grenzen der neuen evangelischen Landeskirchen. Die katholische Kirche sollte nach dem gleichen Muster in die Staatsgrenzen eingepasst werden. Ein dringendes Anliegen der katholischen Seite war die Neubesetzung der inzwischen zum größten Teil vakanten deutschen Bistümer. Während der Protestantismus vorläufig fest in den Staatsaufbau integriert blieb, stellte sich für die katholische Kirche nach der Säkularisation und dem Ende der geistlichenFürstentümer die Frage nach einer Neubeschreibung des Verhältnisses zum Staat. Das mit Napoleon 1801 abgeschlossene Konkordat (→ KTGQ IV, 156–158; Huber/Huber I, 12–14) war dabei ein wichtiges Vorbild, und dem Heiligen Stuhl kam als Vertragspartner nun eine wichtige Rolle zu. Ein Reichskonkordat lag angesichts der unterschiedlichen Interessen der deutschen Einzelstaaten aber in weiter Ferne. Konkordate als Vereinbarungen zwischen Staat und Kirche konnten zu dieser Zeit nur von katholisch dominierten Staaten abgeschlossen werden, da man sich in protestantischen Territorien mit dem Kirchenstaat nicht auf eine gemeinsame Rechtsebene begeben wollte, eine Zurückhaltung, die auf Gegenseitigkeit beruhte. So wurde vorläufig nur ein einziges Konkordat abgeschlossen, nämlich mit Bayern. Die Lösung war ansonsten eine von Rom aus erlassene Verfügung, die zuvor mit den deutschen Vertragspartnern ausgehandelt worden war und dann von Seiten des Staates per Gesetz in Kraft gesetzt werden musste. Die päpstlichen Verfügungen hatten die Form einer Bulle und waren dem Inhalt nach primär eine »Zirkumskriptionsbulle«, in der es um den neuen Zuschnitt katholischer Bistümer, also ihre Zirkumskription, und um ihre Neubesetzung ging. Das Ziel war, die Bistumsgrenzen den neuen Landesgrenzen anzupassen. Die wichtigste Bulle dieser Art ist die 1821 für Preußen erlassene »De salute animarum« (→ Huber/Huber I, 204–221). Das 1801 unter französischer Herrschaft aufgehobene Erzbistum Köln wurde nun wiedererrichtet. In jeder Diözese sollte ein Priesterseminar gegründet werden. Die Seminare sollten wie die Erzbischöfe, Bischöfe, Domkapitel und Weihbischöfe eine staatliche Dotation erhalten.
Wo es nicht zu einvernehmlichen Regelungen kam, griffen die protestantisch regierten Staaten zu einseitigen Gesetzen. Ein besonders markantes Beispiel dafür ist die »Frankfurter Kirchenpragmatik« von 1820 (→ Huber/Huber I, 258–264), die von einigen südwestdeutschen Staaten verabschiedet wurde.Sie hatten sich zusammengetan, um Rom gegenüber mehr Verhandlungsmacht in die Waagschale zu werfen. Adressatin war die katholische Kirche mit den Bistümern Rottenburg, Freiburg, Mainz, Fulda und Limburg, die die »Oberrheinische Kirchenprovinz« bildeten. Das Plazet – d. h. der staatliche Genehmigungsvorbehalt für kirchliche Verlautbarungen, ebenso der »recursus ab abusu« – das Recht, bei einer Maßregelung durch geistliche Gerichte an weltliche zu appellieren –, und die staatliche Aufsicht über die Priesterausbildung wurden hier festgeschrieben. Die Frankfurter Kirchenpragmatik war die Antwort auf einen Versuch der römischen Kurie, die anstehenden Fragen durch einen einseitigen Vorstoß mit einer Zirkumskriptionsbulle (»Provida solersque«) zu regeln (→ Huber/Huber I, 246–257).
Wie das Verhältnis zwischen den Konfessionen die staatliche Kirchenpolitik bestimmte, zeigen die rechtlichen Regelungen in Sachsen, auch wenn die Probleme hier schon älter waren. Die besondere konfessionelle Konstellation forderte nach den Umbrüchen um die Jahrhundertwende eine Neuausrichtung der Innenpolitik hin auf die Gewährung von Parität. Die Konversion Augusts des Starken 1697 und somit die Etablierung eines katholischen Herrscherhauses hatte keine Katholisierung des Landes mehr mit sich gebracht. Die Katholiken erhielten sogar erst 1807 das Recht auf öffentliche Religionsausübung. Der mehrheitlich lutherische Konfessionsstand der Bevölkerung führte zu einer weiterhin vorsichtigen Politik: So kam es in Sachsen zu keinem Konkordat, sondern 1827 nur zu einer einseitigen Regelung, einem Mandat (→ Huber/Huber I, 152–155).Die sächsische Verfassung von 1831 (→ Huber/Huber I, 155f) gewährte völlige Gewissensfreiheit, gestand aber das Recht auf öffentliche Religionsausübung nur den drei christlichen Hauptkonfessionen zu, also Lutheranern, Reformierten und Katholiken. Der König nahm das oberste Aufsichtsrecht über die Kirchendinge in Anspruch und delegierte zugleich die Aufsicht über die evangelische Kirche an evangelische Minister (»Ministri in evangelicis«) in der Regierung. Die katholischen Angelegenheiten wurden durch ein katholisches Konsistorium verwaltet, dem ein im Einvernehmen mit dem König bestellter Apostolischer Vikar zur Seite stand.
Die in Bayern schon 1803 garantierte Gleichberechtigung der Konfessionen überschnitt sich mit dem Bestreben, mit der katholischen Kirche in ein geregeltes Rechtsverhältnis einzutreten. Das Vorbild war das Konkordat Napoleons von 1801, und so begann die bayrische Regierung 1806 mit Verhandlungen in Rom. Die politischen Umstände der napoleonischen Zeit verhinderten aber eine Umsetzung der Pläne. Nach dem Wiener Kongress wurden die Konkordatsverhandlungen wieder aufgenommen. Das Ziel war die Etablierung einer katholischen Landeskirche in den Grenzen des neuen bayrischen Staates. Auch diese Verhandlungen schienen nicht zum Ziel zu kommen, da man von römischer Seite aus die Toleranzpolitik gegenüber den Protestanten nicht akzeptierte. Der Abschluss des Konkordates kam umso überraschender. Obwohl von München aus noch im Mai 1817 in einer Instruktion an den bayrischen Gesandten, Kardinal Johann Casimir von Haeffelin, die Grundlinien der staatskirchlichen Politik bekräftigt worden waren, unterzeichnete dieser im Juni einen Konkordatstext, der der Tendenz nach die römischen Ansprüche stützte. Aus München kam scharfe Kritik, doch waren die Verhandlungen schon zu weit gediehen. Nachträglich konnte nur noch ein Artikel – der IX. – in das Konkordat aufgenommen werden, dem zufolge dem König das Nominationsrecht für die bayrischen Bistümer zukam.
Das Konkordat (→ Huber/Huber I, 170–177) enthielt insgesamt also einige für die katholische Kirche sehr günstige Regelungen. Im I. Artikel wurde die Fiktion festgeschrieben, Bayern sei nach wie vor ein katholisches Land. Weiterhin wurden die Diözesen den Landesgrenzen angepasst. Die Bistümer wurden mit großzügigen staatlichen Dotationen ausgestattet, was der Intention des Reichsdeputationshauptschlusses entsprach. Die Oberaufsicht über die Priesterseminare lag bei den Bischöfen, und somit war die Klerikerausbildung in kirchlicher Hand und nicht staatlich kontrolliert. Die Wiederansiedlung von Orden wurde in Aussicht gestellt, allerdings nur von solchen, die für das Erziehungswesen, die Krankenpflege oder die Seelsorge nützlich waren. Dazu kam es tatsächlich, aber erst seit 1830, unter König Ludwig I. Der Besitz der Kirche wurde garantiert und ihr das Recht auf weiteren Zuerwerb verliehen. Die freie Kommunikation mit Rom in kirchlichen Fragen wurde erlaubt; das Plazet war also in diesen Dingen aufgehoben.
Von bayrischer Seite aus wurde das Konkordat erst 1818 veröffentlicht, und zwar als Anhang einer neuen Verfassung zusammen mit einem Religionsedikt, also einem einseitigen staatlichen Gesetz (→ Huber/Huber I, 127–139). Darin lag eine Parallele zum Konkordat Napoleons und den kurz darauf erlassenen »Organischen Artikeln«. Die Verfassung und das Religionsedikt entwerteten den I. Artikel des Konkordates: Von Vorrechten der katholischen Konfession war in Verfassung und Religionsedikt keine Rede mehr, stattdessen galten Toleranz und Gleichberechtigung der Konfessionen. Ebenso wurde das Plazet wieder eingeführt, weiterhin der »recursus ab abusu«. Die geistliche Gerichtsbarkeit, die im Konkordat ausdrücklich auch für Ehesachen festgehalten worden war, wurde nun wieder eingeschränkt. So zeigte das Religionsedikt sehr deutlich die Grundlinien eines neuen Staatskirchentums, die zu dieser Zeit nicht nur in Bayern, sondern in allen deutschen Staaten gültig waren. Auf die Verfassung und das Religionsedikt folgte eine tiefe Verstimmung zwischen Rom und München, die erst 1821 durch die »Tegernseer Erklärung« des Königs behoben werden konnte (→ Huber/Huber I, 196). Hierin wurde bekundet, dass der von den Geistlichen geforderte Eid auf die Verfassung sich nur auf die in ihr geregelten »bürgerlichen Verhältnisse« beziehe und nicht auf Religionsfragen. In widersprüchlichen Fragen sollte das Konkordat den Vorrang vor dem Religionsedikt haben.
3.3Die Unionen in Preußen und Baden
Im Zuge der preußischen Reformen wurde 1808 auch die Kirchenverwaltung neu organisiert. Die Aufsicht über die reformierte, die lutherische und die katholische Kirche wie die Aufsicht über das Schulwesen wurden einer Abteilung für den Kultus und den öffentlichen Unterricht im Innenministerium eingegliedert. 1817 wurde diese Abteilung in ein eigenes Kultusministerium umgewandelt. Die älteren staatlichen Organe der Kirchenverwaltung wurden ebenso aufgehoben wie die in den reformierten Gebieten der neuen preußischen Provinzen im Westen bestehende synodale Selbstverwaltung. Zugleich wuchsen die Bestrebungen, die konfessionelle Spaltung wenigstens unter den Protestanten aufzuheben. Die Vereinheitlichung der Kirchenverwaltung war ein erster Schritt dahin. Zwar waren von rund 10 Millionen Preußen nur 385.000 reformiert, aber 5,73 Millionen lutherisch (und 3,9 Millionen katholisch), doch war das Herrscherhaus reformiert, und die Zeit für eine Überwindung der innerprotestantischen Kirchenspaltung schien gekommen. Auch andere Staaten hatten ein Interesse daran, konfessionelle Auseinandersetzungen zu vermeiden, nachdem Aufklärung und Pietismus schon die Lehrdifferenzen zwischen den Konfessionen zugunsten von Vernunft und Ethik auf der einen, Frömmigkeit auf der anderen Seite heruntergespielt hatten. Trotz aller schon erkannten Gemeinsamkeiten zwischen den beiden evangelischen Konfessionen stellte sich aber die Frage, wie sich diese Vereinigung konkret vollziehen sollte.
Der Impuls dafür ging in Preußen von König Friedrich Wilhelm III. aus, der das Reformationsjubiläum des Jahres 1817 zum Anlass für einen Aufruf nahm, der von seinem Hoftheologen Rulemann Friedrich Eylert verfasst und am 27. September 1817 veröffentlicht wurde (→ KTGQ IV, 183f; Huber/Huber I, 576–578). Darin hob der König den Nutzen einer »wahrhaft religiösen Vereinigung der beiden, nur noch durch äußere Unterschiede getrennten protestantischen Kirchen« hervor. Die Union dürfe jedoch nicht erzwungen sein und nicht nur in einer äußeren Vereinigung bestehen, »sondern in der Einigkeit der Herzen.« Der König kündigte auch an, er wolle das Reformationsjubiläum durch die Vereinigung seiner lutherischen und reformierten Hofgemeinde in Potsdam zu einer »evangelisch-christlichen Gemeinde« feiern. So geschah es dann auch.
Anders waren die Voraussetzungen für eine Union in Baden, das wie Preußen durch den Reichsdeputationshauptschluss und die folgende territoriale Umgestaltung Deutschlands ganz erheblich an Bevölkerung und Fläche gewonnen hatte. Aus dem Markgrafen Karl Friedrich von Baden war unterdessen ein Großherzog geworden, der – selbst lutherisch – über eine gemischtkonfessionelle Bevölkerung herrschte. Große katholische Bevölkerungsteile, die vor allem in bis dahin zu Österreich gehörenden Gebieten »Vorderösterreichs« ansässig waren, kamen hinzu, für die 1821 das Erzbistum Freiburg errichtet wurde. Ebenso fand sich durch die Vereinnahmung der rechts des Rheins gelegenen Gebiete der Kurpfalz eine große Anzahl Reformierter in den Grenzen Badens wieder. 1820 lebten in Baden 261.000 Lutheraner und 67.000 Reformierte, darüber hinaus 704.000 Katholiken. In Baden gab es aber schon im 18. Jahrhundert starke aufklärerisch-tolerante Strömungen, die durch das Herrscherhaus unterstützt wurden. Dieses sah die Landeskirche als Instrument zur Vermittlung aufgeklärter Tugendhaftigkeit an. Auch die Pfarrerschaft hing in großen Teilen aufklärerischem Denken an, das im 19. Jahrhundert dann in einen theologischen Liberalismus überging.
Nach dem Reichsdeputationshauptschluss war eine der Hauptaufgaben dieser aufgeklärt-toleranten und vom Großherzog geleiteten Kirche die Integration der neu hinzugekommenen reformierten Bevölkerung. Großherzog Karl Friedrich ordnete die gemeinsame Verwaltung der lutherischen und der reformierten Kirche durch paritätisch besetzte Organe an. Schon 1807 gab es damit eine Verwaltungsunion. Das Reformationsjubiläum des Jahres 1817 rief in Baden geradezu eine gemeinprotestantische Euphorie hervor, die in Bittschriften von lutherischen und reformierten Pfarrern an den seit 1818 amtierenden Großherzog Ludwig zugunsten der Vereinigung der protestantischen Konfessionen ihren Ausdruck fand. 1821 trat eine gemeinsame Generalsynode zusammen, die den eigentlichen Beginn der badischen Union markiert. Sie war paritätisch besetzt, obwohl es in Baden viermal so viel Lutheraner wie Reformierte gab. Die Generalsynode verabschiedete eine Unionsurkunde (→ Huber/Huber I, 675–681), die auf eine Konsensunion zielte, insofern als die lutherische Confessio Augustana und der reformierte Heidelberger Katechismus gleichberechtigt nebeneinandergestellt wurden. Man sah sich also in einer gemeinsamen reformatorischen Tradition und berechtigt, die bestehenden, historisch gewachsenen Differenzen auszugleichen und so auch zu einem gemeinsamen Abendmahlsverständnis zu gelangen. Auf dieser Grundlage formierte sich eine evangelisch-protestantische Landeskirche. Dass Unionen durchaus im Trend der Zeit lagen, zeigen die Beispiele der damals zu Bayern gehörenden Pfalz und deutscher Kleinstaaten.
3.4Der Agendenstreit in Preußen
Das erste Ziel des königlichen Unionsplans in Preußen waren gemeinsame Gottesdienste, und der König selbst wollte in seiner Potsdamer Garnisonkirche mit gutem Beispiel vorangehen. Dieses Vorbild wirkte sich bei den Gottesdiensten am Reformationstag 1817 in Preußen tatsächlich aus, doch feierten Lutheraner und Reformierte in der Folgezeit im Wesentlichen weiterhin getrennt. Die Verhältnisse blieben also unübersichtlich. Friedrich Wilhelm III. versuchte daraufhin, das Unionsprojekt durch die Durchsetzung einer einheitlichen Agende voranzutreiben, die sich an Luthers Deutsche Messe anlehnte. 1821 wurde eine neue Agende für Armeegottesdienste eingeführt, 1822 folgte eine weitere für den Berliner Dom. Über die Superintendenten der Pfarrerschaft bekannt gemacht, stieß sie dort zu großen Teilen auf Ablehnung, zumal unter Reformierten. Die Ablehnung konnte sich auf das Preußische Allgemeine Landrecht stützen, das in seinen Paragraphen zur Regelung der Kirchenverhältnisse das Recht zur Einführung liturgischer Ordnungen den Kirchengemeinden vorbehielt und dem Staat nur ein Prüfungsrecht einräumte. Am stärksten war die Opposition in den neuen Westprovinzen Rheinland und Westfalen. Die staatliche Seite aber ließ nicht locker. So wurde 1822 allen künftigen Pfarrern bei ihrer Ordination die eidliche Verpflichtung auf das (lutherische) Konkordienbuch, einschließlich der altkirchlichen Bekenntnisse sowie der Confessio Augustana, abverlangt. 1825 wurde darüber hinaus die staatliche Anerkennung von Pfarrern seitens des Kultusministeriums davon abhängig gemacht, ob diese die neue Agende akzeptierten.
Der Konflikt konnte gegen Ende der 1820er Jahre nur dadurch beigelegt werden, dass die Agende in den einzelnen Provinzen modifiziert und um Anhänge ergänzt wurde, die stärker lutherische oder reformierte Traditionen berücksichtigten. 1834 erklärte Friedrich Wilhelm III., dass zwischen Agende und Union ein Unterschied bestehe und die Agende mit ihren Modifikationsmöglichkeiten verpflichtend sei, nicht aber die Union (→ Huber/Huber I, 582f). Dies hatte für die Regelung der Kirchenverhältnisse in den neuen Westprovinzen erhebliche Bedeutung. Dort wurde angesichts der innerkirchlichen Opposition 1834 eine eigene Provinzialagende eingeführt. Dieses Zugeständnis wurde 1835 verbunden mit der Anerkennung der dort traditionell praktizierten Leitung der Kirche durch Synoden und Presbyterien (→ KTGQ IV, 190–192; Huber/Huber I, 600–605). Den kirchlichen Selbstverwaltungsorganen wurden aber von Staats wegen ein Generalsuperintendent und ein Provinzialkonsistorium gegenübergestellt. Die Tendenz zur Selbstorganisation blieb also wenigstens teilweise lebendig; ein Jahrhundert später kam das bei der Bildung der Bekenntnissynoden während des »Kirchenkampfes« wieder zum Tragen.
Erbitterten Widerstand leisteten in der Unionsfrage konfessionstreue Lutheraner, vor allem in Schlesien. Dort hatten sich die Lutheraner bis zur Vereinnahmung durch Preußen im Jahre 1740 der österreichisch-katholischen Vormacht erwehren müssen, und nun wollten sie ihren Konfessionsstand nicht einer Union preisgeben. Zwar ließen sich die meisten durch die Möglichkeit der Modifizierung der Agende durch einen für die Provinz geltenden Anhang besänftigen, doch verweigerte sich ein harter Kern bis hin zur Kirchenspaltung. In einem staatskirchlichen System, das auf konfessionelle Konformität angelegt war, erging es den renitenten »Altlutheranern« nun nicht anders als anderen Minderheitenkonfessionen: Ihnen wurde das Recht auf öffentliche Religionsausübung entzogen. Zuwiderhandlungen wurden mit Geldstrafen oder Gefängnis bedroht. Prominent wurde als Opfer der preußischen Repression der Breslauer Pfarrer und Theologieprofessor Johann Gottfried Scheibel, der 1832 des Landes verwiesen wurde und zuerst in Dresden und dann in Erlangen Aufnahme fand. Erst Friedrich Wilhelm IV. lenkte nach dem Thronwechsel 1840 ein. Die Altlutheraner erhielten 1841 das Recht, sich als »Evangelisch-Lutherische Kirche in Preußen« zu organisieren. Viele aber waren inzwischen nach Nordamerika oder Australien ausgewandert. Das Thema der Union wurde noch einmal nach dem Krieg mit Österreich 1866 aktuell, als Preußen das Königreich Hannover, Schleswig-Holstein und die hessischen Staaten als Beute erhielt. Zwar wurden der lutherische Konfessionsstand und die bestehende Kirchenverfassung für die Hannoversche Landeskirche garantiert (→ Huber/Huber II, 355), doch war der Widerstand gegen die Union hier weiterhin stark, und er wurde durch den Pfarrer Ludwig Adolf Petri verkörpert. Petri gründete 1853 auch den ersten lutherischen »Gotteskastenverein« in Deutschland, aus dem dann der Martin-Luther-Bund erwuchs. Das erstarkende lutherische Selbstbewusstsein führte 1868 zur Gründung der »Allgemeinen Evangelisch-Lutherischen Konferenz«, einem fernen Vorläufer der nach 1945 gegründeten VELKD. Ihr publizistisches Organ war die »Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung«.
3.5Der Konflikt um die Mischehen in Bayern und Preußen. Der Kölner Kirchenstreit
Gemischte Ehen zwischen Protestanten und Katholiken waren in den neuen deutschen Staaten aus bevölkerungspolitischen Gründen sehr erwünscht. Ihr Anteil an den Eheschließungen stieg im 19. Jahrhundert trotz einer den »Mischehen« generell feindlichen Mentalität kontinuierlich an und erreichte in Preußen und Bayern um 1900 fast 10%. Für die katholische Kirche waren konfessionsverschiedene Ehen eine Herausforderung, und dies auch in kirchenrechtlicher Hinsicht. Zwar gab es dafür Ausnahmeregelungen, doch machten diese sehr deutlich, dass die Kirche auf ihrem Anspruch beharrte, Ehesachen gehörten in ihre rechtliche Kompetenz. Dies schnitt sich mit der auf staatlicher Seite immer stärker werdenden Tendenz, die Ehe zu einer Sache bürgerlichen Rechtes zu machen. Die daraus erwachsenden Konflikte trugen indirekt zu einer Neuformulierung des Verhältnisses von Staat und Kirche und zur Einführung der »Zivilehe« bei. Solange es diese nicht gab, waren die Pfarrer in der Regel die Standesbeamten, ohne die keine rechtsgültige Trauung möglich war. Möglichkeiten zu einer Verständigung lagen im katholischen Verständnis der Eheschließung beschlossen: Ihre sakramentaleGrundlage war die gegenseitige Willenserklärung der Brautleute. Der Pfarrer hatte die Funktion eines kirchlich autorisierten Zeugen, der die Willenserklärung liturgisch bekräftigen konnte. In den folgenden Konflikten ging es vor allem um die Frage, wie aktiv oder passiv diese »Assistenz« wahrgenommen werden musste und ob die Pfarrer den Brautleuten das Versprechen zur katholischen Erziehung aller Kinder abfordern oder den Konfessionswechsel des evangelischen Partners anmahnen durften.
In Bayern hatte das Religionsedikt von 1818 den Fall konfessionsverschiedener Ehen so geregelt: Wo es keinen Ehevertrag mit entsprechenden Vereinbarungen gab, sollten die Söhne in der Konfession des Vaters, die Töchter in der Konfession der Mutter erzogen werden (→ Huber/Huber I, 129). Dies entsprach den Regelungen des Allgemeinen Preußischen Landrechts von 1794 (→ Huber/Huber I, 310). Die katholischen Geistlichen waren verpflichtet, dem katholischen Partner die Eheschließung zu erlauben. Trotz der eindeutigen Gesetzeslage verlangten sie aber den Brautleuten weiterhin das Versprechen ab, die Kinder katholisch zu erziehen. Die bayrische Regierung bestand darum 1831 darauf, die Pfarrer sollten ohne jeden Vorbehalt der Eheschließung zustimmen. Der Staat bekräftigte damit seine Auffassung, Ehesachen seien nicht der geistlichen Sphäre, also der Kirche zuzuordnen. Die Antwort war 1832 ein Breve Papst Gregors XVI. an die bayrischen Erzbischöfe und Bischöfe (→ Huber/Huber I, 464–466). Der Papst stellte hier Bedingungen für die Zustimmung eines katholischen Geistlichen zur Eheschließung auf, zu denen vor allem die Belehrung der Brautleute über die Notwendigkeit der katholischen Kindererziehung gehörte. König Ludwig I. gelang es 1834, in einem sehr persönlich gehaltenen Brief an den Papst den Konflikt zu entschärfen (→ Huber/Huber I, 466f). Daraufhin erging im gleichen Jahr eine Instruktion aus Rom an die bayrischen Erzbischöfe und Bischöfe (→ Huber/Huber I, 468–470). Zwar wurden die katholische Kindererziehung und die Herüberziehung des evangelischen Partners zur katholischen Konfession nach wie vor als das Ideal angesehen, doch sollte es hier keinen Zwang seitens der Pfarrer geben. Die Pfarrer selbst sollten »dieser Eheschließung in nur körperlicher Anwesenheit und ohne Vollzug eines kirchlichen Ritus beiwohnen«, nämlich in der »Rolle eines sachkundigen oder amtlichen Zeugen«, also in »passiver Assistenz«.
Zur gleichen Zeit brach der gleiche Konflikt in Preußen aus. Hier aber verlief er unter den anderen konfessionspolitischen Bedingungen wesentlich schärfer und erlangte eine noch grundsätzlichere Bedeutung für das Verhältnis von Staat und Kirche: 1803 hatte der preußische König Friedrich Wilhelm III. verfügt, alle Kinder aus gemischten Ehen seien in der »Religion«, also der Konfession, des Vaters zu erziehen (→ Huber/Huber I, 310), und damit war die grundsätzliche Regelung des Allgemeinen Landrechts außer Kraft gesetzt. Problematisch wurde diese Regelung, als sie zur Vereinheitlichung der Rechtsverhältnisse 1825 auf die preußisch gewordenen Rheinlande und Westfalen ausgedehnt wurde (→ Huber/Huber I, 312): Wo es dort gemischte Ehen gab, wurden diese meist von preußischen, evangelischen Soldaten und Beamten mit katholischen Bräuten geschlossen. Die Bevorzugung des Protestantismus bei der Kindererziehung traf sich also mit der Etablierung einer neuen Funktionselite. Der preußische Staat reagierte damit auf die Praxis der katholischen Geistlichen, das Brautpaar zu dem Versprechen zu drängen, die Kinder katholisch zu erziehen.
Die Bischöfe der preußisch gewordenen Diözesen Köln, Trier, Paderborn und Münster fügten sich dieser Anweisung nach außen hin, forderten aber die Pfarrer auf, wenigstens von den katholischen Partnern weiterhin die Zusage der katholischen Kindererziehung einzuholen. In der Mischehenfrage kam es zwar zu Verhandlungen zwischen Preußen und dem Heiligen Stuhl, doch zeigte die römische Seite keine besondere Eile. Erst 1830 erging ein Schreiben Papst Pius’ VIII., das Verständigungsbereitschaft signalisierte (→ Huber/Huber I, 317–321). Durch das vorgeschaltete Plazet bekamen es die preußischen Bischöfe aber nicht in die Hand. Dieses Breve verbot es, die gemischtkonfessionelle Eheschließung »mit irgendeinem heiligen Ritus zu beehren«, was offensichtlich von einigen Pfarrern so praktiziert wurde. Die Pfarrer sollten nur anwesend sein und die Trauung in das Standesregister eintragen. Die Norm war also auch hier die passive Assistenz. Die Trauung überhaupt zu verweigern, schien nicht angebracht, da sich Brautleute in solchen Fällen an evangelische Pfarrer wandten und das Paar damit für die katholische Kirche verloren war.
Dieses päpstliche Breve war der preußischen Regierung noch nicht entgegenkommend genug. Man verhandelte nun direkt mit den betroffenen Bischöfen. Der Kölner Erzbischof Ferdinand August Graf von Spiegel, ein noch in alten aufklärerischen und staatskirchlichen Traditionen stehender Kirchenvertreter, fand sich 1834 bereit, in Berlin eine Geheimkonvention mit der preußischen Regierung zu unterschreiben (→ Huber/Huber I, 324–328), der sich die anderen, ihm untergeordneten drei Bischöfe von Trier, Paderborn und Münster anschlossen. Dieses Abkommen zielte auf eine mildere Auslegung: Die passive Assistenz wurde zur Ausnahme erklärt, und der Regelfall sollten »die üblichen kirchlichen Feierlichkeiten« sein. Nun wurde das päpstliche Breve von 1830 den Pfarrern mitgeteilt, doch war diese Mitteilung flankiert von einem Hirtenbrief (→ Huber/Huber I, 330f) und einer Instruktion des Kölner Erzbischofs (→ Huber/Huber I, 331–333), womit das Breve im Sinne der nicht veröffentlichten Geheimkonvention umgedeutet wurde: Die Pfarrer sollten also die aktive Assistenz leisten und auf das Versprechen der katholischen Kindererziehung verzichten.
Erzbischof Spiegel starb 1835. Sein Nachfolger wurde Clemens August von Droste-Vischering. Auch von ihm erwartete man Kooperation in der Mischehenfrage. Er erklärte, er werde sich an die Geheimkonvention halten, allerdings an »jene gemäß dem Breve getroffene Vereinbarung« (→ Huber/Huber I, 334). Dennoch forcierte er bald dessen Durchsetzung. Unterdessen begann sich der Ultramontanismus herauszubilden, also eine starke Orientierung des Katholizismus auf das »hinter den Bergen« (den Alpen: ultra montes) liegende Rom mit dem Papsttum. Aus diesen Kreisen wurden Vorwürfe gegen die Bischöfe laut, die der Kollaboration mit der preußischen Regierung und des Ungehorsams gegen den Papst geziehen wurden. In Rom erfuhr man von der Geheimkonvention. Droste-Vischering war also in einer Situation, in der er Stellung beziehen musste. Die anderen drei Bischöfe legten auf dem notwendigen Umweg über das preußische Kultusministerium in Rom Rechenschaft über ihr Vorgehen ab und bekundeten ihr Einverständnis mit der neuen Praxis, die sie auf einer Linie mit dem »im Geist der Milde« abgefassten Breve sahen. Als ihre Briefe in Rom eintrafen, war der Konflikt schon eskaliert. Der Trierer Bischof Joseph von Hommer aber widerrief 1836 auf dem Totenbett reumütig sein Einverständnis mit der preußischen Politik (→ Huber/Huber I, 346).
Die Sache begann der preußischen Regierung zu entgleiten, zumal Droste-Vischering einen scharfen Konfrontationskurs einschlug. Zum zweiten Feld des Konfliktes wurde sein Kampf gegen die an der Bonner Katholisch-Theologischen Fakultät gelehrte Theologie, die von den »Hermesianern«, also den Schülern des 1831 verstorbenen Theologen Georg Hermes vertreten und 1835 von Gregor XVI. verurteilt wurde. Für den Erzbischof war diese Theologie purer Rationalismus und eine Unterminierung der kirchlichen Lehrautorität (→ Huber/Huber I, 367–370). 1837 entzog er dem Vorlesungsbetrieb in Bonn die kirchliche Genehmigung. Die angehenden Pfarrer sollten vielmehr das unter seiner Kontrolle stehende Priesterseminar in Köln besuchen.
Für die preußische Regierung war damit das Maß voll. Immerhin war die Bonner Fakultät 1818 der neu gegründeten Universität zusammen mit einer evangelischen eingegliedert worden, um die Ausbildung des geistlichen Nachwuchses unter staatlicher Aufsicht zu halten. Die Regierung untersagte im November 1837 dem Kölner Erzbischof die Ausübung seines Amtes (→ Huber/Huber I, 383–388), disziplinierte ihn also wie einen widerspenstigen Beamten und ließ ihn auf die Festung Minden abführen. Der Konflikt zwischen katholischer Kirche und preußischem Staat war nun auf die Spitze getrieben. Aus dem Mischehenstreit war der »Kölner Kirchenstreit« oder das »Kölner Ereignis« geworden, das eine ganz ungeahnte Wirkung in Deutschland hatte. Der Auslöser dafür war vor allem ein Buch des Münchner Publizisten und Gelehrten Joseph Görres, das 1838 erschien, den Titel »Athanasius« trug und reißenden Absatz in ganz Deutschland fand (→ KTGQ IV, 196f). Görres aber wollte den Konflikt nicht anstacheln, sondern ihn entschärfen, indem er das Verhältnis von Staat und Kirche neu definierte. Der Staat, so Görres, hatte mit der Verhaftung des Erzbischofs unzulässig in die inneren Angelegenheiten der Kirche eingegriffen, anstatt die Freiheit der Kirche in ihrem Innern zu achten und zu schützen. Görres wollte keinesfalls auf eine Trennung, sondern auf eine wechselseitige Beziehung, auf ein »Durcheinanderspielen« von Staat und Kirche hinaus. Das Staatskirchentum hatte für Görres seine Zeit hinter sich. Im Rheinland bildete sich in diesen Jahren eine katholische Opposition, die für die Rechte der Kirche eintrat. Dies war die Geburtsstunde eines kirchlich und politisch selbstbewussten Katholizismus.
3.6Ansätze zur Selbstorganisation im Protestantismus
Freie Gemeinden und Freikirchen hatten in der Selbstorganisation einen erheblichen Vorsprung. Dazu trug das Fehlen staatlicher Vorgaben für die innere Organisation bei, dessen Kehrseite freilich Benachteiligungen durch Recht und Verwaltungspraxis waren, und ferner das hohe Engagement der Laien. In den Landeskirchen machte sich der Wunsch nach einer Selbstorganisation ebenfalls durch Vereinsgründungen, aber auch durch Pläne für Synoden bemerkbar. Dieser Wunsch war, so etwa bei Friedrich Schleiermacher, verquickt mit dem Gedanken der Repräsentation des Volkes auf politischer Ebene. Dementsprechend galten Synoden nach den restaurativen »Karlsbader Beschlüssen« von 1819 als politisch gefährlich, und dies vor allem in Preußen. Nach Auffassung Friedrich Wilhelms III. und der preußischen Verwaltung sollten Synoden allenfalls eine beratende Funktion haben und die staatliche Unionspolitik stützen oder eine Art Pfarrkonferenz sein. Innerhalb der Kirche war die Beteiligung von Laien an Leitungsfunktionenseitens der Pfarrerschaft meist nicht erwünscht; dementsprechend stark war die Opposition gegen die Einführung von Kirchenvorständen. Nach einer kurzen Blüte des Synodalwesens auf preußischer Kreis- und Provinzebene im Zuge der Unionsbestrebungen des Jahres 1817 wurde darum schon bald gegengesteuert. Zu einer preußischen Generalsynode kam es überhaupt erst 1846. Zwar war das 1835 für die Rheinlande und Westfalen genehmigte Modell einer Kombination von synodaler und staatlich-konsistorialer Kirchenleitung ein Beleg dafür, dass sich der Gedanke der kirchlichen Selbstorganisation nicht einfach aus der Welt schaffen ließ, doch kam der Synodalgedanke in Preußen und anderen deutschen Staaten erst nach 1848 voll zum Durchbruch.
Neben derartigen kirchenorganisatorischen Fragen, die zugleich auch immer solche des konfessionellen Selbstverständnisses sein konnten, waren solche von Belang, die die Identität der neuen Landeskirchen betrafen. Agende, Bekenntnis, Liturgie, Gesangbuch und Katechismus brachten zur Darstellung, welcher Gemeinschaft man zugehörig war. Streitigkeiten um die Identität, wie sie im Zuge der Union in Preußen auftraten, störten die Identitätsbildung. Auch vor diesem Hintergrund ist die Abwehr abweichender Strömungen allzu liberaler, erweckter oder konfessioneller Prägung zu sehen.
4Theologie und Frömmigkeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Wilhelm Gundert, Geschichte der deutschen Bibelgesellschaften im 19. Jahrhundert, Bielefeld 1987. – Peter Scheuchenpflug, Die Katholische Bibelbewegung im frühen 19. Jahrhundert, Würzburg 1997.
Mit den Stichworten »Pietismus« und »Aufklärung« sind Stichworte benannt, die die Wahrnehmung der Theologie und der Frömmigkeit im 18. Jahrhundert stark bestimmen und Phänomene umfassen, die in sich vielgestaltig und in manchem auch miteinander verwandt waren, nicht zuletzt da, wo es ihnen um Reformen und eine individuelle Aneignung von Religion ging. Die Aufklärung war, jedenfalls in Deutschland, eben nicht nur religionskritisch gestimmt, sondern sie konnte auch ein Reformprogramm beinhalten, das Gottesdienst und Predigt, Alltagsleben und Frömmigkeitskultur modernisieren sollte, etwa in Form von neuen Gesangbüchern und Agenden, einer neuen Religionspädagogik oder Predigtkultur. Freilich stieß dies auch auf Kritik, und deutlich war zugleich, dass in den Städten die Kirchlichkeit im Sinne einer von der Obrigkeit kontrollierten religiösen Vergemeinschaftung trotz aller Aufbrüche schon in die Krise geraten war. Dies zeigte sich auch in der Romantik, für die Religion im Empfinden aufgehen konnte.
Das Christentum hatte im frühen 19. Jahrhundert dennoch immer noch einen erheblichen Einfluss auf die Selbstverständigung der Gesellschaft und des Individuums. Evangelisch oder katholisch zu sein hieß etwas und prägte Mentalitäten wie daraus folgende Haltungen. Konversionen wie die des Grafen Friedrich Leopold von Stolberg 1800 oder die Friedrich Schlegels 1808 erregten Aufsehen. Die Konfessionsgrenzen wurden durch solche Einzelfälle nicht verwischt; vielmehr ist eine erneute konfessionelle Profilierung zu beobachten. Was Novalis in »Die Christenheit oder Europa« (→ KTGQ IV, 164f) – an der Schwelle des neuen Jahrhunderts verfasst, aber erst Jahre später posthum veröffentlicht – am Horizont auftauchen sah, nämlich eine Synthese von Christentum und Kultur, die sich nur oberflächlich als Ruf zur Wiedervereinigung im Katholizismus lesen ließ, musste ein literarischer Versuch bleiben. Nach wie vor und nicht zuletzt durch das Scheitern der Französischen Revolution war aber davon auszugehen, dass in der öffentlichen Darstellung das Christentum zur Sprache kam und dass die christliche Theologie nicht nur als Wissenschaft, sondern auch als Deutehorizont aktueller Fragen in Kirche und Gesellschaft Bedeutung hatte. Vor allem die protestantischen Kirchen aber konnten ihre Ansprüche im Blick auf die individuelle Lebensführung und die Gestaltung der Gesellschaft wenn überhaupt, dann nur noch in bestimmten Sektoren durchsetzen.
4.1Der Protestantismus
Im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum des Jahres 1817 meldete sich ein lutherischer Konfessionalismus pietistischer, nun erwecklich zu nennender Prägung zu Wort. Der Kieler Pastor Claus Harms veröffentlichte in diesem Jahr 95 Sätze, die er Luthers 95 Thesen gegenüberstellte (→ KTGQ IV, 184–186). Harms wollte den Rationalismus und somit die Übermacht der Vernunft über den Glauben in die Schranken weisen. Die Bibel und die lutherischen Bekenntnisschriften wurden demgegenüber als die entscheidenden Autoritäten herausgestellt. Harms lehnte die Union in Preußen ab und hielt am Reformationstag 1817 eine Bußpredigt. Seine Thesen führten zu einer länger anhaltenden literarischen Kontroverse. Das konfessionelle Luthertum bekam einen zweiten Impuls durch das Jubiläum der Confessio Augustana 1830. Dieses schon bald so genannte »Neuluthertum« verstand sich als Gegenbewegung zur Aufklärung, und unter dem Einfluss der Erweckungsbewegung wurde dabei die Frage nach der persönlichen, lutherisch geprägten Frömmigkeit wichtig. Zum Zentrum dieser Bewegung wurde die Theologische Fakultät in Erlangen.Hier lehrten seit 1833 Johann Friedrich Wilhelm Höfling und Adolf von Harleß, später wurde der Exeget Johann Christian Konrad von Hofmann (→ KTGQ IV, 226–228) ein wichtiger Repräsentant der »Erlanger Schule«. Höfling, Schöpfer der bayrischen Agende von 1853, war Praktischer Theologe. Sein Interesse galt der Kirchenverfassung, und er bezog sich dabei auf Luther und die Reformation. Harleß wurde in der Zeit des Ministeriums Abel wegen seines Protests im Kniebeugungsstreit gemaßregelt; insofern kam ihm eine Berufung an die Universität Leipzig 1845 sehr gelegen, und er verpflanzte das Neuluthertum an die dortige Theologische Fakultät. 1850 wurde Harleß Hofprediger in Dresden, doch holte ihn 1852 der neue König Maximilian II. nach Bayern zurück und machte ihn zum Präsidenten des protestantischen Oberkonsistoriums, in das auch Höfling berufen wurde. So wurde das Erlanger Luthertum das theologische Fundament der erst allmählich zusammenwachsenden evangelischen Landeskirche in Bayern. Seit 1857 war dann in Erlangen Franz Hermann Reinhold von Frank tätig, der in Leipzig bei Harleß studiert hatte. Durch Frank, der stark auch von Hofmann beeinflusst war, kamen noch einmal Impulse der Erweckungsbewegung in die konfessionelle lutherische Theologie hinein. Konkrete Auswirkungen hatte das Neuluthertum auf das Verständnis des Pfarramtes, das nun als »geistliches Amt« gegenüber den Laien überhöht wurde.
Einen ganz anderen Weg schlug Friedrich Schleiermacher (→ KTGQ IV, 165–169) ein, der seit 1796 als reformierter Prediger an der Charité in Berlin tätig war. 1799 erschien sein erstes großes Werk: »Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern«; es war inzwischen also unübersehbar, dass es im städtischen Bürgertum eine offene Distanz zum Christentum gab. Schleiermacher verteidigte darin die christliche Religion und kritisierte gleichzeitig die kirchliche Orthodoxie wie die aufklärerische, moralische Variante von Religion. Deren Wesen, so Schleiermacher, ist weder Denken noch Handeln. Für Schleiermacher hatte Religion nichts mit dogmatischen Systemen, nichts mit Moral und Vernunft zu tun, sondern war Sache von Anschauung und Gefühl, und zugleich Sache der Kultur. »Gefühl« meinte dabei einen Glauben, der sich mit Gott, ja mit dem Universum in geradezu mystischer Weise vereint.
1802 zog sich Schleiermacher aus Berlin zurück und ging bis 1804 als Pfarrer in das pommersche Stolp. 1804 wurde er Professor in Halle, doch wurde die Universität 1806 geschlossen, als Preußen von napoleonischen Truppen besetzt wurde. 1807 wurde er Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche in Berlin. Seine große Stunde schlug, als 1810 die Berliner Universität gegründet und er an sie berufen wurde. Zugleich verfasste er Entwürfe für eine Kirchen- und Schulreform in Preußen. Er akzeptierte die Oberaufsicht des Staates über die Kirche, forderte aber eine stärkere Freiheit der Kirche in ihrer Selbstverwaltung. Das Hauptinstrument dafür sollten Synoden als Repräsentanzen der Pfarrer und der Laien sein. Diese Pläne konnten im Zuge der Unionsbemühungen 1817 nur teilweise umgesetzt werden. 1811 legte Schleiermacher ein Lehrbuch vor, die »Kurze Darstellung des theologischen Studiums« (→ KTGQ IV, 169). Dabei handelte es sich letztlich um eine Programmschrift, die plausibel machen sollte, warum die Theologie immer noch Bestandteil einer modernen Universität sein sollte – dies war nämlich bei der Gründung der Berliner Universität durchaus umstritten. Dem Büchlein war in seiner ersten Fassung kein sonderlicher Erfolg beschieden; 1830 gab Schleiermacher es nochmals in radikaler Umarbeitung heraus, die nicht zuletzt auf Lesefreundlichkeit zielte. Schleiermacher unterschied nun »Philosophische Theologie«, »Historische Theologie« und »Praktische Theologie«, aber wichtiger als die Unterscheidung ist die im einleitenden Paragraphen genannte innere Verbindung der theologischen Disziplinen. Die Vorschaltung der Philosophischen Theologie war notwendig geworden, weil die Theologie im Wissenschaftsbetrieb schon dieser Zeit ihre Selbstevidenz verloren hatte. Es ging hier aber nicht um Theologie und Philosophie, sondern um das, was Schleiermacher Apologetik und Polemik nannte. Die Apologetik hatte ganz klassisch den Wahrheitsanspruch des Christentums zu befestigen, während die Polemik sich nicht etwa nach außen, sondern nach innen richtete, und zwar auf historisch gewachsene Defizite in der Frömmigkeit oder im Gemeinschaftsleben, das also, was Schleiermacher Indifferentismus, Separatismus und Ketzerei nannte. Um so nötiger war die Historische Theologie, zu der Schleiermacher die Exegese, die Kirchengeschichte, die Dogmatik und die kirchliche Statistik, also erste Ansätze einer empirischen Bestandsaufnahme, stellte. Die Aufgabe der Kirchengeschichte sollte die Darstellung der gesamten Entwicklung des Christentums sein, und sie sollte dabei sozusagen die Ursprungsidentität des Christentums überprüfen. Der in der ersten Auflage zu findende Satz »Die praktische Theologie ist die Krone des theologischen Studiums« fehlte in der von 1830, und somit darf nicht übersehen werden, dass es bei Schleiermacher heißt (§ 28): »Die historische Theologie ist sonach der eigentliche Körper des theologischen Studiums, welcher durch die philosophische Theologie mit der eigentlichen Wissenschaft und durch die praktische mit dem tätigen christlichen Leben zusammenhängt.«
1821/22 erschien Schleiermachers theologischer Gesamtentwurf »Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt«, die »Glaubenslehre«, die er 1830/31 in einer überarbeiteten zweiten Auflage herausgeben ließ. Hier werden viele Gedanken aus den Reden über die Religion weitergeführt, die 1821 in dritter Auflage erschien: Frömmigkeit ist Neigung und Bestimmtheit des Gefühls, ist Bewusstsein der schlechthinnigen Abhängigkeit des Menschen von Gott. Auch hier spielt das historische Denken eine große Rolle, das auch auf die Dogmatik angewendet wird. So heißt es schon im ersten Leitsatz: »Dogmatische Theologie ist die Wissenschaft von dem Zusammenhange der in einer christlichen Kirchengesellschaft zu einer bestimmten Zeit geltenden Lehre.«
An Schleiermacher





























