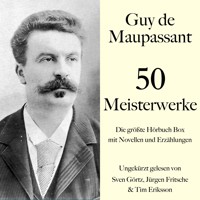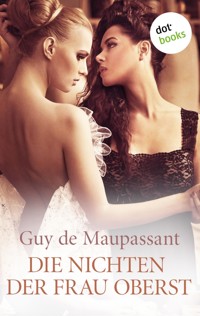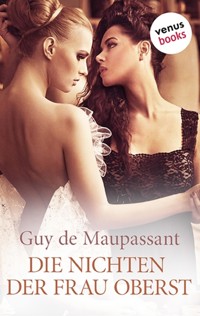Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält die folgenden Novellen des Meisters der Schauerliteratur: Miß Harriet Denis Kellner, ein Bier! Auf der Reise Ein Idyll Die Erbschaft Der Esel Der Strick Die Taufe Reue Onkel Julius Mutter Sauvage
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichten für schlaflose Nächte, Band 3
Guy de Maupassant
Inhalt:
Henri René Albert Guy de Maupassant – Biografie und Bibliografie
Miß Harriet
Denis
Kellner, ein Bier!
Auf der Reise
Ein Idyll
Die Erbschaft
Der Esel
Der Strick
Die Taufe
Reue
Onkel Julius
Mutter Sauvage
Geschichten für schlaflose Nächte, Band 3, G. de Maupassant
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster, Deutschland
ISBN: 9783849624255
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Thaut Images - Fotolia.com
Henri René Albert Guy de Maupassant – Biografie und Bibliografie
Franz. Romanschriftsteller, geb. 5. Aug. 1850 auf Schloß Miromesnil in der Normandie, gest. 7. Juli 1893 in Paris, begann seine Laufbahn als Ministerialbeamter. Für den angehenden Schriftsteller war Gustave Flaubert, ein Vetter seiner Mutter, gebornen Le Pottevin, ein treuer, unnachsichtiger Berater, der sogleich erkannte, daß in der Novellistik seine Stärke lag. Bekannt wurde M. nicht durch die Gedichte »Des Vers« (1880), sondern erst durch die 1870 in Rouen spielende musterhafte Novelle »Boule de Suif«, das Glanzstück der von Zola und seinen Schülern vereinigten »Soirées de Médan« (1880). Durch Objektivität und scharfe Hervorhebung des charakteristischen Merkmals zeichnete sich M. vor den übrigen Naturalisten, auch vor Zola selbst, aus. Seine Novellen sind im ganzen seinen Romanen überlegen, weil die hastige Produktion von 27 Bänden innerhalb 10 Jahren die planmäßige Arbeit erschwerte. Hervorragend sind immerhin die beklemmend traurige Ehegeschichte »Une Vie« (1883) und der Journalistenroman »Bel-Ami« (1885). Es folgten »Mont-Oriol« (1887), »Pierre et Jean« (1888) und endlich die einen unheilvollen Einfluß Bourgets verratenden sentimentalen Romane »Fort comme la Mort« (1889) und »Notre cœur« (1890). Unter den 20 Novellenbänden ragen besonders hervor: »La Maison Tellier« (1881), »Miss Harriet« (1884), »Monsieur Parent« (1885), »Le Horla« (1887), »L'inutile Beauté« (1890). Die Novelle »Musotte« dramatisierte M. mit J. Normand 1891 mit großem Erfolg. Der direkt für die Bühne geschriebene Zweiakter »La Paix du Ménage« (1893) gelang weniger. M. verfiel, wie sein älterer Bruder und mehrere andre Verwandte, in Wahnsinn, machte in Cannes einen Selbstmordversuch und starb in der Privatanstalt Blanche zu Paris. Eine illustrierte Gesamtausgabe seiner Werke erschien in 27 Bänden 1900–04. Von den zahlreichen Übersetzungen nennen wir die von H. v. Ompteda (»Gesammelte Werke«, Berl. 1898–1903, 20 Bde.). Ein Denkmal wurde ihm 1897 im Parc Monceaux zu Paris gesetzt.Vgl. A. Lumbroso, Souvenirs sur M., sa dernière maladie, sa mort (Par. 1905).
Miß Harriet
I
Wir fuhren zu sieben, vier Damen und drei Herren, von denen einer neben dem Kutscher auf dem Bock Platz genommen hatte. Im Schritt zogen uns die Pferde die große Steigung hinan, die die Straße in Kehren überwand. Bei Tagesanbruch waren wir aus Étretat fortgefahren, um die Minen von Tancarville zu besehen. Wir schliefen alle noch halb. Die Morgenkühle lahmte uns. Am müdesten waren die Damen, die solch frühes Aufstehen nicht gewöhnt. Alle Augenblicke fielen ihnen die Augen zu, der Kopf sank zur Seite oder sie gähnten, ohne von der Schönheit des Morgens etwas zu ahnen.
Es war Herbst. Zu beiden Seiten des Weges dehnten sich kahle Flächen. Gelb leuchteten die Haferfelder herüber, wie die Stoppeln eines unrasierten Bartes. Nebel krochen hin als dampfte die Erde. Lerchen schmetterten hoch oben in den Lüften und die Vögel sangen in den Büschen ihr Morgenlied.
Endlich ging gerade vor uns rotglühend am Horizont die Sonne auf. Und je höher sie stieg von Minute zu Minute, desto mehr schien die Landschaft zu erwachen, zu lächeln und wie ein Mädchen, das dem Bett entsteigt, ihr weißes Nachtgewand abzuwerfen. Graf d'Étraille, der auf dem Bock saß, rief:
– Ein Hase.
Dabei deutete er mit dem Arm nach links auf ein Kleefeld. Das Tier floh und man sah nur noch seine langen Löffel über das Grüne huschen. Dann wechselte der Hase auf ein Ackerfeld hinüber, ging wie wahnsinnig davon, schlug einen Hacken, that sich nieder und äugte ängstlich, Gefahr witternd umher, unschlüssig, welchen Weg er nehmen sollte. Jetzt ward er wieder mit großen Sätzen flüchtig und verschwand in einem Rübenfeld. Die Herren waren wach geworden und blickten dem Tiere nach.
Reno Lemanoir meinte:
– Wir sind heute früh nicht gerade sehr artig gegen die Damen!
Zu seiner Nachbarin, der kleinen Baronin de Sérennes, die gegen den Schlaf ankämpfte, sagte er halblaut:
– Baronin, Sie denken an Ihren Gatten. Seien Sie ohne Sorge, er kommt erst Sonnabend zurück. Sie haben noch vier Tage Frist.
Sie antwortete halb schläfrig lächelnd:
– Reden Sie keinen Unsinn.
Dann schüttelte sie die Müdigkeit ab und fügte hinzu:
– Erzählen Sie uns lieber eine hübsche Geschichte, Herr Chenal. Sie sollen doch mehr Glück bei den Frauen gehabt haben als der Herzog von Richelieu. Erzählen Sie uns eine Liebesgeschichte, die Ihnen passiert ist. Ach bitte, bitte.
Léon Chenal, ein alter Maler, der einst sehr schön gewesen und ein großer Don Juan dazu, strich sich den langen weißen Bart, lächelte und sann nach. Dann ward er plötzlich ernst:
– Lustig wird's gerade nicht werden, meine Damen. Ich will Ihnen die traurigste Liebesgeschichte meines Lebens erzählen. Ich will nur wünschen, daß keinem meiner Freunde etwas Ähnliches geschehen möge.
II
Ich war damals zwanzig Jahre alt und »klexte« längs der Küste der Normandie herum. »Klexen« nenne ich nämlich dieses Vagantenleben mit dem Ränzel auf dem Rücken, wo man von Wirtshaus zu Wirtshaus zieht, um in freier Natur Skizzen zu machen. Ich kenne nichts Schöneres als diese Wanderzeit, ohne Fesseln, ohne Sorgen, ohne Vorurteil, selbst ohne an den nächsten Tag zu denken. Man geht, wohin es einem beliebt, als Leitstern nur die Phantasie, ohne etwas Anderes zu wollen, als Schönes zu sehen. Man bleibt stehen, weil ein Bach einen verlockt, weil der Geruch geschmorter Kartoffeln aus dem Wirtshaus in die Nase zieht. Manchmal hat der Duft einer Clematis unsere Wahl entschieden, oder das Augenspiel eines Mädchens unter der Gasthausthür. Man verachte nur solche ländliche Liebe nicht. Diese Mädchen haben auch Herz und Sinne, feste Wangen und frische Lippen und ihr heißer Kuß ist köstlich wie eine wilde Frucht. Woher die Liebe auch komme, sie gilt überall: ein Herz, das pocht, wenn wir kommen, ein Auge, das weint, wenn wir gehen, das sind so seltene, süße, köstliche Dinge, daß man sie nie verachten soll.
Ich habe Liebeshuld erfahren am Wegesrande, wo die Primeln blühen, hinter dem Stalle, wo die Kühe schlafen und auf dem Boden im Stroh, das noch warm war von der Hitze des Tages. Ich erinnere mich grober Leinwand auf elastisch-festem Fleische und denke wehmütig an naive Zärtlichkeiten, süßer in ihrer aufrichtigen Derbheit als die zarte Liebe vornehmer, reizender Frauen.
Aber das Schönste bei diesem Herumstreifen ist die Landschaft, der Wald, Sonnenaufgang, Dämmerung, Mondschein. Das ist für den Maler die Hochzeit mit der Natur. Man ist allein mit ihr in ruhigem, langem Verweilen, man wirft sich in eine Wiese, mitten unter Gänseblumen und Mohn und sieht mit offenen Augen beim strahlend hellen Tageslicht weit drüben das kleine Dorf mit seinem spitzen Kirchturm, von dem es Mittag schlägt.
Man setzt sich an den Rand einer Quelle, die am Fuße eines Eichstammes sprudelt, mitten unter zarten, hohen, glitzernden Gräsern. Man kniet sich hin, man beugt sich nieder, man trinkt dieses kalte, durchsichtige Wasser, das den Bart und die Nase netzt, man trinkt es mit körperlichen Behagen, als küßte man die Quelle, Lippe auf Lippe gedrängt. Manchmal, wenn man tiefere Stellen in diesen schmalen Wasserläufen trifft, badet man und fühlt auf der Haut, von Kopf zu Fuß wie eine eisige, süße Liebkosung, das Brausen des rinnenden Wassers.
Man lacht auf den Hügeln, man wird schwermütig gestimmt am Teich, und wenn die Sonne in ein Meer von blutroten Wolken sinkt und rote Lichter auf das Wasser wirft, überkommt einen selige Wonne, und abends, wenn der Mond am Himmel aufsteigt, denkt man an tausend wundersame Dinge, die einem nicht zu Sinnen kämen bei hellem lichtem Tage.
Als ich nun so durch diese Gegend strich, wo wir eben sind, kam ich eines Abends in das kleine Dorf Bénouville, das am Felsenufer liegt zwischen Yport und Étretat. Ich kam von Fécamp längs der Küste, die mit ihren vorspringenden Kreidefelsen jäh wie eine Mauer ins Meer abstürzt. Von früh an war ich auf dem kurzen, feinen, wie ein Teppich weichen Rasen dahingeschritten, der am Rande des Abgrundes wächst, vom salzigen Seewind bestrichen. Ich sang aus voller Kehle und ging mit langen Schritten, wahrend ich ab und zu dem langen Bogenflug einer Möve zusah, die auf dem blauen Himmel die weiße Rundung ihrer Flügel zeigte, dann wieder einen Blick auf das grüne Meer warf, oder auf das braune Segel einer Fischerbarke. So hatte ich frei und sorglos einen glücklichen Tag verlebt.
Man bezeichnete mir ein kleines Häuschen, wo man Reisende aufnahm. Es war eine Art Wirtshaus, das eine Bäuerin hielt. Ein normannischer Hof von doppelter Buchenreihe umgeben.
Ich schritt landeinwärts und ging auf das Haus zu inmitten der großen Bäume und fragte nach Mutter Lecacheur.
Eine alte, runzlige, ernste Bäuerin erschien, die den Eindruck machte, als ginge es ihr wider den Strich, Gäste aufzunehmen, gegen die sie offenbar überhaupt eine Art Mißtrauen hatte.
Es war im Mai. Die Apfelbäume blühten und überdeckten den Hof mit einem Blütendach, von dem unausgesetzt ein Regen kleiner rosa Blätter niederwirbelte auf die Menschen und ins Gras.
– Nun, Frau Lecacheur, haben Sie ein Zimmer für mich frei?
Sie war erstaunt, daß ich ihren Namen wußte und antwortete:
– Wi wullt mal seihen, allens ist vermiet'. Ich wer' trotzdem mal verseuken, wat sich maken läßt.
Nach fünf Minuten waren wir einig und ich stellte meine Tasche auf den Lehmboden eines ländlichen Zimmers, in dem ein Bett stand, zwei Stühle, ein Tisch und eine Waschschale. Das Zimmer lag nach der großen räucherigen Küche zu, wo die Pensionäre mit dem Gesinde und der Wirtin, die Witwe war, ihre Mahlzeiten einnahmen.
Ich wusch mir die Hände, dann ging ich hinaus. Die Alte briet zum Mittagessen ein Huhn im großen Kamin, in dem der rauchgeschwärzte Kesselhaken hing.
– Haben Sie denn Gäste jetzt? fragte ich sie.
Sie antwortete in ihrer unzufriedenen Art:
– Ja, ne Dame habe ich wull, ne ole Engländerin, die hat das andere Zimmer.
Ich machte einen Aufschlag von täglich fünf Sous aus für das Recht, solange es schönes Wetter sei, allein draußen im Hofe zu essen.
Man deckte mir also den Tisch vor der Thüre und ich begann die mageren Knochen des normannischen Huhns zu zerlegen. Dazu trank ich hellen Apfelwein und aß grobes Weißbrot, das schon vier Tage alt war, aber ausgezeichnet schmeckte.
Plötzlich öffnete sich die Holzthür, die hinaus zur Straße führte und eine ganz eigentümliche Person kam auf das Haus zu.
Sie war sehr mager, sehr groß und derartig in einen rotgewürfelten schottischen Shawl gewickelt, daß man hätte denken können, sie besäße keinen Arm, wenn nicht an der Hüfte eine lange Hand erschienen wäre, die einen weißen Touristensonnenschirm hielt. Ihr Mumiengesicht war von grauen Locken umrahmt, die bei jedem Schritt wackelten. Sie erweckte in mir – ich weiß nicht warum – den Gedanken an einen sauren Hering, der Löckchen trug. Schnell ging sie mit gesenkten Augen vorüber und verschwand im Haus.
Die eigentümliche Erscheinung stimmte mich heiter. Das war sicher meine Nachbarin, die alte Engländerin, von der unsere Wirtin gesprochen.
An dem Tage sah ich sie nicht wieder. Als ich mich am nächsten Morgen in dem reizenden kleinen Thälchen zum Malen niedergelassen, das Sie kennen und das nach Étretat hinabzieht, gewahrte ich plötzlich auf der Höhe etwas ganz Eigentümliches, etwas wie ein Mast mit einer Flagge daran. Sie war es. Als sie mich sah, verschwand sie.
Mittags ging ich zum Frühstück nach Haus und setzte mich an den allgemeinen Tisch, um die Bekanntschaft dieses alten Originals zu machen. Aber sie ging auf meine Artigkeiten nicht ein und schien für meine kleinen Aufmerksamkeiten nicht empfänglich zu sein. Trotzdem goß ich ihr Wasser ein und reichte ihr so liebenswürdig als möglich die Schüsseln. Als Dank hatte sie kaum eine Kopfbewegung für mich oder ein englisches Wort, so leise daß ich es nicht verstand.
Ich kümmerte mich nicht mehr um sie, aber meine Gedanken beschäftigten sich mit ihr.
Nach drei Tagen wußte ich von ihr soviel, wie Frau Lecacheur selbst.
Sie hieß Miß Harriet. Auf der Suche nach einer einsamen Sommerfrische war sie vor sechs Wochen in Bénouville angekommen und es schien, als würde sie nicht wieder fortgehen. Bei Tisch sprach sie niemals, aß schnell und las dabei fortwährend kleine protestantische Traktätchen. Diese Bücher verteilte sie an alle Welt, selbst der Pfarrer hatte vier Stück bekommen, die ihm ein Junge für zwei Sous Botenlohn gebracht. Manchmal sagte sie plötzlich zu unserer Wirtin, ohne jede Einleitung:
– Ich lieben Gott über alles. Ich ihn anbeten und die ganze Schöpfung, und den ganze Natur, ich habe ihn immer in mein Herz.
Dabei gab sie der verblüfften Bäuerin sofort eines jener zur Erbauung des ganzen Weltkreises bestimmten Traktätchen.
Im Dorf konnte man sie nicht leiden. Der Lehrer hatte erklärt, sie sei eine Atheistin und seitdem wurde sie von der Seite angesehen. Der Pfarrer, den Frau Lecacheur um Rat gefragt, antwortete:
– Sie ist eine Ketzerin, aber Gott will den Tod des Sünders nicht. Und ich glaube, daß sie eine durchaus moralische Person ist.
Diese Worte »Atheistin« und »Ketzerin«, deren genauen Sinn im Dorfe niemand ahnte, machten die Leute stutzig. Unter anderem wurde behauptet, die Engländerin wäre sehr reich und hätte ihr ganzes Leben hindurch die Welt durchstreift, weil ihre Familie sie verstoßen. Warum hatte ihre Familie sie verstoßen? Natürlich, wegen ihres Unglaubens.
In Wirklichkeit war sie eines jener Wesen mit fixer Idee, eine jener versessenen Puritanerinnen, wie England deren so viele hervorbringt, eine jener guten und ganz erträglichen alten Jungfern, die alle table d'hôtes Europas heimsuchen, die einem Italien verleiden, die Schweiz vergiften, die die reizenden Städte an der Riviera unmöglich machen und die überall hin ihre Verschrobenheiten mitbringen, ihr Benehmen wie versteinerte Vestalinnen, ihre unmöglichen Toiletten und einen gewissen Kautschukgeruch, der den Verdacht erregt, als steckten sie nachts in einem Futteral.
Wenn ich sonst in einem Hotel ein solches Wesen sah, entfloh ich wie ein Vogel vor der Vogelscheuche. Doch diese kam mir so eigentümlich vor, daß sie mir nicht gerade mißfiel.
Frau Lecacheur, die instinktmäßig Allem feindlich gegenüberstand, was nicht Bauer war, fühlte in ihrem beschränkten Verstand eine Art Haß gegen das verzückte Wesen der alten Jungfer. Sie hatte einen Ausdruck gefunden, um sie zu bezeichnen, einen wegwerfenden Ausdruck, der ihr, Gott weiß wie, auf die Lippen gekommen war und zu dem sie durch irgend einen verdrehten wunderlichen Schluß gelangt. Sie sagte:
– Dat ist 'ne »Besessene«.
Dieses Wort, das man diesem ernsten und sentimentalen Wesen angehängt, erschien mir unwiderstehlich komisch. Ich nannte sie selbst nur noch die Besessene. Und es machte mir ein wunderliches Vergnügen, wenn ich sie sah, laut das Wort vor mich hinzusprechen.
Ich fragte Mutter Lecacheur:
– Na, was macht denn unsere Besessene heute?
Die Bäuerin antwortete mit empörter Miene:
– Denken Se mol, se hat 'ne Padde upgelesen mit 'ne zerquetschte Pfot', hat se mit in ihr Zimmer geschleppt, in die Waschbalje gesmitten und mit 'n Leinenlappen verbunden, as wie 'en Minschen. Dat ist doch 'n Skandal!
Als sie ein andermal am Felsufer spazieren gegangen, hatte sie einen großen Fisch, der eben gefangen worden, gekauft. Nur um ihn wieder ins Meer zu werfen. Und der Fischer hatte sie, obwohl sie ihn gut bezahlte, mit Schimpfworten überschüttet und war außer sich gewesen, als ob sie ihm das Geld aus der Tasche gestohlen hätte. Noch nach Wochen konnte er davon nicht sprechen, ohne in Wut zu geraten, und die Engländerin zu schmähen. Ja, Miß Harriet war eben eine Besessene! Es war ein genialer Einfall von Mutter Lecacheur gewesen, sie so zu taufen.
Der Stallknecht, den man den Sappeur nannte, weil er in seinen jungen Jahren in Afrika gedient, war anderer Ansicht. Er sagte, mit den Augen zwinkernd:
– Ole Betschwester, junge Bettschwester.
Wenn das die arme alte Jungfer gewußt hätte!
Das kleine Hausmädchen Céleste bediente sie nicht gern, obgleich ich nicht verstand, warum. Vielleicht nur, weil sie fremd war, von einer anderen Rasse, eine andere Sprache sprach und sich zu einer anderen Religion bekannte. Es war eben eine Besessene!
Sie irrte den ganzen Tag umher, suchte Gott und betete zu ihm in der Natur. Eines Abends fand ich sie knieend in einem Gebüsch. Ich hatte durch die Blätter hindurch etwas Rotes gesehen, bog die Zweige beiseite und Miß Harriet stand vor mir. Sie war ganz betreten, daß ich sie so erblickt und sah mich erschrocken an, wie eine Eule am lichten Tage.
Manchmal, wenn ich am Felsufer arbeitete, sah ich sie plötzlich am Klippenrande wie eine Telegraphenstange stehen. Verzückt blickte sie ins weite leuchtende Meer hinaus und auf den purpurfarbenen Himmel. Ab und zu entdeckte ich sie in einem Thal, wie sie schnell mit ihrem elastischen Engländerschritt dahinging. Und ich folgte ihr, ich weiß nicht warum, vielleicht nur, um ihr verzücktes hageres Gesicht zu sehen, aus dem tiefes innerliches Glück leuchtete.
Oft begegnete ich ihr auch in der Nähe eines Bauernhofes, wie sie im Grase saß, im Schatten eines Apfelbaumes, ihre Traktätchen aufgeschlagen auf den Knien, den Blick in die Weite.
Die Zeit strich hin. Ich ging nicht mehr fort, so zog mich diese weite stille Landschaft an. Ich fühlte mich in diesem versteckten Bauernhofe wohl, allem Erdentreiben fern, nur der Natur, der guten, heiligen, schönen, grünen Erde nahe, die wir eines Tages selbst mit eigenem Leibe düngen werden. Und vielleicht – ich muß es gestehen – hielt mich auch ein wenig die Neugierde bei Mutter Lecacheur zurück. Ich hätte gern diese seltsame Miß Harriet näher kennen gelernt, hätte gern gewußt, wie es eigentlich in den Seelen solcher umherirrenden alten Engländerinnen ausschaut.
III
Wir machten auf ganz eigentümliche Weise Bekanntschaft. Ich hatte eben eine Studie vollendet, die mir gelungen schien und es auch war. Fünfzehn Jahre später wurde sie für 10000 Franken verkauft. Übrigens war sie ein ganz einfaches Motiv. Auf der ganzen rechten Seite meiner Leinwand sah man einen riesigen Felsen mit braunem, gelbem, rotem Seegrase bewachsen, über das die Sonnenstrahlen wie Öl niederrannen. Das Licht fiel von rückwärts auf den Fels und setzte ihn in rote Glut. Weiter nichts. Ein lichtüberstrahlter Vordergrund.
Links erblickte man das Meer. Nicht das blaue schieferfarbene Meer, sondern grünlich, milchig und hart wirkend unter dem dunklen Himmel.
Ich war mit meiner Arbeit so zufrieden, daß ich vor Freuden umhersprang, als ich sie nach Hause brachte. Am liebsten hätte ich sie der ganzen Welt gezeigt. Und ich erinnere mich, daß ich sie einer Kuh am Wegesrande vorhielt und ihr zurief:
– Sieh mal das an, altes Biest, so was siehst du nicht wieder.
Als ich nach Haus kam, rief ich sofort Mutter Lecacheur und schrie:
– Ha! Ha! Frau Wirtin, bemühen Sie sich mal her und gucken Sie mal das an.
Die Wirtin sah mein Werk mit blöden Augen an; man merkte, daß sie nichts unterschied und nicht kapierte, ob das ein Ochse sein sollte oder ein Haus.
Miß Harriet kam heim und ging gerade in dem Augenblick hinter mir vorüber, als ich meine Leinwand mit ausgestrecktem Arme der Wirtin zeigte. Die Besessene konnte ja nicht anders, als sie sehen, denn ich hielt die Skizze so, daß sie ihr nicht entgehen konnte. Sie blieb wie angewurzelt stehen, ganz paff. Das war offenbar ihr Felsen, an dem sie herumkletterte und träumte. Ein englisches »Aoh!« entfuhr ihr, so schmeichelhaft, daß ich mich lächelnd zu ihr umdrehte und sagte:
– Das ist meine letzte Skizze, gnädiges Fräulein!
Sie antwortete entzückt, komisch und rührend zugleich:
– O, Sie verstehen der Natur ganz wundervoll.
Ich ward wahrhaftig rot und ihre Schmeichelei that mir wohler, als wenn sie von einer Königin gekommen wäre. Sie hatte mich gänzlich gewonnen und ich hätte ihr auf Ehrenwort am liebsten einen Kuß gegeben.
Bei Tisch setzte ich mich wie immer neben sie, und zum ersten Mal sprach sie, indem sie laut ihren Gedanken von vorhin fortsetzte:
– O, ich lieben so der Natur.
Ich bot ihr Brot, Wein und Wasser an und diesmal nahm sie es an mit leisem mumienhaftem Lächeln. Und wir sprachen von der Natur.
Nach Tisch gingen wir, da wir zusammen aufgestanden, mit einander im Hofe spazieren. Die untergehende Sonne schien das Meer in Brand gesteckt zu haben. Das zog mich an, ich öffnete das Thor nach den Klippen zu und wir schritten neben einander davon, zufrieden wie zwei Menschen, die einander verstanden haben.
Es war ein weicher warmer Abend, einer jener wonnigen Abende wo Leib und Seele glücklich sind. Alles erscheint einem köstlich und reizend. Die laue duftgeschwängerte Luft mit ihrem Gras und Alpenduft, ihrem kräftigen Naturgeruch thut den Sinnen wohl und man atmet tief aus voller Brust. Wir gingen nun am Rande des Absturzes hin; über dem weiten Meer, das gegen hundert Meter unter uns seine kleinen Wellen ans Land wälzte. Und wir sogen mit offenem Munde und weiten Lungen den frischen Windhauch ein, der über den Ozean gestrichen war und uns so salzgetränkt vom langen Kuß der Wellen umfächelte.
Die Engländerin stand da, in ihren karrierten Shawl gewickelt, von der Luft umweht und sah zu wie der Riesensonnenball ins Meer sank. Weit draußen am Horizont zeichnete sich ein segelbedeckter Dreimaster am purpurnen Himmel ab, und näher zu uns glitt ein Dampfer vorüber, der über den ganzen Horizont hinweg einen endlos langen Dampfstreifen hinter sich ließ.
Die rote Kugel sank und sank, bald berührte sie die Flut gerade hinter dem wie unbeweglichen Schiff, das mitten auf der Sonnenscheibe, wie in einem Feuerrahmen, erschien. Nun sank sie allmählich herab, als söge sie der Ozean ein. Man sah sie niedertauchen, kleiner werden, verschwinden. Es war aus. Nur das kleine Schiff hob sich noch immer von dem goldigen Himmelshintergrunde in der Ferne ab.
Miß Harriet schaute mit verzückten Blicken dem Sonnenuntergange zu. Unwiderstehliche Lust kam sie wohl an, den Himmel, das Meer, den ganzen Horizont zu umarmen.
Sie murmelte:
– Aoh, ich lieben ... ich lieben ... ich lieben.
Ich sah eine Thräne in ihrem Auge glänzen und sie sagte:
– Ich möchte eine kleine Vogel sein, um in die Himmel zu fliegen.
Und wie ich sie oft gesehen, regungslos an den Klippen, so blieb sie stehen, rot wie der Sonnenuntergang, in ihren purpurnen Shawl gewickelt. Ich hatte eigentlich Lust, sie in meinem Skizzenbuch zu verewigen, etwa als Karrikatur der Verzückung.
Ich mußte mich umdrehen, um nicht zu lachen.
Dann sprach ich mit ihr über Malerei, wie ich wohl mit einem Kollegen geredet hätte, über Töne, Farbenwerte, Lichter und Farben mit Ausdrücken aus der Zunft. Sie hörte mir aufmerksam zu, begriff und suchte den dunklen Sinn der Worte zu enträtseln und in meine Gedankenwelt einzudringen. Ab und zu sagte sie:
– O, ich verstehen, ich verstehen, es ist sehr uonderfull.
Wir kehrten heim.
Als sie mich am andern Tage sah, gab sie mir die Hand und wir waren gute Freunde.
Sie war ein braves Ding mit einer Seele wie eine Feder, die ab und zu in ihrem Enthusiasmus los schnellte. Ihr fehlte das Gleichgewicht, wie allen Frauen, die mit fünfzig Jahren noch Mädchen geblieben sind.
Sie schien versauert zu sein in ihrer Unschuld. Aber sie hatte ihrem Herzen Jugend und Begeisterungsfähigkeit bewahrt. Sie liebte die Natur und die Tiere mit überschwenglicher Liebe. Mit jener sinnlichen Liebe, die sie den Männern niemals gegeben hatte.
Ich glaube bestimmt, daß der Anblick einer säugenden Hündin, einer Stute, die mit ihrem Fohlen auf der Weide herumsprmgt, eines Nestes voll kleiner piepsender Vögel, die noch unbefiedert mit ihrem großen Kopf den offenen Schnabel hinhalten, sie sehr bewegt haben würde. Ihr armen einsamen umherirrenden traurigen Gäste der tables d'hôte, ihr armen lächerlichen und beklagenswerten Wesen! Seitdem ich diese kennen gelernt, habe ich euch in mein Herz geschlossen.
Bald merkte ich, daß sie mir gern etwas sagen wollte, aber es nicht wagte. Und ich amüsierte mich über ihre Schüchternheit. Wenn ich früh fortging, das Malzeug auf dem Rücken, begleitete sie mich stumm, sichtlich ängstlich, bis an den Dorfausgang und suchte nach Worten, um ein Gespräch zu beginnen. Dann verließ sie mich plötzlich und entfloh in ihrem hüpfenden Gang.
Eines Tages endlich faßte sie Mut:
– Ich gern sehen mögen, wie Sie malen; uollen Sie? Ich sein uirklich sehr neugierig.
Und sie errötete dabei, als ob sie etwas äußerst Gewagtes gesagt hätte.
Ich ging mit ihr in das ›Thälchen‹ hinab, wo ich eine große Studie begann.
Sie blieb hinter mir stehen und folgte mit gespannter Aufmerksamkeit allen meinen Bewegungen.
Dann sagte sie zu mir, vielleicht in der Befürchtung mich zu stören: ›Danke‹, und ging.
Aber nach kurzer Zeit wurde sie zutraulicher und fing an, mir mit offenbarer Freude täglich Gesellschaft zu leisten. Unter dem Arme brachte sie ihren Feldstuhl mit – sie wollte mir durchaus nicht erlauben, ihn zu tragen – und setzte sich an meine Seite. Da blieb sie stundenlang stumm und unbeweglich sitzen, während sie der Spitze meines Pinsels mit dem Auge folgte. Wenn ich durch einen mit dem Spachtel derb hingesetzten Farbenklex eine gute aber unerwartete Wirkung erzielte, stieß sie unwillkürlich ein erstauntes freudiges bewunderndes ›aoh‹ aus. Für meine Malerei hatte sie eine zärtliche Bewunderung. Fast einen religösen Kultus trieb sie mit dieser menschlichen Schilderung eines Stückes göttlicher Schöpfung. Meine Studien schienen ihr wie eine Art Heiligenbilder und manchmal sprach sie mir von Gott und versuchte mich zu bekehren.
O, ihr Gott war ein sonderbarer Mann, so eine Art Dorfphilosoph, ohne großes Können und ohne große Macht, Denn sie stellte sich ihn vor, als ob er außer sich sei über die Sünden, die unter seinen Augen begangen würden, als ob er sie nicht hätte verhindern können.
Übrigens stand sie mit ihm auf sehr gutem Fuße und schien sogar in seine Geheimnisse und in die Unannehmlichkeiten, die ihm widerfuhren, eingeweiht zu sein. Sie sagte: ›Gott will oder Gott will nicht‹; wie ein Offizier zu einem Rekruten sagt: ›Der Oberst hat befohlen.‹
Aus tiefstem Herzen beklagte sie meinen Unglauben, und täglich fand ich in meinen Taschen, in meinem Hute, wenn ich ihn auf der Erde liegen ließ, in meinem Malkasten, in meinen gewichsten Stiefeln früh morgens vor meiner Thür, diese kleinen Traktätchen, die sie zweifellos direkt aus dem Paradiese bezog.
Ich behandelte sie wie eine alte Freundin mit herzlicher Offenheit. Aber bald bemerkte ich, daß ihr Benehmen sich ein wenig geändert hatte. Zuerst achtete ich nicht darauf.
Wenn ich arbeitete, sei's in meinem Thal, sei's in irgend einem Hohlweg, sah ich sie plötzlich ankommen mit ihrem schnellen taktmäßigen Gang. Sie setzte sich plötzlich und war ganz außer Atem, als ob sie gelaufen wäre, oder sie irgend ein Gegenstand selig erregt hatte. Sie war sehr rot, von diesem englischen Rot, das keinem anderen Volk eigentümlich ist. Dann ward sie ohne rechten Grund bleich erdfarben, und ich glaubte sie einer Ohnmacht nahe, aber allmählich gewann sie ihr gewöhnliches Aussehen zurück und fing wieder an zu sprechen. Dann brach sie plötzlich mitten in einem Satz ab, stand auf und lief auf so wunderliche Weise davon, daß ich mir überlegte, ob ich nicht etwas gethan, das ihr mißfallen oder sie hätte kränken können.
Endlich dachte ich, das würde wohl ihre gewöhnliche Art und Weise sein, die sie nur in der ersten Zeit unserer Bekanntschaft mir zu Ehren ein wenig verändert.
Wenn sie nach Hause kam, nach stundenlangen Spaziergängen an der sturmumwogten Küste, waren ihre langen, in Löckchen gedrehten Haare oft aufgegangen und hingen herab, wie ein paar zerbrochene Sprungfedern. Früher hatte sie sich nicht weiter darum gekümmert und war ruhig so zerzaust zu Tisch gekommen.
Jetzt aber ging sie auf ihr Zimmer, um ihre Lampencylinder, wie ich die Löckchen nannte, wieder in Ordnung zu bringen. Und wenn ich ihr mit vertraulicher Artigkeit, die sie übrigens immer empörte, einmal sagte:
– Miß Harriet, Sie sind heute schön, schön wie die Sonne! so färbten ihre Wangen sich sofort ein wenig, wie bei einem jungen Mädchen von fünfzehn Jahren.
Nachher ward sie aber ganz anders und kam nicht mehr, um mir beim Malen zuzusehen. Ich dachte, das ist eine Krisis, die wird schon vorüber gehen. Aber sie ging nicht vorüber. Wenn ich nun mit ihr sprach, so antwortete sie mir entweder mit gezwungener Gleichgültigkeit oder mit verhaltener Erregung, und manchmal war sie schroff und ungeduldig und nervös. Ich sah sie nur bei den Mahlzeiten und wir redeten kaum mit einander. Ich dachte wirklich, ich müßte sie durch irgend etwas gekränkt haben und fragte sie eines Abends:
– Sagen Sie mal, Miß Harriet, warum sind Sie nicht mehr gegen mich wie früher? Habe ich etwas gethan, was Ihnen nicht gefiel? Das thäte mir sehr leid.
Sie antwortete mit furchtbar komischer Wut in der Stimme:
– Ich mit Sie immer derselbe gewesen sein, das ist nicht wahr.
Und sie lief davon und schloß sich in ihrem Zimmer ein.
Manchmal sah sie mich ganz wundersam an und seit dieser Zeit habe ich mir oft gesagt, daß die zum Tode Verurteilten einen ähnlich anblicken müssen, wenn man ihnen das Urteil verkündet. In ihrem Auge lag eine Art von Wahnsinn, und dann noch etwas Anderes, ein Fieber, ein verzehrender Wunsch nach etwas, das nicht gewesen und nicht sein konnte. Und mir war es, als ob sich in ihrem Innern ein Kampf abspiele, als ob ihr Herz ringe mit einer unbekannten Kraft, die sie meistern wollte und vielleicht noch etwas ... was weiß ich, was weiß ich.
IV
Das war wirklich eine sonderbare Entdeckung.
Seit einiger Zeit arbeitete ich von Tagesanbruch ab an einem Gemälde mit folgendem Vorwurf: man blickte in einen tief eingesenkten Hohlweg, dessen beide Böschungen mit Brombeeren und Bäumen bestanden waren. Auf ihm lag jener milchige, watteartige Dunst, wie manchmal über den Thälern bei Tagesanbruch. Und tief drinnen in diesem dichten durchsichtigen Nebel sah man kommen oder eher noch erriet man zwei Menschen, Bursche und Mädchen, eng umschlungen, sie den Kopf zu ihm erhoben, er niedergebeugt zu ihr. Ein erster Sonnenstrahl brach durch die Zweige, durchschoß den Nebel und warf einen Rosaschein hinter dem ländlichen Liebespaar durch den Dunst, sodaß sich ihre Schatten in silberner Helligkeit abzeichneten. Das Bild war gut, sehr gut.
Ich arbeitete in dem Wege, der in das kleine Thal von Étretat hinunterführt. Und zufällig hatte ich das Glück, diesen Morgen gerade den wogenden Dunst vorzufinden, den ich brauchte.
Da erschien plötzlich etwas vor mir, etwas wie ein Gespenst. Es war Miß Harriet. Als sie mich sah, wollte sie fliehen. Aber ich rief ihr zu:
– Kommen Sie doch, kommen Sie doch, gnädiges Fräulein. Ich habe ein kleines Bild für Sie.
Wie unwillig trat sie näher. Ich hielt ihr meine Skizze hin. Sie sagte nichts, aber starrte sie lange unbeweglich an und begann plötzlich zu weinen. Sie weinte krampfartig, nervös, wie jemand, der lange gegen die Thränen gekämpft hat, der nun nicht mehr anders kann und seinem Gefühlsausbruch, wenn auch noch immer widerstrebend, freien Lauf läßt. Ich fuhr in die Höhe, mich bewegte dieser Kummer, den ich nicht verstand, und ich nahm ihre Hand in plötzlicher Gefühlsaufwallung wie es eben ein Franzose thut, der schneller handelt als er denkt.
Einige Sekunden ließ sie ihre Hände in den meinen. Ich fühlte wie sie zitterten, als ob an allen ihren Nervensträngen gerissen würde. Dann zog sie die Hände schnell zurück oder vielmehr entriß sie mir.