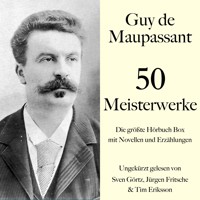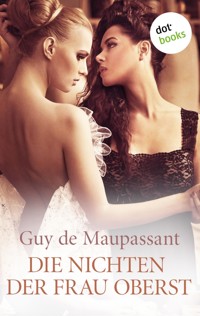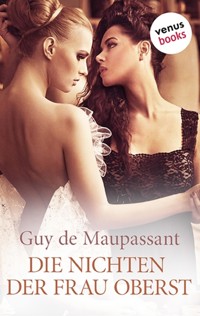Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält die folgenden Novellen des Meisters der Schauerliteratur: Die kleine Roque Das Wrack Der Einsiedler Fräulein Perle Rosalie Prudent Frau Parisse Julie Romain Der alte Amable
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichten für schlaflose Nächte, Band 9
Guy de Maupassant
Inhalt:
Henri René Albert Guy de Maupassant – Biografie und Bibliografie
Die kleine Roque
Das Wrack
Der Einsiedler
Fräulein Perle
Rosalie Prudent
Frau Parisse
Julie Romain
Der alte Amable
Geschichten für schlaflose Nächte, Band 9, G. de Maupassant
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster, Deutschland
ISBN: 9783849624231
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Thaut Images - Fotolia.com
Henri René Albert Guy de Maupassant – Biografie und Bibliografie
Franz. Romanschriftsteller, geb. 5. Aug. 1850 auf Schloß Miromesnil in der Normandie, gest. 7. Juli 1893 in Paris, begann seine Laufbahn als Ministerialbeamter. Für den angehenden Schriftsteller war Gustave Flaubert, ein Vetter seiner Mutter, gebornen Le Pottevin, ein treuer, unnachsichtiger Berater, der sogleich erkannte, daß in der Novellistik seine Stärke lag. Bekannt wurde M. nicht durch die Gedichte »Des Vers« (1880), sondern erst durch die 1870 in Rouen spielende musterhafte Novelle »Boule de Suif«, das Glanzstück der von Zola und seinen Schülern vereinigten »Soirées de Médan« (1880). Durch Objektivität und scharfe Hervorhebung des charakteristischen Merkmals zeichnete sich M. vor den übrigen Naturalisten, auch vor Zola selbst, aus. Seine Novellen sind im ganzen seinen Romanen überlegen, weil die hastige Produktion von 27 Bänden innerhalb 10 Jahren die planmäßige Arbeit erschwerte. Hervorragend sind immerhin die beklemmend traurige Ehegeschichte »Une Vie« (1883) und der Journalistenroman »Bel-Ami« (1885). Es folgten »Mont-Oriol« (1887), »Pierre et Jean« (1888) und endlich die einen unheilvollen Einfluß Bourgets verratenden sentimentalen Romane »Fort comme la Mort« (1889) und »Notre cœur« (1890). Unter den 20 Novellenbänden ragen besonders hervor: »La Maison Tellier« (1881), »Miss Harriet« (1884), »Monsieur Parent« (1885), »Le Horla« (1887), »L'inutile Beauté« (1890). Die Novelle »Musotte« dramatisierte M. mit J. Normand 1891 mit großem Erfolg. Der direkt für die Bühne geschriebene Zweiakter »La Paix du Ménage« (1893) gelang weniger. M. verfiel, wie sein älterer Bruder und mehrere andre Verwandte, in Wahnsinn, machte in Cannes einen Selbstmordversuch und starb in der Privatanstalt Blanche zu Paris. Eine illustrierte Gesamtausgabe seiner Werke erschien in 27 Bänden 1900–04. Von den zahlreichen Übersetzungen nennen wir die von H. v. Ompteda (»Gesammelte Werke«, Berl. 1898–1903, 20 Bde.). Ein Denkmal wurde ihm 1897 im Parc Monceaux zu Paris gesetzt.Vgl. A. Lumbroso, Souvenirs sur M., sa dernière maladie, sa mort (Par. 1905).
Die kleine Roque
Der Landbriefträger Médéric Rompel, den die Leute in der Gegend kurz ›Médéric‹ nannten, verließ zur gewöhnlichen Stunde das Postamt Rounle -Tors. Nachdem er das kleine Städtchen mit dem kräftigen Tritt des ehemaligen Soldaten durchschritten hatte, ging er quer über die Wiesen von Villaumes, um an die Brindille zu gelangen, deren Wasserlauf er bis zum Dorf Carvelin verfolgte, wo seine Tour begann. Er ging schnell hin an dem schmalen Bach, der schäumend, plätschernd, gurgelnd in Gras-eingefaßtem Bett unter hängenden Weiden hinschoß. Um die großen Steine, die den Bachlauf aufhielten, strudelte es und bildete etwas, wie den Knoten eines Halstuches aus Schaum. Hier und da fiel das Wasser einen Fuß hoch herab, manchmal unsichtbar unter dem Grün, und verursachte dann unter dem grünen Dach von Blättern und Schlinggewächsen ein heftiges Getöse. Weiterhin wurden die Uferränder breiter, und man kam zu einem kleinen, stillen See, in dem zwischen all dem grünen Gewächs, das sich auf dem Boden ruhiger Gewässer hin und her wiegt, Forellen schwammen.
Médéric ging seines Weges, ohne irgend etwas zu sehen, und dachte nur immer: – Der erste Brief ist für Poivron, dann habe ich einen für Herrn Renardet, – ich muß also durch den Hochwald gehen.
Seine blaue Bluse, durch einen schwarzledernen Gürtel an der Taille zusammengehalten, huschte schnell und in gleichmäßigem Tempo über der grünen Hecke von Weiden hin, und sein Stock aus kräftigem Rohr machte an seiner Seite die Bewegung der Beine mit. Er überschritt also die Brindille auf einer Brücke, die durch einen einzigen Baumstamm gebildet war, den man von einem Ufer zum anderen geworfen hatte und dessen Geländer aus einem, durch zwei Pfähle an beiden Ufern gehaltenen Strick bestand.
Der Hochwald, Herrn Renardet, dem Bürgermeister von Carvelin, gehörig, dem größten Grundbesitzer in der Gegend, bestand aus gewaltigen, alten Bäumen, gerade wie Säulen, und erstreckte sich eine halbe Meile auf dem linken Ufer des Baches, der die eine Grenze des riesigen Blätterdaches bildete. Längs des Wassers wuchsen hohe Büsche in der Sonnenwärme, aber im Hochwald selbst gab es nur Moos, dickes, weiches, schwellendes Moos, das in der bewegungslosen Luft einen leichten Geruch von Moder und abgestorbenen Zweigen verbreitete.
Médéric verlangsamte seinen Schritt, nahm die schwarze, mit rotem Streifen geschmückte Mütze ab, wischte sich die Stirn, denn es war schon warm auf den Wiesen, obgleich es noch nicht acht Uhr morgens war.
Er hatte eben die Mütze wieder aufgesetzt und wollte seinen schnellen Schritt wieder aufnehmen, als er zu Füßen eines Baumes ein Messer sah, ein kleines Kindermesser. Als er es aufhob, fand er noch einen Fingerhut und zwei Schritte weiter eine Nadelbüchse.
Er nahm die Gegenstände an sich und dachte: »Ich werde sie dem Herrn Bürgermeister geben.« Dann setzte er seinen Weg fort. Aber jetzt war er aufmerksam geworden, und er hoffte noch mehr zu finden.
Plötzlich blieb er stehen, als wäre er an einen Holzzaun gestoßen, denn zehn Schritt vor ihm lag auf dem Rücken ein Kind, ganz nackt auf dem Moos. Es war ein kleines Mädchen, etwa zwölf Jahr, hatte die Arme ausgestreckt, die Beine auseinandergespreizt und ein Taschentuch auf dem Gesicht. Seine Schenkel waren ein wenig blutbefleckt.
Médéric näherte sich auf den Fußspitzen, als fürchte er, Lärm zu machen, als ahnte er irgend eine Gefahr, und riß die Augen auf.
Was war denn das? Sie schlief wahrscheinlich? Dann überlegte er sich, daß man um halb acht Uhr früh unter kühlen Bäumen nicht so unbekleidet schläft. Sie war also tot, und es handelte sich um ein Verbrechen. Bei diesem Gedanken lief es ihm kalt über den Rücken, obgleich er Soldat gewesen. Und dann war ein Mord in der Gegend etwas so Seltenes und noch dazu an einem Kinde, daß er seinen Augen nicht traute. Aber er sah keine Wunde, nur das geronnene Blut auf dem Bein. Wie hatte man sie denn getötet?
Er blieb dicht bei ihr stehen, blickte sie an, auf den Stock gestützt. Er kannte sie unbedingt, denn er kannte doch alle Leute in der Gegend. Aber da er ihr Gesicht nicht sehen konnte, erriet er ihren Namen nicht. Er beugte sich nieder, um das Taschentuch vom Gesicht fortzunehmen, hielt aber nach kurzer Überlegung die ausgestreckte Hand zurück.
Hatte er das Recht, irgend etwas am Zustand der Leiche zu ändern, ehe das Gericht dagewesen war? Ihm erschien das Gericht wie so eine Art General, dem nichts entgeht und für den ein verlorener Knopf ebenso wichtig ist, wie ein Messerstich in den Leib. Unter dem Taschentuch fand man vielleicht ein wichtiges Beweismittel, das möglicherweise seinen Wert verlieren konnte, wenn eine ungeschickte Hand daran rührte. Er erhob sich also, um zum Bürgermeister zu laufen. Aber ein anderer Gedanke hielt ihn wieder zurück: wenn das kleine Mädchen etwa noch lebte, so konnte er sie doch nicht so liegen lassen. Und ganz vorsichtig, ein Stück von ihr entfernt, kniete er nieder und streckte die Hand nach ihrem Fuß aus. Er war kalt, eisig, von jener fürchterlichen Kälte, die das tote Fleisch so schrecklich macht und keinen Zweifel mehr erlaubt. Bei dieser Berührung drehte sich dem Briefträger das Herz im Leibe um, wie er später sagte, und sein Gaumen wurde ganz trocken. Er stand schnell auf und rannte durch den Wald zum Haus des Herrn Renardet.
Den Stock unter dem Arm, die Fäuste geballt, den Kopf vorgestreckt, lief er im Laufschritt dahin, und in gleichmäßigem Tempo schlug die Ledertasche voll Briefe und Zeitungen ihm auf die Hüften.
Das Haus des Bürgermeisters lag am anderen Ende des Waldes, der ihm als Park diente, und spiegelte eine Seite seiner Mauern in einem kleinen Teich, den dort die Brindille bildete.
Es war ein viereckiges, sehr altes Haus aus grauem Stein, das früher Belagerungen ausgehalten hatte und auf dem sich, etwa zwanzig Meter hoch, ein riesiger Turm, der in's Wasser hineingebaut war, erhob.
Von der Spitze dieses Wachtturms aus hatte man über die Gegend Umschau gehalten. Er hieß der Fuchsturm, ohne daß man recht wußten warum, und daher war auch wahrscheinlich der Name Renardet (Fuchser) gekommen, den die Besitzer dieses Lehns trugen, das sich, wie man sagte, in derselben Familie seit über zweihundert Jahren befand. Denn die Renardet gehörten zu jenem beinahe feudalen Bürgertum, wie es in Frankreich vor der Revolution in der Provinz vielfach vorkam.
Der Briefträger rannte sofort in die Küche, in der die Dienerschaft frühstückte, und rief:
– Ist der Herr Bürgermeister auf? Ich muß ihn gleich sprechen.
Man kannte Médéric als gesetzten, gewichtigen Mann und begriff sofort, daß etwas Außerordentliches geschehen sein mußte.
Herr Renardet wurde benachrichtigt und befahl, den Briefträger vorzulassen. Der Briefträger trat bleich, außer Atem, die Mütze in der Hand, ein und fand den Bürgermeister vor einem langen Tisch, der mit zerstreuten Papieren bedeckt war.
Er war ein dicker, großer Mann, schwer, rot, stark wie ein Ochse und in der Gegend sehr beliebt, obgleich überaus heftig. Er war etwa vierzig Jahr alt und seit einem halben Jahr Witwer. Er lebte wie ein Landedelmann auf seinem Gut. Sein aufbrausendes Temperament hatte ihm oft Unannehmlichkeiten bereitet, aus denen die Magistratsbeamten von Roun-le-Tors ihm als duldsame, diskrete Freunde herauszuhelfen pflegten. Hatte er nicht eines Tages den Postillon vom Bock heruntergeschmissen, weil er seinen Jagdhund Mic-Mac beinah totgefahren hätte! Hatte er nicht den Jagdhüter, der ihn zur Rede stellte, weil er, das Gewehr unter dem Arm, über ein Stück Jagdgebiet des Nachbars ging, die Rippen eingeschlagen! Hatte er nicht sogar den Unterpräfekten, der sich im Ort auf einer Dienstreise aufgehalten hatte, die Herr Renardet aber für eine Wahlagitation ansah, beim Wickel genommen! Denn aus Familientradition machte er der Regierung Opposition. Der Bürgermeister fragte:
– Was giebt's, Médéric?
– Ich habe ein kleines Mädchen tot in Ihrem Hochwald gefunden.
Renardet fuhr auf und wurde ziegelrot:
– Was sagen Sie? Ein kleines Mädchen?
– Ja, Herr Bürgermeister, ein kleines Mädchen, ganz nackig, auf dem Rücken, blutig, tot, – ganz tot.
Der Bürgermeister fluchte:
– Gott verdamm mich, ich will doch wetten, daß das die kleine Roque ist. Man hat mir nämlich eben gemeldet, daß sie gestern abend nicht zu ihrer Mutter nach Haus gekommen ist. Wo Haben Sie sie denn gefunden?
Der Briefträger erklärte die Stelle, erzählte noch ein paar Einzelheiten und erbot sich, den Bürgermeister hinzubringen.
Aber Renardet wurde grob:
– Nein, ich brauche Sie nicht. Schicken Sie mir sofort den Jagdhüter, den Ratsschreiber und den Arzt. Und setzen Sie Ihren Dienstweg fort. Aber schnell, schnell! Und sagen Sie ihnen, wir wollen uns im Hochwald treffen.
Der Briefträger gehorchte, zog sich zurück, wütend und verzweifelt, der Untersuchung nicht beiwohnen zu können.
Der Bürgermeister nahm nun seinen Hut, einen großen, weichen, grauen Filzhut mit sehr breiten Rändern und blieb ein paar Augenblicke in der Hausthür stehen. Vor ihm dehnte sich der Rasen aus, auf dem drei große Flecken, rot, blau und weiß, drei ausgedehnte Blumenbeete mit voll erblühten Blumen standen, eins dem Haus gegenüber, eins links und eins rechts. Weiter draußen streckten die ersten Bäume des Hochwaldes ihre Kronen in den Himmel, während man links, über der zum Teich geweiteten Brindille, ausgedehnte Wiesen sah, ein ebenes, grünes Land, von Bewässerungsgräben durchzogen und von Weidenhecken durchschnitten, die großen Ungetümen, untersetzten Zwergen, ähnlich sahen: Stämme ohne Äste, die auf einem gewaltigen Stumpf einen kurzen, im Winde zitternden Wedel von dünnen Zweigen trugen.
Rechts hinter den Ställen, Remisen und den Wirtschaftsgebäuden begann das Dorf, ein reicher, von lauter Viehzüchtern bewohnter Ort.
Renardet ging langsam die Stufen hinab, wendete sich nach links zum Wasser, dem er mit langsamen Schritten, die Hände auf dem Rücken, folgte. Er senkte die Stirn, und von Zeit zu Zeit blickte er um sich, ob die Leute noch nicht kämen, nach denen er geschickt.
Als er unter das Laubdach kam, blieb er stehen, nahm den Hut ab und wischte sich, wie es Médéric gethan, die Stirn, denn die glühende Junisonne sendete einen Feuerregen zur Erde herab. Dann setzte sich der Bürgermeister wieder in Gang, blieb noch einmal stehen, kehrte zurück, beugte sich plötzlich nieder und tauchte sein Taschentuch in den Bach, der zu seinen Füßen murmelte. Dann legte er sich das Tuch unter dem Hut auf den Kopf. Wassertropfen rannen ihm die Schläfe herab auf seine violetten Ohren, auf seinen gewaltigen, roten Hals und flossen, einer nach dem anderen, unter den weißen Kragen seines Hemdes.
Da immer noch niemand erschien, stieß er mit dem Fuß auf und rief:
– Holla! holla! – Eine Stimme rechts antwortete: – Holla!
Und der Arzt tauchte unter den Bäumen auf. Es war ein kleiner, magerer Mann, ein ehemaliger Militärarzt, den man in der Gegend für sehr ausgezeichnet hielt. Er hinkte, da er im Dienst verwundet worden, und bediente sich eines Stockes zum Gehen. Dann gewahrte man den Jagdhüter und den Ratsschreiber, die, zu gleicher Zeit benachrichtigt, zu gleicher Zeit ankamen. Sie sahen ganz verstört aus, kamen keuchend gelaufen, gingen und trabten abwechselnd, um -schneller hinzukommen, und warfen dabei so die Arme, als wären die nötiger zum Gehen als die Beine.
Renardet sagte zum Arzt: – Wissen Sie, um was es sich handelt?
– Ja. Médéric hat ein totes Kind im Walde gefunden.
– Gut, also los.
Und Seite an Seite gingen sie dahin, von den beiden Männern gefolgt. Ihre Schritte machten auf dem Moos nicht das geringste Geräusch, die Augen hatten sie suchend vor sich hingerichtet. Doktor Labarbe streckte plötzlich den Arm aus:
– Da liegt sie.
Noch weit entfernt sah man unter den Bäumen etwas Helles. Wenn sie es nicht gewußt hätten, was es war, hätten sie es nicht erraten. Es leuchtete so weiß, daß man hätte glauben können, dort läge Wäsche, denn ein Sonnenstrahl fiel durch die Zweige und warf einen hellen Schein, über den Leib. Als sie näher kamen, unterschieden, sie allmählich die Gestalt, den verhüllten Kopf, der zum Wasser gewendet war und die beiden Arme, rechts und links ausgestreckt, wie bei einer Gekreuzigten.
– Es ist verflucht heiß, – sagte der Bürgermeister.
Und indem er sich wieder zur Brindille bückte, tauchte er von neuem sein Taschentuch ein, das er wieder auf den Kopf legte.
Der Arzt schritt eiliger, die Entdeckung interessierte ihn. Sobald er neben dem Mädchen stand, beugte er sich nieder, ohne sie anzurühren. Er hatte seinen Kneifer aufgesetzt, wie man wohl einen besonderes merkwürdigen Gegenstand betrachtet, und ging langsam um die Leiche herum.
Ohne sich aufzurichten, sagte er:
– Notzucht und Mord. Wir werden das nachher feststellen. Das Mädchen ist übrigens, schon fast erwachsen, sehen Sie die Brust. – Die beiden, schon ziemlich entwickelten Brüste waren etwas eingesunken, durch den eingetretenen Tod weich geworden.
Der Arzt lüftete leicht das Taschentuch, das das Gesicht bedeckte. Es war schwarz, fürchterlich, mit heraushängender Zunge und herausquellenden. Augen. Er sagte:
– Mein Gott, man hat sie erwürgt nach der That.
Er faßte den Hals an:
– Mit den Händen erwürgt, ohne übrigens irgend ein besonderes Merkmal zu hinterlassen. Kein Nagelriß noch Fingereindruck. Ja ja, es ist die kleine Roque, allerdings.
Er legte vorsichtig das Taschentuch wieder darauf: – Ich kann nichts Weiter thun, sie ist mindestens schon zwölf Stunden tot. Das Gericht muß benachrichtigt werden.
Renardet stand, die Hände auf dem Rücken, da und betrachtete mit starren Augen den kleinen, auf dem Grase liegenden Körper. Er murmelte:
– So ein Schuft! Wir müßten mal die Kleider suchen.
Der Arzt betastete die Hände, die Arme, die Beine und sagte: – Sie muß gerade gebadet haben, sie werden wohl am Wasser liegen.
Der Bürgermeister befahl:
– Du, Principe, (das war der Ratsschreiber) suchst die Kleider am Bach. Du, Maxime, (das war der Jagdhüter) läufst nach Rouy-le-Tors und holst den Untersuchungsrichter und den Gendarm. Binnen einer Stunde müssen sie hier sein, hörst Du?
Die beiden Leute eilten schnell davon. Und Renardet sagte zum Arzt:
– Welcher Lump mag denn das nur hier in unserer Gegend gethan haben?
Der Arzt brummte:
– Wer weiß, dazu ist jeder fähig. Jeder im besonderen und niemand im allgemeinen. Na, jedenfalls wird es wohl irgend ein Landstreicher gewesen sein, ein Arbeitsloser! Seitdem wir die Republik haben, wimmeln alle Straßen davon.
Sie waren beide Bonapartisten.
Der Bürgermeister fuhr fort:
– Ja, es wird wohl irgend ein Fremder, ein Bummler, ein Landstreicher gewesen sein ohne Behausung und Unterkommen.
Der Arzt fügte mit halbem Lächeln hinzu:
– Und ohne Frau. Da er nichts zu essen und kein Bett hatte, hat er sich wenigstens das verschafft. Man glaubt garnicht, wie viel Menschen es auf der Erde giebt, die in einem gewissen Augenblick zum Verbrechen fähig sind. Wußten Sie denn, daß die Kleine verschwunden war?
Und mit der Spitze seines Stockes berührte er die starren Finger der Toten, einen nach dem anderen, und drückte darauf wie auf Tasten eines Klaviers.
– Ja. Die Mutter ist gestern abend um neun bei mir gewesen, weil das Kind um sieben zum Abendessen nicht nach Haus gekommen war. Bis Mitternacht haben wir es auf der Straße gesucht, aber an den Wald haben wir nicht gedacht. Übrigens mußte es ja erst Tag sein, daß die Nachforschungen einen Zweck hätten.
– Rauchen Sie eine Cigarre? – sagte der Arzt.
– Danke, ich habe keine Lust zu rauchen. Ich kann so was nicht sehen.
Sie blieben beide neben dem zarten, halbwüchsigen Körper stehen, der so bleich sich von dem dunklen Moos abhob. Eine große, blaue Fliege, die auf dem Schenkel hinlief, machte auf den Blutflecken Halt, lief wieder fort, kletterte wieder hinauf, lief über den ganzen Leib, schnell und gleichmäßig, erklomm die eine Brust, stieg wieder hinunter, um die andere in Augenschein zu nehmen und suchte etwas zu saugen an dieser Toten. Die beiden Männer blickten auf den hin- und herirrenden schwarzen Punkt.
Der Arzt sagte:
– Wie das hübsch ist, so eine Fliege auf der Haut. Die Damen im vorigen Jahrhundert wußten sehr wohl, warum sie sich das aufs Gesicht klebten. Warum man's nur nicht mehr macht, möchte ich wissen.
Der Bürgermeister war ganz in Gedanken versunken und schien nicht zu hören.
Aber plötzlich wendete er sich um, ein Geräusch hatte ihn überrascht. Eine Frau in Mütze, eine blaue Schürze umgebunden, stürzte unter den Bäumen herbei. Es war die Mutter, die alte Roque. Sobald Sie Renardet sah, begann sie zu heulen:
– Meine Kleene, meine Kleene, wo ist meine Kleene? – Sie war so verzweifelt, daß sie garnicht auf den Boden blickte. Mit einem Male entdeckte sie die Tote, blieb kurz stehen, schlug die Hände zusammen, hob beide Arme und stieß einen scharfen, herzzerreißenden Schrei aus, wie ein verwundetes Tier.
Dann sank sie über dem Körper in die Kniee und riß mit einem Ruck das Taschentuch vom Gesicht. Als sie dieses fürchterliche, schwarze verzerrte Antlitz sah, fuhr sie wieder auf, warf sich dann mit dem Gesicht zu Boden, indem sie unausgesetzt in das dichte Moos schrie.
Ihr großer, magerer Körper, an dem die Kleider hingen, zuckte in Krämpfen. Man sah ihre hageren Knöchel und ihre vertrockneten, in groben blauen Strümpfen steckenden Waden fürchterlich zucken. Mit den gebogenen Fingern riß sie den Boden auf, als wollte sie ein Loch machen, sich darin zu verstecken.
Der Arzt wurde weich und flüsterte:
– Arme Alte. – Renardet gab ein eigentümliches Geräusch von sich, er stieß es heraus wie ein Niesen, zugleich durch Nase und Mund, zog ein Taschentuch, hustete, schluchzte, heulte hinein und schnaubte sich mit großem Getöse. Er stammelte: – Gott! Gott! Gott verdamm mich, wer ist das Schwein. Ich möchte sehen, wie man ihm den Kopf abschneidet.
Aber Principe erschien wieder, verzweifelt, brachte nichts und rief:
– Ich finde nichts, Herr Bürgermeister, nichts. Nirgends.
Der andere antwortete mit trockener, erstickter Stimme, ganz verstört:
– Was findest Du nicht?
– Die Kleider von der Kleinen.
– Na, na, na, da such doch, such doch! Du mußt sie finden oder Du sollst's mit mir zu thun kriegen.
Der Mann, der wußte, daß man dem Bürgermeister nicht widersprechen durfte, lief wieder in Verzweiflung davon und warf noch auf den Leichnam einen kurzen, ängstlichen Blick.
Unter den Bäumen klangen in der Ferne Stimmen, das ungewisse Summen einer nahenden Menschenmenge, denn Médéric hatte beim Briefeaustragen die Nachricht von Thür zu Thür verbreitet. Die Leute waren zuerst entsetzt gewesen, hatten auf der Straße davon gesprochen, von einem Haus zum anderen sie verbreitend, und waren dann zusammengeströmt, hatten geschwatzt, diskutiert, ein paar Minuten das Ereignis besprochen, und nun kamen sie, um zu sehen.
Gruppenweis, etwas zögernd, unruhig durch die Furcht vor der ersten Aufregung, näherten sie sich. Als sie den Leichnam sahen, blieben sie stehen, wagten nicht, näher zu kommen, und sprachen leise.
Dann faßten sie Mut, traten ein paar Schritte heran und bildeten um die Tote, die Mutter, den Arzt und Renardet, erregt, lärmend, einen dichten Kreis, der immer enger wurde durch das Herandrängen der zuletzt Gekommenen. Bald standen sie dicht an der Leiche, ein paar bückten sich nieder, sie anzufassen. Der Arzt trieb sie aber davon.
Doch der Bürgermeister ward plötzlich wütend, nahm den Stock des Doktors Labarbe, warf sich auf die Leute und rief:
– Macht, daß ihr weiterkommt! Macht, daß ihr weiterkommt! Macht, daß ihr weiterkommt, ihr Lumpengesindel!– Und in ein paar Augenblicken hatte sich der Kreis der Neugierigen um zweihundert Meter erweitert.
Die alte Roque hatte sich aufgerichtet, herumgedreht, saß nun da und weinte, die Hände vor das Gesicht geschlagen.
In der Menschenmenge wurde der Fall besprochen, und gierige Knabenaugen betrachteten den entblößten Leib. Renardet bemerkte es, zog plötzlich seinen Leinenrock aus und warf ihn über das Mädchen, das unter dem großen Kleidungsstück ganz verschwand.
Langsam kamen die Neugierigen näher. Der Wald war voller Menschen, ein unausgesetztes Stimmengewirr stieg zu den Blätterkronen der Bäume empor.
Der Bürgermeister blieb in Hemdärmeln stehen, den Stock in der Hand, in Kämpferstellung. Er schien über die Neugierde der Bevölkerung verzweifelt zu sein und rief unausgesetzt:
– Wenn einer 'rankommt, schlage ich ihn nieder wie einen tollen Hund.
Die Bauern hatten große Angst vor ihm und hielten sich entfernt. Doktor Labarbe rauchte und setzte sich neben die alte Roque und sprach ihr zu, indem er ihre Gedanken abzulenken suchte.