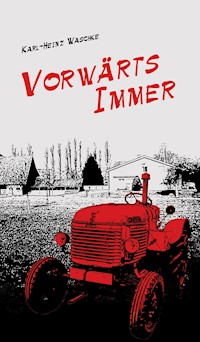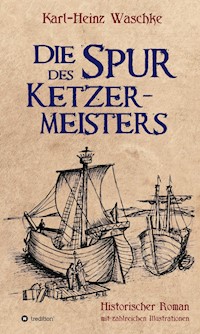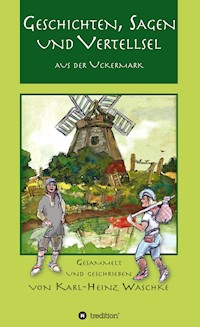
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Karl-Heinz Waschke lebt in Prenzlau. Vierzig Jahre unterrichtete er Schüler und war nebenbei noch als Volkskorrespondent für die Presse tätig. Nach der Wende schrieb er fünf Romane und zahlreiche Kurzgeschichten und erarbeitete eine dreibändige Chronik für das Dorf Eickstedt. In diesem Buch recherchierte er über Windmühlen, erfand Geschichten, sammelte Sagen und trug auch plattdeutsche Texte von anderen uckermärkischen Autoren zusammen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
GESCHICHTEN, SAGEN UNDVERTELLSEL
AUS DER UCKERMARK
Gesammelt und aufgeschrieben von Karl-Heinz Waschke – einige weitere Texte sind von anderen Autoren –
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2017 Karl-Heinz Waschke
Projektbetreuung: Ka & Jott, Prenzlau
Umschlaggestaltung: Ka & Jott, Prenzlau unter Verwendung einer Vorlage von Monika Oertel, Berlin
Illustrationen und Titelbild: Regina Libert, Prenzlau
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Paperback: 978-3-7439-3666-9
ISBN Hardcover: 978-3-7439-3667-6
ISBN E-Book: 978-3-7439-3630-0
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
INHALT
Um Windmühlen und Müller ranken sich Bräuche und Sagen
Ein Heros des Volkes
Feierabend angezeigt
Die Dolchower Mühle
Aktive Dirnen
Der Mahlstein
Böser Müller
Geschichten aus der Caselower Heide
De Uphak
Der Ruhelose
Die Glocke von Seelübbe
An’d Graww an den’n Lop up de Welt henwiest
Von Puks, Schmied und Schweinemist
Hochgesang des Schulmeisters
Anekdoten aus der Uckermark
Ein tüchtiger Kerl
Pastor Herings Frühstücksschoppen
Warum Pastor Hering seinen Solo nicht gewann
Wie Pastor Hering von der Kanzel in Brüssow „Trumpf raus“ rief
Die plattdeutsche Mundart lebt
De witt Zick
Een uprägend Dag
Herbst
Werrer Trabbel mit de Stern
Schön Anning un de Röwers
Geflügelte Worte
Aus dem Leben
Die Geschichte von Plenen
Hoffnung
Een schön Abend noch
Wat en as Schoolinspekter belewen kann
Lebenswege
De Football hett ’n Drall
Ein Ungeheuer am Radberg
Absolut
Is uns Kadl een Verbrecher
Een Toväl
De dröge Grund
Drei amüsante Schulgeschichten nach Pastor Sydow
Eins so lange ausspannen
Die Denkübung
Küster Kunze – ein Dichter
Sprichwörter
Dies & Das
Watt müdd, dat müdd
Wintertied
De verköpt Dunner
Arndt nimm!
Der Markgraf un de Eierfrau
Markgraf un de Prester in H.
De olle Fritz un Zieten in de Uckermark
Bauer Kiwitt
Ein Stern
De Badhos is weg
Das Perdeei
Koboldglaube
Wie die Familie Z. zu ihrem Kobold gekommen ist
Patenwünsche
De oll Bröker und de Dörpbengels
De Spegel segg’t di war
Ein Ruf
De Spitzboow
Dat weer man blot een Irrtum west
De geheim Vertellsel
Einsamkeit
Awer anders ging dat nich
De Silvesterschock
Weihnachtswunsch
De 80. Geburtstag
As ik noch’n Jung weer
Wer war ein Bürger?
„Den Uckermärker gibt es nicht“
Zwölf Kerzen
UM WINDMÜHLEN UND MÜLLER RANKEN SICH BRÄUCHE UND SAGEN
Der legendäre Müller Pumpfuß trat in den seltsamsten Vermummungen auf, und man sagte ihm Hexerei nach. Auch wenn es sie nur noch in recht wenigen Exemplaren gibt. Auf windumspielten Höhen thronend, oft liebevoll restauriert und eigentlich noch intakt, ranken sich nach wie vor erzählens- und erhaltenswerte Bräuche, Historien und Sagen um die Windmühlen und Müller. Im Gegensatz zu den Wassermühlen überschauten die Windmühlen meist das Land oder reckten ihr graues Gebälk vor den Stadttoren in die Höhe. Seit Jahrzehnten ist es still geworden um sie. In einem Vers heißt es:
Die Räder stehen still, sind morsch und bemoost, die sonst so fröhlich herumgetost,Dach, Gäng und Fenster alle in drohendem Verfalle.
Da oder dort sind noch Fragmente zu finden. Ein zerlegter Bock, Stücke von hölzernen Radkränzen, aber auch stolze Mühlen, heute oft umfunktioniert, lassen die einstige Mühlentechnik erahnen. Geschichtliches dazu, wie die Mahlsteine und Mahltröge der Vorzeit, die wendischen Handmühlen, die Tretmühlen bis hin zur Rossmühle als eine Deichselergänzung, finden sich in den Heimatstuben und Museen.
In der Historie ist verbrieft, dass das Mahlgeschäft die Arbeit der Sklaven, Leibeigenen und der Weiber war, eines freien Mannes unwürdig. Bis zum Müller, der als ein „halber Beamter“ des Grundherren tätig war, und zum angesehenen Müllermeister in der Gesellschaft war es noch ein langer Weg. Die Mühle selbst ist alt, sehr alt. Schon in der Helgi-Sage berichtet die germanische Edda, dass Helgi auf der Flucht vor Hunding sich nicht anders verbergen konnte, als dass er in die Kleider einer Magd schlüpfte und in der Mühle zu mahlen begann und so als Königssohn seinen Häschern entkommen konnte. Erinnert sei auch daran, dass bereits Abraham seinen Gästen Kuchen aus dem feinsten Mehl backen ließ. Das Manna ward wie Getreide gemahlen.
EIN HEROS DES VOLKES
Durch die Entlegenheit so mancher Mühlen rankten sich naturgemäß schon frühzeitig Sagen um sie. Dazu gehört in der ganzen Uckermark der populäre Müller Pumpfuß, der in den seltsamsten Vermummungen auftrat und „mehr als Brot essen konnte“. Eigentlich, so heißt es, hatte er einen gutmütigen Charakter und half bedrängten Kollegen, die ihn als ein übernatürliches Wesen verehrten. Er war ein reiner Hexenmeister, ritt auf Heupferdchen durch die Luft, machte Mäuse und setzte aus einem Nasenloch blasend alle Windmühlen in Bewegung.Es war einmal ein Mann, der hieß Pumpan. Pumpan hieß er, starke Winde blies er.
Der Müller Pumpfuß war als der Heros des Landvolkes zu sehen, das sich an seinen Späßen ergötzte. Doch die Gestalt selbst hat eine tiefe mythologische Bedeutung. Denn unschwer ist in ihr der germanische GottWodanzu erkennen; verwischt zwar durch allerlei christliche Züge. Wie alle Handwerksleute der damaligen Zeit hatten auch die Müller ihre Zünfte und Innungen, in denen besondere Bräuche und Sitten herrschten, die auch streng beachtet wurden. Die Innungsprivilegien des Prenzlauer Gewerkes aus dem Jahre 1747 beinhaltenunter anderem auch das Zeremoniell, in das die feierliche Aufnahme als Geselle (Freibursch) festgeschrieben war. Darin heißt es: „Jetzt wird Dir das Schurzfell vorgebunden durch meine Hand. Damit kannst Du reisen durch Stadt und Land. Du sollst helfen, arbeiten Campräder und Wellen. So wird man dich heißen einen Müllergesellen. In Ehren wird es Dir vorgebunden zu Hand. Hüte Dich, dass Dirs nicht abgebunden werde zur Schand. Gott gebe Dir Glück zum Gesellenstand! Damit reis’ und arbeit’ in manchem Land!“
FEIERABEND ANGEZEIGT
In den Wanderjahren erlebte der Freibursch so manches. Dabei erzählte bereits die Flügelstellung der Mühlen dem Müllergesellen, was dort zu erwarten war. Weithin war die Mühle nicht nur ein Wetterprophet, sondern sie verkündete den Umwohnenden auch Freud und Leid der Müllerfamilie, Arbeits- und Ruhezeit der Mühle. Vier verschiedene Flügelstellungen wurden dazu verwand. Es gab die Freuden-, die Trauer-, die Feierabend- und die Mühlentrauer In der Trauerstellungwaren alle vier Flügel auch von der Rückseite der Mühle sichtbar. Sie bildete ein liegendes Kreuz. Trugen die Flügel Fähnchen, so hieß das, im Dorf wird ein Fest gefeiert. War dagegen jemand in der Mühle gestorben, so trat die Trauerstellung. Sie blieb, solange die Leiche über der Erde war. Während des Trauerjahres wurden abends die Mühlen immer wieder in die entsprechende Lage gebracht. Sonst stand sie am Abend in der Feierabendstellung. War die Mühle dagegen überhaupt nicht in Betrieb, dann herrschte Mühlentrauer.
DIE DOCHOWER MÜHLE
Von einem Dorf ist wenigstens noch ein Haus übrig geblieben. Die einstige Dorfstelle wird durch die Lage der Dochower Mühle gekennzeichnet. Verwehtes Leben! Hören wir auf die ganz leisen und verwehenden Klänge aus der Vergangenheit.
In dem Dorf Dochow hat früher ein sehr geiziger Bauer gelebt. Seine Freunde und Feinde nannten ihn den Scheck. Das taten sie, weil er in seinem schwarzen Haar eine weiße Strähne hatte. Sie hatten auch einen Vers aufihn gedichtet: „Der Scheck frisst seinen eigenen Dreck!“ So hieß es. Das mochte wahr sein, war aber sicher nicht nett. Eines Tages sind dem Bauern Scheck durch eine Krankheit oder sonst etwas gleich drei Kühe auf einmal gefallen. Was bedeutete dieser Verlust dem geizigen Bauern? Jammernd und klagend ging er durchs Dorf und erzählte jedem, ob er es hören wollte oder nicht, dass es mit ihm zu Ende sei. So traf er auf seinem Jammerweg auch auf einen fremden Mann. Auch dem klagte er sein Leid. Der Fremde griff, als er alles vernommen hatte, wortlos in seine Tasche und holte eine Handvoll harter Taler heraus, bot sie dem Bauern an und sagte: „Ich will dir armen Mann helfen. Dir das Geld geben, damit du dir neue Kühe kaufen kannst. Nur – nach fünf Jahren musst du mir das Geld wiedergeben, sonst wirst du samt dem Dorf großen Schaden erleiden!“
Diesem Angebot konnte unser Bauer nicht widerstehen. Eilig lief er mit dem Geld nach Hause und legte es zu den übrigen Talern in seiner Lade. Er hätte das Geld ja gar nicht gebraucht, doch der Geizteufel ließ ihm keine Ruhe. Als dann nach fünf Jahren die Zeit des Zurückzahlens herankam, überlegte der Geizkragen, was wohl am klügsten sei, um die Schuldenzahlung zu umgehen? Er überlegte sehr angestrengt. Endlich hatte er es. Er fuhr am Fälligkeitstag nach Prenzlau zu seinemVetter. Als er dann gegen Abend nach Hause fuhr, sah er schon von weitem einen hellen Schein am Himmel. Als er weitergefahren war, konnte er ganz deutlich erkennen, dass der Rote Hahn über seinem Dorf stand. Vergebens peitschte er auf seine Pferde ein. Er konnte nichts retten. Als er in Dochow ankam, musste er sehen, dass von allen Häusern nichts mehr, wahrhaftig gar nichts mehr stand. Die Feuersbrunst hatte alles verschlungen. Das Dorf ist auch niemals wieder aufgebaut worden.
Lieder, wieEs klappert die Mühle am rauschenden BachoderIn einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlradsowie zahlreiche Märchen, Sagen und Geschichten, romantisch verklärt, geheimnisvoll, bösartig oder auch liebevoll menschlich ranken sich um die Wasser- und Windmühlen. So erzählt u. a. ein uraltes nordisches Lied von den Riesentöchtern Fenja und Menja, die dem König Froto in seiner Mühle Grotti Gold, Frieden und Glück mahlen mussten. Das gelang allerdings verständlicherweise nur unvollkommen, zumal die Riesinnen mitsamt der Mühle von dem feindlichen König Myfinger geraubt und auf ein Schiff genommen wurden, um hier Salz zu mahlen. Historiker meinen, dass es sich um eine Form der Handmühlen gehandelt haben müsse. Ähnliche Mühlen sollen nach Aussagen von Mühlenforschern sogar noch im19. Jahrhundert im Baltikum zum Einsatz gekommen sein. Eine andere Mühle ist die Schiffsmühle. Sie stand auf verankerten Schiffen und wurde durch das fließende Wasser betrieben. Es heißt, sie wurde durch die Römer nach Deutschland gebracht. Bischof Fortunatius von Postiers erwähnt sie im sechsten Jahrhundert mit den Versen „Wasser in Krümmen, gerührt durch unbiegsames Gerinne. Treibet die Mühle, dem Volke Speise zu schaffen.“
AKTIVE DIRNEN
Die Wassermühle ist mit Sicherheit aus dem asiatischen Raum ebenfalls von den Römern mit nach Deutschland überbracht worden. Die Bauern ließen ihr Korn in der Mühle vom Müller mahlen. Bezahlt wurde mit einem Teil des Mehls. Die Historie berichtet: „Oft kamen an der Mühle so viele Leute zusammen, dass lange Wartezeiten entstanden. Das nutzten zahlreiche Dirnen aus. Sie versuchten, unter den Wartenden Kundschaft zu finden. Das nahm der einflussreiche Zisterzienserabt Bernhard von Clairvaux im 12. Jahrhundert sogar zumAnlass, damit zu drohen, die Mühlen schließen zu wollen. Eine harte Last hatten in dieser Epoche nicht nur die Müllerknechte zu tragen, sondern auch die Bauern, die zum Teil in eine harte Fron getrieben wurden, da die Erde, das Wasser und im Nachhinein auch noch der Wind als landesherrlicher Besitz beansprucht wurden. Relativ leicht ging das bei einer Wassermühle, denn der Wasserlauf konnte in jedem Falle gut überwacht werden und bei etwaigem Widerspruch und bei Streitigkeiten, wenn nötig, sogar umgeleitet werden. Doch wer wollte dem Wind vorschreiben, wann, woher und wohin er zu wehen hat? Deshalb, und um sich ein Privileg zu verschaffen, erklärte 1390 der Bischof von Utrecht in Holland kurzerhand den Wind der ganzen Umgebung für sein Eigentum. Mit der Kolonisation und Besiedlung der Ostgebiete wurden zunächst, meist im Schatten der Wälder versteckt, die Wassermühlen eingeführt. Sie, wie auch später die Windmühlen, waren oft Gegenstand von Auseinandersetzungen und Zerwürfnissen zwischen Landes- und Grundherren sowie mit den Städten, denn Mühlen stellten einen echten, messbaren Posten im Etat des Besitzenden dar. So sind die Mühlen in jener Zeit durchaus als ein Politikum anzusehen, das in das gesellschaftliche Leben und wirtschaftliche Geschehen eingriff, und das nicht immer gerade zu Nutz undFrommen der „kleinen“ Leute. Aus der Geschichte ist neben dem Mahlzwang, der die Bürger und Bauern anhielt, ihr Korn nur in einer bestimmten Mühle mahlen zu lassen, auch als das Mitzen bekannt. Eine Kontrolle gab es nicht. So konnte der Müller heimlich von jedem Scheffel (41,66 Kg) eine Metze (4,17 Kg) abstreichen. Auch die gesellschaftliche Stellung des Müllers als ein „halber Beamter“ des jeweiligen Grundherren, dem das Korn umsonst gemahlen wurde, der auch nicht selten seine jungen Hunde, Hühner und Gänse auf dem Mühlenhof aufpäppeln ließ oder auch ältere, ausgediente Haustiere dort unterbrachte sowie die meist abseitige Lage der Mühle, die Vererbbarkeit der Mühle an seine Kinder und andere gewinnträchtige Geschäfte wie das Brotbacken oder auch die Kruggerechtigkeit trugen nicht dazu bei, die vorhandene Zurückhaltung abzubauen und das schon berechtigte Misstrauen zu beseitigen sowie den Ruf des Müllers im Volksmund des Mittelalters zu bessern. In so manchen Schriften und Liedtexten jener Zeit ist er in die Reihe der „unredlichen“ Leute, gemeinsam mit den Schneidern und Webern anzutreffen. So ist nachzulesen: Auf einen Müller als Stammbaum pfropft man einen Leineweber und Schneider als Äste. Oder: Müller, Schneider und Weber werden nicht gehenkt, das Handwerk ging sonst aus.
Das Spottlied:
Der Müller mit der Metze,
Der Weber mit der Krätze,
Der Schneider mit der Scher,
Wo kommen die drei Diebe her?
Es trifft hart, zumal sich sicher unter diesen Ständen überwiegend arbeitsame, ehrliche und ehrenwerte Handwerker mühten, das tägliche Brot für sich und die Familie zu verdienen. Ein Grund für die vielfältigen Sagen, gleichwohl ob in den Wasser- und Windmühlen mit meist unheimlichen Begebenheiten und der Schaffung des TypusPumpfuß, Pumphut, Pumphanin der Person des Müllers, ist wohl auch in der Tatsache zu suchen, dass einst, als die Leitung der Mühlen von Leibeigenen ausgeübt wurde, ein Verbrecher sich der strafenden Gerechtigkeit durch die Flucht in eine Mühle, die schon lange Zeit ein bestimmtes Asylrecht hatte, entziehen konnte. DerPumphut, der bald tolle, aber gutmütige Streiche vollführt oder als unheimlicher Zauberer sein Wesen treibt, zeigt sich in vielen Begebenheiten. So auch in der folgenden.
DER MAHLSTEIN
Ein Müller, der mit seinem Gesellen einen neuen Mahlstein einsetzen wollte, saß zur Mittagszeit vor der Mühle, aß und trank ausgiebig. Da kam ein Müllerbursch vorbei: „Einen schönen guten Tag wünsch ich!“ „Den können wir schon brauchen!“, sagte der Geselle. „Wir wollen einen neuen Mahlstein einsetzen.“ Aber der Meister fuhr den fremden Burschen grob an: „Gaff du nicht so herum und lass uns in Ruhe essen.“ Der Wanderer ging weiter, ohne sich umzudrehen. „Meister“, sagte der Geselle, „wenn das der Pumpfuß war?!“ „Hör auf mit seinem Geschwätz und lass uns endlich arbeiten!“ Sie begannen also, den Mahlstein einzusetzen, aber er wollte und wollte nicht passen. Einmal war er zu groß, dann wieder zu klein. „Der Pumpfuß will uns damit bestimmt strafen, weil du so unfreundlich zu ihm warst!“, sagte der Geselle. „Geh, hole ihn zurück“, besann sich der Müller. Der Geselle brauchte nicht lange zu laufen, da hatte er den Burschen eingeholt. Er lud ihn ein, zurück zur Mühle zu kommen. Hier spürte er Freundlichkeit und schaute dabei noch einmal genau auf den Mühlstein. Der Müller und sein Geselle begannen wieder mit der Arbeit, und siehe da, der Stein passte.
Das Beil und der wunderbare Hut dieser Sagengestalt, aus dessen Ecken auch die Kugeln nur so fliegen konnten, erinnert an einen germanischen Gott, der in der Gestalt des wilden Jägers in seinem Gefolge auch den Müller aufgenommen hat, andererseits allerdings auch als leibhaftiger Gottseibeiuns das Mitzen bestraft. In einem alten Spruch heißt es: Miss das Korn nur richtig, Ein Pumpfuß guckt zum Dach herein.“ Sehr oft taucht er als Retter auf, der die bösen Geister bekämpft, die sich in der Mühle niedergelassen haben. Dazu zählen zum Beispiel die elbischen Wesen, die Wassergeister und die bösen Dämonen, die in der Mühle Unfug treiben und den Menschen Schaden zufügen.