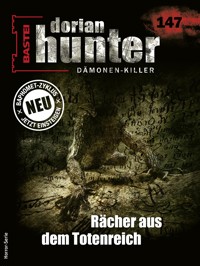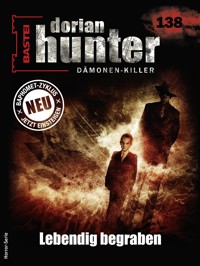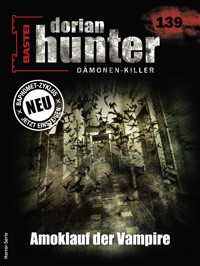1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Der Kutter plagte sich mühsam durch die von achtern auflaufenden Wellen. Der Morgen brach bereits an. Giorgios, Alexandros und Alexis standen an der Reling des kleinen Fischkutters, während Nikos auf der Brücke steuerte. Eine harte Nacht lag hinter ihnen, aber der Fang war gut gewesen.
Giorgios zog die flache Flasche aus der Gesäßtasche. "Nehmt einen Schluck, Kameraden. Eine Dreiviertelstunde noch, dann sind wir zu Hause. Ich sehne mich nach meinem Bett und meiner Lena." Er grinste anzüglich, und Alexandros wollte gerade einen rauen Witz machen. Da deutete Alexis nach Osten.
"Da, seht doch nur! Seht!" Entsetzen stand in seinem Gesicht.
Seine Kameraden sahen wie er den bleichen Schimmer. Er kam näher, und dann erkannten sie die Figuren, die ihn verbreiteten. Drei Knochenmänner waren es, auf Pferdeskeletten sitzend ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 154
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Boten des Unheils
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati / BLITZ-Verlag
eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 9-783-7325-9930-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Boten des Unheils
von Earl Warren
Der Kutter plagte sich mühsam durch die von achtern auflaufenden Wellen. Der Morgen brach bereits an. Giorgios, Alexandros und Alexis standen an der Reling des kleinen Fischkutters, während Nikos auf der Brücke steuerte. Eine harte Nacht lag hinter ihnen, aber der Fang war gut gewesen.
Giorgios zog die flache Flasche aus der Gesäßtasche. »Nehmt einen Schluck, Kameraden. Eine Dreiviertelstunde noch, dann sind wir zu Hause. Ich sehne mich nach meinem Bett und meiner Lena.« Er grinste anzüglich, und Alexandros wollte gerade einen rauen Witz machen. Da deutete Alexis nach Osten.
»Da, seht doch nur! Seht!« Entsetzen stand in seinem Gesicht.
Seine Kameraden sahen wie er den bleichen Schimmer. Er kam näher, und dann erkannten sie die Figuren, die ihn verbreiteten. Drei Knochenmänner waren es, auf Pferdeskeletten sitzend …
Sie ritten ein Stück über dem Wasser und kamen schnell näher. Sie schwangen Schwerter und bleckten ihre Zähne in einem fürchterlichen Grinsen.
Die drei Fischer wurden blass. Für mindestens einen von ihnen ritt von Osten der Tod heran, das wussten sie. Die anderen drei Kutter lagen leewärts hinter ihnen. Von dort konnte ihnen keiner helfen.
Giorgios fiel auf die Knie und flehte den Himmel um Hilfe und Errettung an. Alexandros flüchtete auf die Brücke zum Kapitän Nikos. Sein lautes Geschrei machte diesen auf die Knochenreiter aufmerksam. Alexis aber packte einen Bootshaken.
Breitbeinig stand er da, voller Angst zwar, aber bereit, sich zur Wehr zu setzen.
«Nikos!«, schrie Alexandros, so laut er konnte. »Sie sind es, die Knochenreiter der Lamia. Die Vorzeichen haben sich erfüllt, sei uns der Himmel gnädig.«
Nikos öffnete ihm die Tür zur Brücke und stellte die automatische Steuerung ein. Er holte die Signalpistole aus dem Fach rechts vom Steuerrad und stopfte eine Leuchtkugel hinein.
Sein Gesicht war verzerrt und angespannt.
Dann hatten die Knochenreiter den alten Fischkutter erreicht. Wie die Wilde Jagd fegten sie über ihn hinweg, umkreisten den Kutter und fuchtelten mit den Schwertern. Dabei stießen sie schrille, pfeifende Töne aus.
Der Wind trug sie davon, zu den anderen Kuttern hinüber, die nun stoppten. Gebannt blickten die Besatzungen auf das makabre Schauspiel.
Wen würden die Knochenreiter wählen? Nikos, Giorgios, Alexandros oder Alexis? Oder gar zwei oder drei?
Die grauenvollen Reiter kamen nun aus der Luft an Bord. Dumpf pochten ihre Hufe auf dem eisernen Deck. Alexis stieß mit dem Bootshaken nach dem vordersten Knochenreiter und traf ihn. Der Haken fasste eine beinerne Rippe, und Alexis riss wuchtig daran, um den unheimlichen Reiter von seiner knöchernen Mähre zu reißen.
Er sah in die schwarzen, leeren Augenhöhlen des Grauenvollen. Die beiden anderen Knochenreiter packten den aufschreienden Giorgios. Sie rissen ihn hoch.
»Gnade!«, rief der dickliche Fischer. »Gnade!«
Die Knochenreiter hörten nicht. Der eine, den Alexis vom Pferderücken reißen wollte, schwang das Schwert. Mit einem Streich schlug er die Stange des Bootshakens durch. Alexis taumelte zurück, stolperte über eine Taurolle und setzte sich unsanft auf sein Hinterteil.
Das rettete ihm das Leben. Das Schwert des Knochenreiters pfiff über ihn hinweg. Der Beinerne kümmerte sich nicht weiter um ihn. Sein Pferd erhob sich in die Lüfte, so als laufe es auf einer Treppe.
Der Knochenreiter folgte seinen beiden unheimlichen Gefährten, die Giorgios gepackt hatten und ihn zwischen ihren Pferden durch die Luft entführten. Sie ritten nach Südosten, auf die Insel Polyaigo zu. Kapitän Nikos polterte jetzt die eiserne Treppe von der Brücke herunter, die Leuchtpistole in der Faust.
Giorgios schrie aus Leibeskräften. »Kameraden, helft mir, Kameraden! Ich will nicht von der Lamia zu Stein verwandelt werden, ich will nicht! Bei meiner Frau und meinen beiden kleinen Kindern, so helft mir doch!«
Sein Geschrei wurde leiser, der Wind trug es davon. Nikos schoss die Signalpistole ab, und die Leuchtkugel fauchte in den Himmel. Sie raste genau auf die Gruppe der drei Unheilsreiter und den schreienden Mann zu. Aber dann änderte sie ihren Kurs und zerplatzte genau über ihnen.
Die Leuchtkugel erhellte die sterbende Nacht. Noch deutlicher als zuvor sah man die Knochenreiter und Giorgios in ihrem Schein. Aber nicht lange, denn die Knochenreiter entfernten sich schnell.
Giorgios' Schreie verklangen. Ein bleicher Schein näherte sich der Insel Polyaigos. Kapitän Nikos setzte die speckige Mütze ab.
»Die Lamia hat wieder ein Opfer gefordert«, sagte er. »Die Zeit des Schreckens beginnt von Neuem. Giorgios Kantzakis war der Erste. Wie viele werden ihm noch folgen müssen?«
Die drei Männer sahen sich an. Auch auf den anderen Fischkuttern schwiegen die Männer fassungslos und betroffen. Im Osten tauchte die Sonne aus dem Ägäischen Meer, ließ den Himmel rot erglühen und sandte die ersten Strahlen des Tageslichts herüber.
Aber den Fischern war es, als werde es dunkel. Denn eine Zeit der Finsternis und des Grauens erwartete sie, wie ihre Vorväter sie schon so oft erlebt hatten.
†
»Kimolos!«, rief Ken Becker vom Steuerstand auf der Flybridge herunter.
So ähnlich musste sich Kolumbus angehört haben, als er Amerika entdeckt hatte. Ich sah nach vorn und kniff die Augen zusammen, denn das grelle Sonnenlicht ließ unzählige Spiegelreflexe auf dem Wasser glitzern. Ich sah einen schmalen, dunklen Streifen.
Das war also Kimolos, eine der 211 Kykladeninseln, unser nächstes Ziel. Die anderen amüsierten sich gut, aber ich war schlechter Laune. Ich wünschte jetzt schon, ich wäre nach Florida oder sonst wohin geflogen, statt mich mit Ken Becker und der anderen Clique an Bord der Yacht Arkadia zu begeben.
Aber das ließ sich nun nicht mehr rückgängig machen. Frank Stone, Jean Morton, Kate Bailey und ich lagen auf dem Vorschiff, um unser tägliches Quantum Sonne zu tanken. Die elegante Yacht schnitt durch die Wellen.
»Endlich wieder fester Boden unter den Füßen«, sagte Jean. »Mir ist schon ganz schummrig von dem Seegang.«
»Das ist noch gar nichts«, sagte Frank Stone. »Du müsstest erst einmal einen Sturm bei Windstärke zwölf mitgemacht haben. Im letzten Jahr vor den Bahamas, da sah es sehr kritisch aus. Unverhofft war ein Sturm aufgekommen, und die Wellen gingen beinahe haushoch. Unsere Hochseeyacht schlingerte auf den Wellen wie ein Stück Kork.«
Eine lange Geschichte folgte, in der Ken Becker und Frank Stone die Hauptrolle spielten. Stone war genauso ein Angeber wie Becker. Wenn man ihm zuhörte, konnte man ihn für eine Kreuzung aus Seeteufel Graf Luckner und Sir Francis Chichester halten, der allein die Welt umsegelt hatte.
Nur dass Becker und Stone eine Klasse besser waren, selbstredend. Die beiden Mädchen hörten gespannt zu und gaben immer wieder bewundernde Laute von sich.
Ich musste mich zusammennehmen, um Stone nicht in die Parade zu fahren. Ich fragte mich, ob es die leichte Seekrankheit war, die mich so mürrisch und kritisch machte. Aber ich hatte Zweifel daran.
Ken Becker und Frank Stone waren völlig anders als ich, Mark Terrell aus Philadelphia. Ich war nie auf Rosen gebettet gewesen und hatte gerade mit viel Mühe meinen Doktor der Medizin gemacht. Norma Hyde, meine Freundin, hatte diese Urlaubskreuzfahrt in der Ägäis für uns beide arrangiert.
Zunächst hatte es sich sehr verlockend angehört, mit einer Gruppe von sechs jungen Leuten auf einer Yacht die Inselwelt der Ägäis zu durchkreuzen. Ein freies, ungebundenes Leben schwebte mir vor. Wo es uns gefiel, da wollten wir ein paar Tage bleiben, wollten tauchen, schwimmen, Spaß haben oder einfach in der Sonne liegen und faulenzen.
Norma Hyde kannte Jean Morton und Wendy Bishop, das vierte Mädchen an Bord. Jean und Wendy waren wieder mit Ken Becker und Frank Stone befreundet, und so kam alles zustande.
Leider hatte ich Ken und Frank erst in Athen kennengelernt, im Hafen von Piräus, als schon alles perfekt war. Da ich nun schon einmal den Flug von New York nach Athen investiert hatte und Norma nicht vor den Kopf stoßen wollte, ging ich also mit an Bord der gecharterten Yacht.
Der vorige Tag, an dem wir Idra angelaufen hatten, hatte mir eigentlich schon gereicht. Ken und Frank waren die typischen Playboysöhne reicher Eltern, arrogant bis auf die Knochen und davon überzeugt, dass sie meilenweit über den normalen Menschen stünden. Ich mochte sie nicht leiden, und sie mich auch nicht.
Ich nahm einen Schluck von meinem Whisky sour und sah zur Flybridge hinauf. Ken Becker machte sich mit seiner Kapitänsmütze und dem weißen Seglerhemd am Steuerstand sehr gut. Er sah blendend aus, groß, schlank, blond und braun gebrannt, wie er war, und er wusste das auch.
Frank Stone und er hätten aus einem Guss sein können, nur dass Frank braunes Haar hatte und braune Augen statt blaue.
Norma trat nun zu Ken auf die Flybridge. Ihre Silhouetten hoben sich keineswegs scharf umrissen gegen den sonnenflimmernden Himmel ab. Ich musste die Augen anstrengen, um sie deutlich erkennen zu können, es gab zu viel Licht.
Aber ihr Lachen und ihre Stimmen hörte ich deutlich. Norma stand sehr dicht bei diesem Ken Becker, das erkannte ich immerhin deutlich.
»Lass mich steuern, Ken, ja, bitte.«
»Okay, Baby, wenn du es willst. Pass auf, ich erkläre es dir.«
Und dann hatte Norma das Steuer in der Hand, und der große Kapitän gab Anweisungen. Er legte lässig den Arm um ihre Hüfte. Norma trug Jeans und eine durchsichtige Bluse, denn sie wollte in den ersten Tagen nicht zu viel Sonne abbekommen, damit sich die Haut nicht schälte. Immerhin hatten wir sechs heiße Wochen vor uns.
Unter der Bluse hatte sie nichts an. Sonst störte mich das nicht, im Gegenteil. Norma war Fotomodell und konnte sich zeigen. Aber an diesem Tage ärgerte es mich, wie sie sich zur Schau stellte und mit diesem Ken Becker herumflirtete.
Ich wollte nicht grundlos eifersüchtig sein, aber ich hatte eine böse Vorahnung.
»Das ist unser Kurs«, sagte Ken Bekker gerade. »Siehst du hier die Linie am Kreiselkompass? So musst du steuern.«
Ich nahm mein Glas und ging unter Deck in den Salon. Takis Karelli, der griechische Bootsmann, Mädchen für alles an Bord, stand hinter der Bar. Wendy Bishop saß auf der langen Sitzbank an der Leeseite.
Sie war rothaarig und hatte eine beachtliche Figur. Wie die brünette Jean Morton war sie ein Playgirl. Kate Bailey stammte aus irgendeinem Nest im Mittleren Westen. Ich hielt sie für ein Gänschen, das noch eine Menge lernen musste.
Über Norma konnte ich mir nicht klar werden. Einerseits liebte ich sie leidenschaftlich, und unser Verhältnis dauerte schon über ein Jahr. Andererseits gab mir vieles zu denken. In der letzten Zeit, kurz vor und beim Examen, hatte ich zu viel büffeln müssen, um einen klaren Gedanken fassen zu können.
Aber jetzt ging mir vieles durch den Kopf.
Ich stellte den lauwarmen Whisky auf die Bar, und Takis schüttete ihn weg. Ich ließ mir eine Cola geben, denn ich wollte nicht schon am Nachmittag benebelt sein. Vielleicht wäre es aber besser gewesen, wenn ich das gewesen wäre.
Von oben, durch den Ausstieg zur Flybridge, hörte ich Normas Lachen und Ken Beckers Stimme. Sie schienen sich prächtig zu amüsieren.
»Na, wie gefällt es dir an Bord, Mark?«, fragte Wendy und rückte näher, kaum dass ich mich niedergesetzt hatte.
Ich zuckte mit den Schultern.
»Du bist so ganz anders als Ken und Frankie«, gurrte sie. »Stimmt es, dass du ein richtiger Arzt bist?«
»Ich habe vor nicht einmal vierzehn Tagen mein Examen gemacht. Ja, ich bin Arzt, aber ich habe noch eine Menge zu lernen. In der Hauptsache, was Medizin angeht«, fügte ich hinzu, als ich ihren Gesichtsausdruck sah.
Wir unterhielten uns eine Weile. Sie fühlte mir auf den Zahn, wie man so sagte. Ich antwortete ruhig und gelassen. Wir sprachen über die Yacht, die wirklich ein Prachtstück war, über das Meer, die Sonne und die Ägäische Inselwelt.
»Wir laufen jetzt im Hafen von Kimolos ein«, rief Ken Becker herunter.
Wir sahen aus den getönten Fenstern das Salons, in dem es vorn auch einen Steuerstand gab, eine Kommandobrücke in Kleinausgabe, aber ausgezeichnet ausgestattet.
Die schnittige Arkadia verfügte über alles. Zwei Steuerstände, Radar, Echolot, Radiotelefon, Generator, zwei 275-PS-Diesel-Motoren. Es gab zwei Waschräume mit Dusche und WC, fließend Heiß- und Kaltwasser, sieben Kabinenschlafplätze, eine Stereoanlage und vieles andere. Alles in allem kostete die elegante Kunststoffyacht mit dem Stahlkiel neu stolze hundertachtzigtausend Dollar.
Ken Becker pflegte sie als Kahn zu bezeichnen. Seiner Familie gehörte eine viel größere und komfortablere Hochseeyacht. Er hatte die Arkadia gechartert, weil er nicht mit der Hochseeyacht den Atlantik überqueren wollte.
Natürlich ging es ihm dabei nur um die Zeit, wie er betonte. Ich betrachtete die Insel Kimolos, deren Küste nun näher rückte. Sehr groß war Kimolos nicht, aber die Berge im Landesinnern waren bewaldet, und so wirkte die Insel nicht so kahl wie viele andere.
Wir liefen nun in die natürliche Bucht ein, in der der Hafen der Stadt lag, die wie die Insel Kimolos hieß. Am Kai war niemand zu sehen. Fischkutter und ein paar Segelboote lagen vor Anker.
Die ganze Stadt, soweit man diese Ansiedlung von vielleicht fünfzehnhundert Menschen so bezeichnen konnte, war wie ausgestorben.
Das Funkgerät am Steuerstand im Salon erwachte nun zum Leben. Takis, der Bootsmann, ging hin und nahm die Meldung entgegen. Er sprach auf Griechisch mit jemandem, und er schien sehr befremdet zu sein.
Ich verstand etwas Griechisch, hörte aber nur mit halbem Ohr hin. Immerhin begriff ich, dass Takis sich zweimal vergewisserte, ob er auch richtig verstanden hatte. Er legte nun das Funkmikrofon auf die Konsole, ging zum Ausstieg und stieg zwei Stufen die Treppenleiter hinauf.
Er wandte sich in seinem stark akzentuierten Englisch an Ken Becker.
»Kapitän, die Hafenwache sagt, wir sollen wieder auslaufen. Die Insel ist für Fremde gesperrt.«
»Warum denn das?«
»Das hat der Hafenkommandant nicht gesagt. Er sagte nur, es sei besser für uns, und wir sollten vernünftig sein und weder Kimolos noch die Nachbarinsel Polyaigos anlaufen. Es gibt genug andere.«
»Verdammt noch mal, ich lasse mich doch nicht von so einem Fatzke ohne Begründung aus dem Hafen scheuchen. Frag ihn, was los ist, und wenn er keine vernünftige Antwort gibt, laufen wir einfach ein. Diese Fischfresser hier haben mir nichts vorzuschreiben.«
Ich stand auf, trat hinzu und sagte: »Vielleicht herrscht eine Seuche auf der Insel. Dann wäre es allerdings besser, wenn wir uns einen anderen Hafen suchten.«
Ken stellte nun den Motor ab, und in langsamer Fahrt glitten wir auf die Kaimauer zu.
»Na gut, Takis, frag den Hafenburschen das. Aber wenn es keine Seuche ist, laufen wir ein, und damit Schluss.«
Takis ging wieder ans Funkgerät. Er sprach kurz und heftig mit dem Hafenkommandanten.
»Keine Seuche«, sagte er dann zu mir. »Er will nicht sagen, weshalb sie uns hier nicht haben wollen.«
Ich gab die Nachricht an Ken Becker weiter. Mir kam es auch merkwürdig vor, dass uns keine Gründe angegeben wurden. Ken Becker legte am Längskai an. Er krachte dabei mit dem Heck unsanft gegen die Kaimauer, aber nicht fest genug, um mehr als eine kleine Beule am Boot hervorzurufen.
Aber ich merkte doch, dass es mit seinen Fähigkeiten als Bootsführer nicht so weit her war, wie er immer angab. Ich ging nun mit Wendy Bishop an Deck. Sie trug Hotpants und eine giftgrüne, auf der Brust zusammengeknotete Bluse.
Bei ihrer üppigen Figur wirkte das sehr sexy. Wir standen dann alle auf dem geräumigen Vordeck der Dreizehn-Meter-Yacht und blickten zu den zwei Hotels und den Häusern von Kimolos.
Kein Mensch war zu sehen. Takis sprang aufs Kai und machte die Yacht am Poller fest.
»Was für ein Nest«, sagte Jean Morton. »Hier klappen sie abends die Bürgersteige hoch.«
Sie hatte kaum richtig ausgesprochen, da flog die Tür eines kleinen Hafenlokals auf. Eine Frau rannte heraus, ein Bild in den Händen. Schluchzend lief sie auf den Kai zu. Drei Männer folgten ihr. Einer davon war fast noch ein Junge.
Die Frau erreichte den Kai. Ohne auf uns oder die Yacht zu achten, hielt sie das Ölgemälde empor, schwenkte es in südöstlicher Richtung, wo die Insel Polyaigos lag.
Ich hörte sie auf Griechisch immer »Nein, nein, nein« schreien. Ich konnte nicht viel von dem verstehen, was sie sagte, denn sie sprach zu schnell, schrill und erregt. Der Name Nikephoros kam in ihrer Rede wieder und wieder vor. Diesem Nikephoros sollte etwas nicht passieren, oder er sollte etwas nicht tun.
Es musste mit jemandem oder etwas namens Lamia zusammenhängen. Die Männer erreichten die Frau nun und versuchten, sie zu beruhigen. Aber sie beruhigte sich nicht. Nun drehte sie das große Ölgemälde um, sodass auch wir es sehen konnten. Ich war erstaunt, als ich es erblickte.
Das Ölgemälde zeigte einen Totenschädel, auf dessen Stirn in griechischen Buchstaben etwas geschrieben stand, ein Name wohl. Die Frau versuchte, den Namen wegzukratzen, aber es ging nicht. Sie trat an den Rand des Kais und warf das Ölgemälde ins Wasser.
»Nein, Lamia, nein, nein, nicht Nikephoros! Nimm nicht Nikephoros!«, flehte sie und rang die Hände.
Das Gemälde trieb mit dem Bild nach oben im Wasser. Ich beugte mich über das niedere Relinggeländer, und ich sah zu meinem Erstaunen, dass das Gemälde nicht mehr den Totenkopf zeigte. Vielmehr stellte es ein kitschiges Bild von Fischern beim Fang dar.
Hatte ich mich nun geirrt, oder hatte das Gemälde sich verändert? Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Halluzination gehabt, von dem einen Mal abgesehen, als ich glaubte, LSD probieren zu müssen.
Die Männer führten die völlig gebrochene Frau nun weg. Das Bild trieb an der Luvseite der Yacht direkt bei der Bordwand. Ich sah noch einmal über die Reling. Ohne Zweifel war jetzt von einem Totenkopf nichts mehr zu erkennen.
Sehr nachdenklich richtete ich mich auf.
†
Wenig später gingen wir von Bord, um uns in Kimolos umzusehen. Nur Takis Karelli blieb auf der Yacht. Wir anderen wanderten durch den Ort. Viel Fremdenverkehr gab es hier nicht. Die Touristen, die herkamen, waren hauptsächlich Griechen.
Nur wenige Menschen begegneten uns, und sie drückten sich scheu an uns vorbei. Wir wirkten in dieser wie ausgestorbenen Stadt wie Fremdkörper. Wendy Bishop trug ein Transistorradio am Griff, und die Klänge von Radio Athen schallten durch die verlassenen Straßen.
»Ein gottverlassenes Nest«, sagte Norma, »Wir sollten so schnell wie möglich wieder auslaufen.«
»Es ist schon zu spät«, antwortete Ken. »Morgen früh, ja. Aber über Nacht bleiben wir hier. Wir werden uns an Bord die Zeit schon vertreiben.«
»Vielleicht ist eine lokale Größe gestorben«, vermutete Frank Stone.