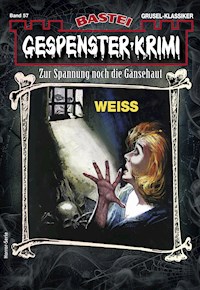1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Das Masthuhn weiß nicht, wie es sich anfühlt, geboren zu werden. Es wird im Brutautomaten produziert. Dort schlüpfen die Küken nach exakt einundzwanzig Tagen aus künstlich befruchteten und künstlich bebrüteten Eiern. Maschinen trennen die Küken von den Eierschalen. Maschinen sortieren kranke Küken aus. Maschinen vernichten diese.
Gesunde Küken werden verpackt und verladen. In Großstallungen mit rund vierzigtausend Tieren werden sie in exakt fünfunddreißig Tagen auf das fünfzigfache ihres Geburtsgewichts gemästet.
Das Masthuhn weiß nicht, wie es sich anfühlt, satt zu sein. Bei der Zucht wurde das Sättigungsgefühl ausgeschaltet. Damit das Skelett und das Herz-Kreislauf-System der Masthühner funktioniert, muss bei der Züchtung die Konstitution der Tiere gestärkt werden. Mehr Platz und Bewegung würden dafür sorgen, dass die hochgezüchtete Muskulatur besser durchblutet und das Herz-Kreislauf-System trainiert wird, was aber einen höheren Aufwand und mehr Kosten bedeuten würde. Und schließlich geht es doch nur um eines: Fleisch.
Der Mensch ist ein Wolf. Für ihn zählt nur das Fleisch ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Wolfshunger
Vorschau
Impressum
Wolfshunger
von Katharina Hadinger
Das Masthuhn weiß nicht, wie es sich anfühlt, geboren zu werden. Es wird im Brutautomaten produziert. Dort schlüpfen die Küken nach exakt einundzwanzig Tagen aus künstlich befruchteten und künstlich bebrüteten Eiern. Maschinen trennen die Küken von den Eierschalen. Maschinen sortieren kranke Küken aus. Maschinen vernichten diese.
Gesunde Küken werden verpackt und verladen. In Großstallungen mit rund vierzigtausend Tieren werden sie in exakt fünfunddreißig Tagen auf das fünfzigfache ihres Geburtsgewichts gemästet.
Das Masthuhn weiß nicht, wie es sich anfühlt, satt zu sein. Bei der Zucht wurde das Sättigungsgefühl ausgeschaltet. Damit das Skelett und das Herz-Kreislauf-System der Masthühner funktionieren, muss bei der Züchtung die Konstitution der Tiere gestärkt werden. Mehr Platz und Bewegung würden dafür sorgen, dass die hochgezüchtete Muskulatur besser durchblutet und das Herz-Kreislauf-System trainiert wird, was aber einen höheren Aufwand und mehr Kosten bedeuten würde. Und schließlich geht es doch nur um eines: Fleisch.
Der Mensch ist ein Wolf. Für ihn zählt nur das Fleisch ...
Januar 2020
Sie zogen ihre Runden. Rastlos und hungrig. Ein stählerner Himmel wölbte sich über das tiefgekühlte, weiße Land. Um das Aas scharrte sich ein Pulk schwarzer Vögel. Sie zerrten am Fleisch, hackten ihre grauen Schnäbel in die toten Leiber. Leopold Frey klammerte sich an die Brüstung der Aussichtsplattform. Seine Fingerknöchel traten weiß hervor. Er wusste nicht, wie lange er hier schon stand. Aber seine Füße und Hände waren taub vor Kälte.
Und die Wölfe zogen ihre Runden. Rastlos und hungrig.
»Warum?«, flüsterte Frey in die dichten weißen Wolken seines Atems.
Allein die Kälte konnte ihm keine Antwort geben. Niemand konnte das. Nicht einmal Antonio. Dabei war er klüger als alle Menschen, die Freys Lebensweg jemals gekreuzt hatten. Das altersschwache Knarzen der Holztreppe bohrte sich in Freys gedankenverhangenen Kopf. Lustlos blickte er über seine Schulter. Antonio hob sich die Hände vor das Gesicht und versuchte, sie mit seinem Atem zu wärmen.
»Es ist eiskalt, Professor.« Er sprach ihn noch immer so an. Aber heute war es das erste Mal, dass es Frey störte.
»Dann geh zurück ins Warme«, gab er unwirsch zurück.
Antonio legte den Kopf schief und bedachte ihn mit einem mitfühlenden Lächeln. »Wir sollten unseren Streit begraben«, sagte er sanft und streckte die Hand nach Freys Schulter aus, »Ihr Experiment war einzigartig, genial und auf eine Weise sehr erfolgreich. Aber es ist jetzt vorbei. Sie sehen es doch selbst ...« Antonio wies mit dem Kinn in Richtung der Brüstung, wo sich der Ausblick über das unruhige Wolfsrudel öffnete. Rastlos und hungrig.
Frey ballte die Fäuste.
»... Sie fressen nicht, Professor.« Antonio berührte ihn an der Schulter, bevor er seine Hand an Freys Arm hinabgleiten ließ und dessen Hand freundschaftlich umfasste.
Frey blickte hinab, sah zu, wie seine von Altersflecken bedeckten, dünnen Finger in den kräftigen, glatten Händen des Jüngeren verschwanden.
»Seien Sie doch vernünftig, Professor«, redete dieser weiter auf ihn ein. »Ich habe hart gearbeitet ...«
»Ich habe dir den Dienst aufgekündigt«, sagte Frey knapp.
»Meine Arbeit ist kein Dienst! Sie ist meine Passion!«, begehrte Antonio auf.
»Geh jetzt.«
»Dass Ihr Experiment gescheitert ist, Professor, bedeutet nicht das Ende.«
»Wenn es vorbei ist, dann ist das auch das Ende, Antonio! Basta!« Die Autorität in Freys Stimme hatte den Jüngeren zum Schweigen gebracht.
Es begann zu schneien. Unwillkürlich sah Frey zum Himmel. Warum sieht man zum Himmel, wenn es zu schneien beginnt? Als er den Kopf wieder senkte, prallte er erschrocken zurück.
Antonios Miene hatte sich verfinstert, seine buschigen Brauen bildeten einen schwarzen Balken über seinen dunklen Augen. Tiefe Schatten furchten seine jungenhaften Züge. »Sie sind ein Narr!«, fauchte er, »Mein Abstraktum unserer Arbeit ist der einzige Weg. Der richtige Weg. Der Weg zum Erfolg! Sie wissen das! Aber Sie weigern sich, mir den Raum dafür zu geben, weil Sie eifersüchtig sind. Ihr Experiment war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und im Grunde ist Ihnen das nur recht so. Fürchteten Sie, es würde erfolgreich sein?« Er schien tatsächlich eine Antwort zu erwarten. Aber Frey schwieg. Deshalb fuhr er fort. »Falls ja, dann gäbe es noch Hoffnung für Sie. Denn das hieße, Sie wären sich der Abartigkeit ihrer Forschung bewusst. Ihr Endprodukt sollte rein der Demütigung der Menschheit dienen. Wohingegen meine Ziele erstrebenswert und nutzbringend sind. Sie sind ein Misanthrop, Professor. Ich aber bin Wissenschaftler. Ich mag die Menschen!«
Antonio hatte leidenschaftlich gesprochen und ließ Frey mit der Versuchung, ihm auf die Schulter zu klopfen, zurück. Wieder einmal war er überwältigt von der Ausstrahlung des jungen Mannes. Er war nicht nur intelligent, sondern auch noch charismatisch. Er hatte alles. Frey hatte nichts mehr. Um dem eindringlichen Leuchten von Antonios Augen nicht länger standhalten zu müssen, wandte sich Frey schnell ab. Er hatte sich oft genug von diesem Tatendrang mitreißen lassen. Müde ließ er seinen Blick über das Gehege schweifen.
Sie zogen ihre Runden. Rastlos und hungrig. So hungrig. So müde. Schwer stützte sich Frey auf die Brüstung. Antonio redete noch immer auf ihn ein. Aber er hörte nicht mehr zu. Es war vorbei. Ende. Irgendwo tief in ihm begann ein Flämmchen zu lodern und wärmte seine steifgefrorenen Glieder. Ende. Jetzt würde er tun, was er bisher zu tun vorgegeben hatte. Er würde einen blauen Overall tragen, Schubkarren schieben, Mistgabeln zur Hand nehmen, bei Geburten dabei sein, Zäune reparieren.
Beginn. Über Freys Gesicht hetzte ein Lächeln. Er wollte sich zu Antonio umdrehen, doch spürte einen dumpfen Schmerz im Kreuz, verlor das Gleichgewicht, strauchelte und fiel über die Brüstung.
Sie zogen ihre Runden. Rastlos und hungrig.
Frey schrie auf. Der Boden war hart gefroren. Aber er spürte den Aufprall kaum. Die Angst lähmte seine Empfindungen, der Sturz betäubte seinen Leib. Dann durchzuckte ihn brennender Schmerz.
»Bleiben Sie ganz ruhig! Keine schnellen Bewegungen! Ich hole Hilfe!« Das war Antonios Stimme.
Frey sah sein Gesicht über dem Geländer der Aussichtsplattform schweben wie ein Gestirn in dunkler Nacht. Er streckte die Hand aus. Aber im nächsten Moment drückte ihn das Gewicht des Leitwolfs zu Boden. Mit zurückgezogenen Lefzen knurrte er ihn an. Speichel tropfte aus seinem Maul auf Freys Stirn. Ergeben drehte Frey den Kopf zur Seite. Bevor er die Augen schloss, sah er einen blauen Overall am Tor aufblitzen und vor Schreck weit aufgerissene, rehbraune Augen. Dann wurde es Nacht. Aber der Schmerz war grell wie der erste Sonnenaufgang nach jahrelanger Kerkerhaft. Ende.
†
Oberösterreich, April 2020
Joachim sah zum Himmel. Die Jagd, der sich die Wolken hingaben, gefiel ihm. Wind war sein Wetter. Sooft er ihn in den Blättern der Linde vor seinem Zimmerfenster spielen sah, zog es ihn ins Freie. Jetzt, da er dies ohne Begleitung tun durfte, war der Genuss umso größer, und er fragte sich, weshalb er seine Haare eigentlich immer kurz geschnitten getragen hatte. Der Wind zauste ihm den Lockenkopf. Er spürte, wie einzelne Strähnen hochgeblasen und wieder niedergedrückt wurden. Es war wie die Massage unzähliger winziger Finger auf seiner Kopfhaut.
Nachdem er ein Jahr größtenteils in der Enge seines Zimmers verbracht hatte, stellte der Park eine kleine Unendlichkeit dar. Und eine große Freiheit. Ohne den allgegenwärtigen Pfleger an seiner Seite konnte er ungehemmt loslachen beim Anblick trudelnder Blätter.
Könnte er. Aber er tat es nicht. Er hatte gelernt, solche Impulse zu unterdrücken. Als Patient einer geschlossenen Anstalt war es einer Entlassung nicht förderlich, wenn man über Blätter lachte. Immerhin war er nicht verrückt. Nein!
Sie hatten alles darangesetzt, ihm dies einzureden. Aber er war standhaft geblieben. Er war nicht verrückt. Alles, was er erlebt hatte, war real gewesen. Er hatte es gesehen. Auch wenn es ihm lieber wäre, einfach verrückt zu sein. Er war es nicht. Dennoch war er hier. Villa Sonnenschein, geschlossene psychiatrische Anstalt.
Joachim wandte den Blick vom Himmel, zog sein Stirnband zurecht und ging weiter. Zumindest hatte er hier Zeit genug gefunden, zu lernen, es zu kontrollieren. Bei dem Gedanken an die nicht enden wollenden Stunden dieses Lernprozesses drehte ihm sich der Magen um.
Das Schwerste war gewesen, es sich einzugestehen. Da war ein Auge auf seiner Stirn. Ein drittes Auge. Und dem entging nichts. Nachdem er diese Tatsache akzeptiert hatte, war es ihm leichter gefallen. Von da an war es bergauf gegangen. Das Kribbeln im Nacken, das eine Sicht mit dem Auge ankündigte, die Hitze, die vom Auge ausging, wenn es etwas sah und vor allen Dingen die Wahrheiten, die es ihm zeigte – das alles war ihm immer vertrauter geworden.
Er hatte die Geister verstorbener Patienten gesehen und die Dämonen der Lebenden, die ihnen im Nacken saßen und sie verrückt machten. Übernatürliches. Das Auge zeigte es ihm, auch wenn er es lieber nicht sehen wollte. Jetzt brauchte Joachim zwar noch immer sein Stirnband, doch es war mehr eine Absicherung. Er hatte gelernt, wegzusehen, seine Augen zu schließen. Alle seine Augen. Er hatte es lernen müssen. Sonst wäre er tatsächlich verrückt geworden.
Das Wispern des Laubes im Wind veränderte sich kaum merklich. Trotzdem riss diese Veränderung Joachim aus seinen Gedanken. Jäh blieb er stehen. Sofort spannte sich jeder Muskel in seinem Körper. Das bekannte Kribbeln in seinem Nacken und ein Prickeln wie von Eisregen, das sich auf jeden Zentimeter seiner Haut ausbreitete, kündigte sein Erscheinen an.
Noch immer wünschte Joachim, er würde ihn verschwinden lassen können. Doch mittlerweile hatte er sich damit abgefunden, dass er seine Augen zwar verschließen konnte, aber niemals vor ihm.
Das Wispern schwoll an, während der Wind sich legte. Die Luft vor Joachim begann zu flimmern, sich zu verdichten, als ob jedes Molekül sich aufblies und in tausende feste Teilchen zersprang. Als sich die Gestalt des Alten daraus geformt hatte, war es totenstill. Kein Vogel zwitscherte mehr, kein Auto brauste auf der Bundesstraße hinter der Parkmauer vorüber, keine Schreie aus dem nahen Anstaltsgebäude.
Nicht einmal sein Herz spürte Joachim noch schlagen. »Es ist Zeit«, sagte der Alte. Seine Stimme begann dort, wo moderndes Holz zu faulen aufhörte und wieder brechen konnte. Seine Worte waren so trocken wie Luft über der Arktis.
»Zeit?«, fragte Joachim, »Wofür?«
»Verlasse jetzt diesen Ort. Es ist Zeit!« Joachim senkte den Kopf. Noch immer schmerzte ihn der Blick dieser eisblauen Augen. Es war eine Kälte, die ihn scharf und spitz ins Herz traf. Er lief Gefahr, zu vergessen, dass es die Wärme war, die dort heimisch sein sollte. »Und weshalb sollte ich das tun?«, erkundigte er sich gereizt, »Jeder, den ich liebte, hat sich von mir abgewandt. Meine Frau und mein bester Freund leben in meinem Haus. Wo soll ich denn hin? Außerdem ...«, fügte er hinzu und versuchte, dem Alten in die Augen zu blicken, »... bin ich noch nicht entlassen.«
Der Alte warf ihm einen wissenden Blick zu. Mit einer ruckartigen Bewegung warf er den Schoß seines Mantels über seine Schulter. Ein orkanartiger Wind kam auf und stürzte die Idylle des Parks für den Bruchteil einer Sekunde ins Chaos. Joachim schloss die Augen vor dem aufwirbelnden Staub.
Als er sie wieder öffnete, befand er sich im Behandlungszimmer des Chefarztes. Er saß in dem Besucherstuhl vor seinem Schreibtisch. Sein Gegenüber hatte sich mit den Drehstuhl von ihm abgewandt. Jetzt drehte er sich herum, und Joachim biss die Zähne zusammen. In solchen Momenten zog er es in Erwägung, tatsächlich verrückt zu sein.
Die geisterhafte Erscheinung des Alten hatte sich zu einer menschlichen Gestalt verwachsen, deren Lebenssäfte beinahe sichtbar unter der blassen Haut zu fließen schienen. Sein Herz klopfte aufreizend vital gegen seinen Brustkorb, der sich wie rein zum Zwecke der Zurschaustellung des Lebens hob und senkte. Der Arzt reichte ihm ein Papier über den Tisch.
»Ich bin entlassen«, stellte Joachim ergeben fest, ohne auf den Zettel zu sehen.
»Es ist Zeit. Hier gibt es nichts mehr zu sehen für Sie, Herr Moor«, sagte der Arzt sachlich, »Alles Gute.« Damit stand er auf, ging um den Tisch herum und reichte Joachim die Hand.
Joachim murmelte etwas, das weder Dank noch Verabschiedung war und hastete aus den Raum.
»Herr Moor!«
Er blieb stehen und drehte sich um.
Der Arzt stand dicht hinter ihm. Seine glänzenden, blauen Augen lagen tief in ihren Höhlen. Wie Saphire auf den Grund eines eisigen Gletschersees. »Machen Sie ihr Auge auf, Joachim Moor.«
Eine Weile hielt Joachim seinem Blick stand, doch dann machte er auf dem Absatz kehrt und eilte mit großen Schritten den Korridor hinunter in Richtung Ausgang. Nie mehr, dachte er und drückte die schwere Glastür auf. Nie mehr werde ich mein Auge öffnen!
†
Niederösterreich, April 2020
Ein Windstoß schleppte den süßen Geruch nach Verwesung mit sich und rüttelte am Drehkreuz. Hanna trat unter das niedere Vordach eines Schuppens. Sie hasste Wind. Mit einem kritischen Blick zum Himmel schüttelte sie die Regentropfen aus ihrem Schirm.
Gleichsam versuchte sie, die Enttäuschung von sich abzuschütteln. Was hatte sie erwartet? Wollte sie bunten Kies auf dem schlammigen Weg und Vogelgezwitscher in den Sträuchern, deren verblühte Rispen anorganisch hinabhingen? Zu Kugeln geschnittene Buchsbäume, anstelle dieser vom Buchsbaumzünsler vergewaltigten Krüppel? Nein, solche Dinge waren ihr nicht wichtig. Aber da war dieses Schild gewesen ...
Es hätte Vergnügen und Abenteuer ankündigen sollen. Die Farbe war abgeblättert, die Buchstaben hingen schief. Manche fehlten. Und das P hatte der Wind ihr just vor die Füße geschleudert, sodass von Willkommen im Abenteuerland!, schwarz und verwittert, nur noch ein Wort geblieben war: W i l d!
Da hatte eine eigentümliche Beklemmung von ihr Besitz ergriffen. Solche Gefühlsregungen waren ihr unbekannt. Und zuwider. Es passte nicht zu ihr. Und ja, deshalb wären ihr Buchsbaumkugeln und Vogelgezwitscher ganz recht gewesen.
Der Regen war endgültig abgezogen. Krähen drehten ihre Runden über den nunmehr stahlblauen Himmel. Die letzten Wolken zogen mit dem scharfen Ostwind. Hanna faltete den Schirm zusammen und lehnte ihn gegen die Schuppenwand. Das Quietschen der rostigen Streben des Drehkreuzes mischte sich mit dem unaufhörlichen Krächzen der Rabenvögel.
Hanna fasste in ihre Manteltasche, angelte sich Zigarettenpapier, Filter und Tabak heraus und drehte sich eine Zigarette. Dabei kam ihr der Gedanke, dass sie im Grunde ganz gut hierher passte. Sie verzog den Mund zu einem bitteren Lächeln und steckte die Zigarette zwischen die Lippen. Von ihr war zwar nichts abgeblättert. Denn von Lack hatte sie noch nie was gehalten. Wozu auch? Damit andere sich keinen Span an ihr einzogen? Damit sie länger haltbar blieb?
»Pff!« Hanna stieß eine Rauchwolke aus, die sofort vom Wind erfasst und zerstreut wurde.
Trotzdem. Abgeblättert oder nicht. Was sichtbar war, war Wild. Doch wenn sie zahm gewesen wäre, stünde sie heute nicht hier. Verdammt! Wenn sie schon keinen Vater hatte haben können, so hatte sie doch wenigstens das Recht auf sein Erbe.
»Hallo?« Eine heisere Männerstimme riss sie aus den Gedanken. »Sind Sie die Frau Frei?«
»Frey«, verbesserte Hanna, dämpfte die Zigarette am Absatz ihres Stiefels aus und streckte dem Mann im blauen Overall die Hand entgegen. Wenn sie es schaffte, diesen neuen Familiennamen richtig auszusprechen, dann sollte dieser Kerl es auch zustande kriegen. »Und Sie müssen der Herr Stefan Kramer sein.«
»Steve ist mir lieber.«
Er fuhr sich mit den Fingerspitzen durch das nasse Haar. Es gefiel ihr gar nicht, dass er dies mit sichtlichen Genuss tat. Sie konnte nicht wegsehen. Die blonden Strähnen kringelten sich zu glänzenden Locken. »Okay, Stefan.« Sein Blick wanderte von ihrem Gesicht abwärts und ruhte einen Tick zu lange auf ihren Brüsten.
Hanna räusperte sich. »Kann es losgehen?«
»Jep!«
Dass er ihr auf den Busen glotzte, ärgerte sie nicht so sehr wie die Tatsache, dass er sich unverhohlen schwer von dem Anblick losreißen konnte. Aber er hatte schließlich schon am Telefon den Eindruck hinterlassen, ein unangenehmer Zeitgenosse zu sein. Hanna verbuchte es als einen der seltenen Erfolge in Sachen Menschenkenntnis.
Sie war nicht hier, um Freunde zu finden. Stefan hob die Schranke neben dem Drehkreuz aus den Angeln und hielt sie Hanna auf. Dann schlurfte er ihr voraus auf das erste Gebäude zu, ein Holzhäuschen, das ein rostiges Schild als Nagerparadies anpries.
Stefan drückte die Tür auf. Scharfer Gestank schlug ihr entgegen. Hanna unterdrückte den Impuls, sich die Nase zuzuhalten. Das mit Stroh ausgelegte Innere des Häuschens war etwa fünf Quadratmeter groß. In einer Ecke befand sich eine Miniaturausgabe des Stallhauses, das wohl irgendwann als Unterschlupf für Meerschweinchen und Hasen gedient hatte, nun aber auf dem Dach lag, sodass es an irgendwas zwischen Fressnapf und Lebendfalle erinnerte. Ein schwarzes Kaninchen machte sich mit seinen Zähnen daran zu schaffen. Außer ihm konnte Hanna keine Tiere entdecken.
»Du hältst es hier aber nicht allein?«, wandte sie sich an Stefan.
Er schüttelte den Kopf und zeigte auf ein Loch in der Wand des Häuschens. »Ist nur das Einzige, das zu Hause ist. Die können da rein und raus, wie es ihnen passt.« Er schien sichtlich stolz darauf zu sein, was Hannas Zorn noch verstärkte.
»Was ist mit Fressfeinden?«, herrschte sie ihn an. »Diese Kaninchen sind doch nicht für die freie Wildbahn geschaffen! Sie brauchen ...«