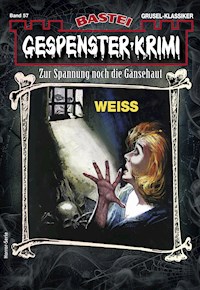3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Elysion Books
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Was macht Andrain Albus Uhren so begehrt? Sie zeigen dir nicht, wie die Zeit vergeht, sondern halten sie für dich an, wenn du einmal mehr davon brauchst. Aber der Handel, den Andrain vor Jahren dafür abgeschlossen hat, birgt nicht nur Reputation und Reichtum, sondern auch große Gefahr. Diese scheint bereits unabwendbar, als die Astrophysikerin Hemma ihren Wecker reklamiert. Dieser hält sie mit seinen Geräuschen wach, obwohl er eigentlich nicht ticken sollte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
The Time Wars
-Silberzeit-
Katharina Hadinger
ELYSION-BOOKS
Print; 1. Auflage: Juli 2023
eBook; 1. Auflage: Juli 20213
VOLLSTÄNDIGE AUSGABE
ORIGINALAUSGABE
© 2022 BY ELYSION BOOKS GMBH, LEIPZIG
ALL RIGHTS RESERVED
UMSCHLAGGESTALTUNG: Ulrike Kleinert
www.dreamaddiction.de
ISBN (gedrucktes Buch) 978-3-96000-212-3
www.Elysion-Books.com
The Time Wars
-Silberzeit-
Katharina Hadinger
1. Protostern
Rumänien, Landkreis Mureș 2015
Hemma war erledigt. Der Flug hatte nicht lange gedauert. Aber die fünfstündige Fahrt im Kleinbus hatte sie zermürbt. R.E.M. Immer wieder R.E.M.! Inzwischen konnte sie Losing My Religion nicht nur auswendig, sondern fühlte sich auch so. Einzig der Gedanke an das Hotelzimmer in Reghin hatte sie einigermaßen bei Laune gehalten. Es war eine Weile her, dass sie ein Zimmer für sich allein gehabt hatte. Das Wissen um dieses Hotelzimmer war zwar maßgeblich daran beteiligt gewesen, bei der Entscheidung, die Reise mitzumachen. Ausschlaggebend dafür war aber Tom gewesen. Unter halb geschlossenen Lidern beobachtete Hemma seine feinen braunen Haare, die im Wind des offenen Fensters zitterten. Manchmal glaubte sie, einen Hauch seines Schweißes zu riechen. Sie saß hinter ihm. Am liebsten hätte sie seinen Nacken geküsst.
Als ein Straßenschild die Stadt Reghin ankündigte, riss sich Hemma aus ihren Tagträumen und richtete sich auf ihrem Platz auf. Aufmerksam schaute sie über den Kopf ihrer schlafenden Kollegin hinweg auf die vorbeiziehende Landschaft. Bäume, vereinzelte Bauernhöfe, Strommasten, ein Schild mit dem Hinweis auf die Ausfahrt nach Reghin …
»Wir haben die Ausfahrt -«
»Der Tag ist noch jung!«, kam es von Professor Goldkehl prompt zurück.
Natürlich, dachte Hemma bei sich, weil der Tag bereits gestern Nacht begonnen hat.
»Natürlich«, sagte sie laut und lehnte sich wieder zurück. Goldkehl tippte hektisch gegen das Autoradio. Drive. R.E.M. Tom, der auf dem Beifahrersitz neben Goldkehl saß, drehte sich um und schenkte Hemma ein verschwörerisch spöttisches Grinsen. Sie erwiderte es, streckte die Zungenspitze raus und verdrehte die Augen.
Hemma mochte Professor Goldkehl. Wenn er erzählte, tat sich eine Welt auf. Er hatte sich seinen jugendlichen Idealismus bewahrt und mit ins Alter genommen. Wie ein guter Wein war er mit ihm gereift. Seine Worte waren die Welt. Selten waren die Flecken Erde, die er nicht bewandert oder zumindest überflogen hatte.
Ideciu de Jos war so ein Fleck.
Bald standen sie im Kreis auf einer Wiese unweit des Ortszentrums. Goldkehl hatte sieben Studenten zur Reise eingeladen. Nur vier waren mitgekommen. Sinn und Zweck der Studienreise war unter anderem ein Besuch des astronomischen Observatoriums in Bacâu. Ein alter Freund Goldkehls hatte die Leitung über den Bau der 5.5 M Scope Dome Kuppel. Ein weiterer Grund war jedoch die Vermessung eines Impaktkraters aus dem sechzehnten Jahrhundert. Dass drei der ausgewählten Studenten sich eine solche Gelegenheit entgehen ließen, gründete in der Tatsache, dass es sich bei dem Krater um die Einschlagstelle des Tempurameteorits handelte und somit eher ein Fall für Hobbyastrologen aus dem Reich der Esoterik war. Goldkehl aber war bekannt für derlei Eskapaden. Ein Titel einer Arbeit von lautete: Sternstaub und Feen – eine Spurensuche.
Wäre Tom nicht mitgekommen, hätte es für die Reise keinen Kleinbus gebraucht.
Vor einem Jahr hatte Hemma während eines Amerikaaufenthalts den Barringerkrater in Arizona besucht, der mit seinen fünfzigtausend Jahren noch jung und deshalb äußerst eindrucksvoll ist. Er hat einen Durchmesser von einem Kilometer und gehörte somit zu den kleinen Impaktkratern. Goldkehl aber hatte eine Studienreise organisiert, um im beschaulichen Ideciu de Jos in Rumänien einen noch weitaus jüngeren Krater zu vermessen. Mit einem sagenhaften Durchmesser von …
»Exakt zehn Komma drei Zentimeter.«
Goldkehl erhob sich und klopfte sich den Staub von den Hosenbeinen. Die Tatsache, dass er ein abgeschlagenes Geodreieck zur Messung benutzt hatte, brachte Tom, der seinen Pferdeschwanz mittlerweile gelöst und sich ausgiebig mit den Fingerspitzen durch die Locken gestrubbelt hatte, zum Lachen.
Goldkehl ließ sich davon nicht beeindrucken.
»Der Tempura war einer der sehr seltenen schwarzen Sterne«, fing er an, »Ein typischer Stern lebt davon, dass er Wasserstoff zu Helium fusioniert. Wenn diese Vorräte aufgebraucht sind, ist es möglich noch ein paar andere Energiequellen anzuzapfen. Letztendlich aber wird fast jeder Stern durch die Phase der roten Riesen gehen, wo er sich erst einmal stark aufbläht, einen großen Teil seiner Hülle verliert und sich schließlich zu einem mickrigen Sternkadaver entwickeln wird. Sämtliche Fusionsprozesse sind erloschen. Das nennt man dann auch Weißen Zwerg. Der Tempura aber wurde zum Schwarzen Zwerg. Er leuchtete nicht. Er schluckte das Leuchten Weißer Zwerge. Es gibt Aufzeichnungen aus dem frühen sechzehnten Jahrhundert, in denen von derlei Beobachtungen gesprochen wurde. Tiere und Pflanzen in der Nähe der Einschlagstelle des Meteorits verschwanden aus unerklärlichen Gründen. Und …« Er blickte bedeutungsvoll in die Runde und senkte die Stimme, »… auch Menschen.«
Ein Raunen ging durch die kleine Gruppe der Studenten um Goldkehl, ein verhaltenes Kichern und Flüstern. Er räusperte sich demonstrativ und redete unbeirrt weiter:
»Ja, auch Menschen. Wissenschaftler, Geologen, Astronomen und neugierige Bauern. Deshalb die lückenhaften Aufzeichnungen. Der Tempurameteorit konnte nur aus großer Distanz erforscht werden. Eine Insektenart der Gattung der Lepismatidea wurde richtiggehend davon angezogen. Irgendwann löste sich der Meteorit auf. Puff!« Goldkehl klatschte in die Hände. Hemma, die abwesend mit der Schuhspitze in der Erde geschart hatte, fuhr zusammen.
»Oder hat jemand ihn gestohlen?«, fuhr Goldkehl fort und zwinkerte ihr geheimnisvoll zu. Seine Miene drückte dieselbe Abwesenheit aus, die seine Vorträge zum Thema Feenstaub charakterisierte. Mit einem kräftigen Räuspern kehrte er in die Realität zurück. »Ein griechischer Gelehrter entdeckte übrigens den Tempura und gab ihm seinen Namen.«
»Wer?«, meldete sich eine Studentin zu Wort. Hemma versuchte krampfhaft, sich an ihren Namen zu erinnern. Irgendwas mit E …
»Der Name tut nichts zur Sache«, sagte Goldkehl da. Hemma erschrak, konstatierte dann aber, dass er nicht ihre Gedanken gelesen, sondern auf die Frage der Studentin reagiert hatte. »Gelehrte Entdecker gab es zu dieser Zeit viele«, fuhr er fort, »Nicht alles, das sie entdeckten, ist so wichtig, dass ihre Namen die Zeit überdauert hätten.«
»Der Tempura ist also unwichtig«, warf Tom betont unschuldig ein.
»Aber ja!«, rief Goldkehl aus, als hätte er nur darauf gewartet, dass endlich einer seiner Studenten richtig schlussfolgerte.
»Warum sind wir dann hier?«
»Unwichtig ist nicht gleich uninteressant«, erwiderte Goldkehl mit erhobenem Zeigefinger, »Ein guter Astrophysiker muss immer auch ein guter Phantast sein. Wie sonst könnte er behaupten, dass Universum sei unendlich. Unendlichkeit existiert nur in der Fantasie, junger Mann.« Dann huschte ein mutwilliges Lächeln über seine Lippen. »Aber vor allem seid ihr deshalb hier, weil dieser winzige Impaktkrater genau richtig ist für euch Anfänger, um sich am Vermessen zu üben. Also!« Er klatschte in die Hände. »Auf die Plätze fertig los! Messen! Proben nehmen! Und Händewaschen nicht vergessen!«
Es war bereits dunkel, als Professor Friedrich Goldkehl seine Studenten entließ. Auf dem Weg zurück in den Ort, eröffnete er ihnen, dass er anstelle eines Hotels in Reghin eine Unterkunft in Ideciu de Jos organisiert habe. »Mit Thermenbenutzung«, fügte er schmunzelnd hinzu, als er die langen Gesichter seiner Schützlinge im Rückspiegel sah. »Überraschung!« Die Stimmung hob sich angesichts der Aussicht auf einen Thermenbesuch. Aber Goldkehl nahm eine Hand vom Lenkrad und hob sie mahnend.
»Leider gab es dort nur drei freie Zimmer. Zwei von uns werden in einer urigen Pension residieren, die, wie ich meine kulturell und geschichtlich einiges zu bieten hat. Und die Therme kann ja trotzdem genutzt werden. Also, Freiwillige vor!«
Während Hemma mit den beiden Studentinnen noch diskutierte, wer genau diese kulturelle Arschkarte ziehen sollte, meldete sich Tom freiwillig dazu.
»Ich bin echt fertig«, begründete er seine Entscheidung, »Will eigentlich nur ins Bett.«
Eine Weile hörte man nichts als den Motor des Kleinbusses und Michael Stypes leises Wimmern. Dann räusperte sich Hemma und sagte: »Ich habe keine Badesachen mit, also … Außerdem bin ich hundemüde.«
Ideciu de Jos war eine beschauliche Gemeinde am Ufer des Flusses Mures. Etwas abseits vom Ortszentrum bog Goldkehl in eine schmale Seitenstraße ein. Diese endete auf einem Schotterplatz, welcher von Flusssteinen gesäumt war. Im Scheinwerferlicht sah Hemma ein dunkles Holzblockhaus mit halbrunden Fenstern, einem steil anmutenden überdachten Treppenaufgang zur Haustür und einem mächtigen Balkon. Im Haus brannte nirgends Licht. Es wirkte verlassen und trostlos. Goldkehl drehte den Zündschlüssel herum. Der Motor erstarb. Stille machte sich in dem Kleinbus breit. Schließlich räusperte sich Goldkehl.
»Da wären wir«, verkündete er gutgelaunt und gähnte demonstrativ. Hemma verstand. Nach einem kurzen Seitenblick auf Tom stieg sie aus dem Wagen. Tom schnalzte mit der Zunge und stieg ebenfalls aus. Sie hatten ihr Gepäck noch nicht aus dem Kofferraum genommen, da startete Goldkehl bereits den Motor. Kaum hatten sie sich die Rucksäcke umgeschnallt, gab er Gas, wendete den Wagen, dass der Schotter nur so flog, und kam neben ihnen nochmal zum Stehen. Das Fenster senkte sich hinab und Goldkehls breites Grinsen wurde sichtbar.
»Ich hole euch morgen um halb sechs ab.«
»Halb sechs morgens?«, fragte Hemma erschrocken.
»Ist das zu spät?«, erkundigte sich Goldkehl verschmitzt. »Ich dachte, ein bisschen Ausschlafen schadet nicht. Immerhin liegt eine vierstündige Fahrt bis nach Bacâu vor uns.« Damit ließ er sie stehen.
Verdrossen drehte sich Hemma zu Tom um. Der aber hatte seinen Blick auf das Haus gerichtet. Aus der Dunkelheit zeichneten sich die Umrisse einer Gestalt ab, die eilig auf sie zuschritt.
»Buna seara!« Ein kleiner Mann mit dunkler Haartolle über den buschigen Brauen, baute sich breitbeinig vor Hemma und Tom auf, stemmte die Arme in die Seiten und strahlte sie an.
»Mein Name ist Ion. Ich bin Ihr Gastgeber. Das ist besondere Ehre. Hier verbringen Sie Nacht in Historie und Luxus.« Hemma hatte keine Ahnung, was genau das bedeuten konnte, doch bevor sie etwas erwidern konnte, lähmte der Schreck ihre Zunge. Ein langgezogenes Heulen zersägte die nächtliche Ruhe. »Keine Angst«, sagte Ion schnell, »Ist nix Lup äh – Wolf. Ist Hund. Nur Hund.« Das Heulen wurde von einem vielstimmigen Chor beantwortet.
»Ist viel hier mit Hund.«
Noch immer glückselig lächelnd drehte sich Ion um und stapfte den Schotterweg zum Haus zurück. Die stockdunkle und von mannigfaltigem Heulen noch finsterer erscheinende Nacht,dichteten dem schwarzen Holzhaus mehr Heimeligkeit an, als es tatsächlich ausstrahlte. Bereitwillig folgten Hemma und Tom ihrem Gastgeber.
»Vielleicht hat er Hysterie gemeint«, zischte Tom ihr zu.
»Hysterie und Luxus.«
»Bitte einzutreten!«, forderte Ion sie auf, öffnete die knarzende Eingangstür und betätigte rasch den Lichtschalter. Ein völlig deplatzierter Kristalllüster flammte auf und tauchte das rustikale Vorhaus in grelles Licht.
»Ihre Zimmer sind oben«, sagte Ion und deutete auf die schmale Holztreppe. »Unten nämlich ist Museum, verehrter Gast. Sehen? Kommen Sie! Folgen Sie mir. Ich zeige. Ist Historie …«
»Ein anderes Mal«, unterbrach ihn Hemma rasch mit einem Seitenblick auf Tom. »Wir sind echt erschöpft.«
»Ich zeige Zimmer«, sagte Ion ergeben und schlurfte mit hängenden Schultern in Richtung Treppenaufgang. Seine Beine wirkten schwer. Das sprichwörtliche Schaf zur Schlachtbank kam Hemma in den Sinn, während sie hinter ihm her zu den Zimmern hinaufstieg.
Ideciu de Jos war augenscheinlich nicht der Ort, an den es Touristen massenhaft verschlug. Die einzigen Sehenswürdigkeiten waren eine renovierungsbedürftige evangelische Kirche und die Reste einer Burg, die es laut des archäologischen Instituts allerdings nicht gab. Und natürlich das Thermalbad. Das Thermalbad, ja. In Gedanken bei den heißen Quellen, merkte Hemma nicht, dass Ion die Zimmertür aufgeschlossen hatte und ihr den Schlüssel hinhielt.
»Poftim, verehrte Dame«, sagte er. Hemma nahm den Schlüssel entgegen.
»Hast du noch Lust auf ein Bier?«, wandte sie sich an Tom, »Du kannst nachher gern noch vorbeischauen.«
Zu ihrer Überraschung legte Tom dem Hausherrn eine Hand auf die Schulter. »Kommt darauf an, wie lange die Museumstour dauert.«
Ion nickte höflich. Seine Körpersprache jedoch sagte nur allzu deutlich, was er von fremden Händen auf seiner Schulter hielt. Er windete sich äußerst geschickt aus der Berührung, indem er eine Verbeugung andeutete und zugleich einen zierlichen Schritt nach hinten tat.
»Poftim«, sagte er, »Museum ist reich an Umfang.«
Ein leichter Anflug von Zorn überkam Hemma. Sie war nicht stundenlang Bus gefahren und verzichtete dann noch auf ein Hotelzimmer mit Thermenbenutzung, um sich die Chance mit Tom allein zu sein, von einem abgewrackten Museumsführer abspenstig machen zu lassen. Die Röte stieg ihr in die Wangen, als ihr klar wurde, dass sie all das tatsächlich nur gemacht hatte für die Möglichkeit dieser Chance.
Hemma stellte ihren Rucksack hinter die Zimmertür, zog sie zu und lächelte Tom an.
»Ich würde das Museum auch gerne sehen.«
Tom schien damit glücklich, denn er erwiderte ihr Lächeln so herzlich, dass sie abermals spürte, wie sie rot wurde.
Allein die Art ,wie sich Ion die Hände rieb, gefiel ihr nicht.
»Ich weiß«, sagte er. »Stiu, liebe Dame.«
Das Museum beschränkte sich auf einen großen Raum im Erdgeschoß, dessen Einrichtung auf ein Wohnzimmer schließen ließ. Ganz einem Museum entsprechend waren die Möbelstücke allesamt aus der Renaissance. Neben zwei Faltstühlen gab es auch eine gepolsterte Truhenbank bemalt mit Stadtansichten und Szenen aus dem Markttreiben. Auf einem niederen Tischchen mit geschwungenen Beinen lagen Rauchutensilien.
»Der Salon der Familie«, eröffnete Ion seine Führung.
»Hast du deine Kamera dabei?«, zischte Tom Hemma zu, »Ich hab meine oben.« Hemma zog ihre kleine Digitalkamera aus der Tasche und zielte auf gut Glück in den Raum. In Gedanken spielte sie bereits die Übergabe der Abzüge durch. Das Aufflackern des Blitzes ließ Ion zusammenzucken. Sie erntete einen missbilligenden Blick von ihm, der jedoch von seiner höflichen Redeweise sofort abgeschwächt wurde.
»Wunderbar, na? Hier sehen Sie persönlichen Lieblingsplatz des Meisters – die Geburtsstätte seiner meisterhaften Werke. Hier, liebe Dame, lieber Herr ist …« Tom, der sofort - sich diesen und jenen Gegenstand besehend - in den Salon ausgeschwärmt war, trat nun an Ion heran und unterbrach ihn. »Entschuldigen Sie. Welche Familie lebte hier? Wer war der Meister?«
Ion faltete die Hände vor dem Gesicht wie zum Gebet und schaute ihn über die Fingerspitzen hinweg aus seinen dunklen Augen bedeutungsvoll an.
»Familie Weiss«, sagte er, »Der große Uhrmachermeister Georg Weiss. Sie kennen nicht, lieber Herr? Liebe Dame?«
Während Hemma nur die Achseln zuckte, blickte Tom in die Luft und tat, als suchte er nach dem vergrabenen Wissen um diese Familie. Einen Augenblick lang standen sich die drei betreten gegenüber.
»Tut mir leid«, sagte Tom schließlich, »Aber ich würde gerne etwas darüber erfahren.« Ion verschränkte die Hände auf dem Rücken und deutete eine leichte Verbeugung an.
»Im Jahr sechzehnhundertsiebzig, liebe Dame, lieber Herr, war Meister Weiss einfacher Schlosserlehrling. Nix von Bedeutung. Nicht einmal Name! Damals, wissen Sie, war Meister noch Georg Weiss. Name war nix rumänisch. War sächsisch. War nix gut für Familie. Später wurde rumänisch. Sehen sie! Frumoasa -äh- Wunderschön!« Ion zwinkerte Hemma zu und tippte auf ein Ölbild, das über einer Truhe an der Wand hing. Tom neigte sich interessiert näher. Hemma blieb Ions Begeisterung für die Schönheit dieses Mannes indes ein Rätsel. Vielleicht galt er in der damaligen Zeit als schön. Sein strenger Blick war das Einzige, das Hemma in die Augen stach. Er trug einen schwarzen Gehrock mit hochgestelltem Kragen. Um seinen Hals hing eine schlichte Gliederkette mit einem protzigen Medaillon. Die gerüschten Ärmel seines Hemdes verdeckten seine Hände, die er locker im Schoß hatte. Insgesamt machte er einen recht hochnäsigen Eindruck auf Hemma. »Machst du ein Foto?«, stieß Tom sie sanft in die Seite.
»War er denn ein berühmter Uhrmacher?«, wandte er sich dann an Ion, der ergriffen hinter ihnen stand. Hemma musste sich zusammenreißen, um nicht laut aufzustöhnen, als sich seine Stirn bedeutungsschwanger in Falten legte und ein Schatten über sein Gesicht huschte.
»Berühmt?« In seiner Stimme schwang Verachtung. Doch bevor Hemma sich darüber ärgern konnte, zeigte er sein höfliches Lächeln und neigte demütig den Kopf.
»Pardon. Liebe Dame, lieber Herr. Ihm ist der präzisierte Einsatz des Minutenzeiger zu verdanken. Dafür ist er wohl berühmt. Aber auch zuvor war Familie schon berühmt hier in Romania. Wegen Glas, liebe Dame, lieber Herr. Speziale! Sie verstehen? Bricht nicht. Kann nur mit speziale Zutat hart werden, nur mit speziale Zutat wieder weich. Zutat ist geheim. Familienrezept speziale.« Er schnippte mit den Fingern ob so viel Speziale, schmunzelte stolz und fuhr fort:
»Weniger bekannt sind meisterhafte Uhren von Weiss. Wunderwerke der Technik und der Fantasie. Allesamt unsigniert, verstehen Sie. Das Anbringen von Firmennamen war bis ins neunzehnte Jahrhundert nicht universal. Ohnedies, liebe Dame, hätte Georg Weiss seine Uhren niemals verschmutzt mit irgendwelchen – Logos.« Er spuckte das Wort aus wie eine Mücke, die ihm in den Rachen gekommen war.
»Wie kann man dann wissen, welche Uhr eines dieser Wunderwerke ist?«, fragte Hemma gereizt.
Ion hob den Zeigefinger, drehte sich um und ging zu der Truhenbank unter dem Fenster. Er öffnete den Deckel. Einen kleinen Moment lang versenkte er seinen Oberkörper in der Truhe. Dann richtete er sich auf und wandte sich schwungvoll zu Hemma um. In seiner Hand hielt er das Ende einer goldenen Kette, an der eine Taschenuhr baumelte. Triumphierend schritt er auf Hemma zu. Als er nach ihrer Hand griff, stellten sich ihr unwillkürlich die Nackenhaare auf. Entschieden hob Ion ihre Hand an und drehte sie sanft um. Mit einem dünnen Lächeln ließ er die Taschenuhr auf ihre Handfläche sinken. Ein unbestimmtes Gefühl hatte sich in Hemma breitgemacht. Ein Prickeln, das sowohl Furcht als auch Neugierde sein konnte. Aber auch Lust. Irritiert löste sie sich von Ions Blick und betrachtete die Uhr in ihrer Hand. Sie war mit filigranem Blattwerk verziert. Beim näheren Hinsehen erkannte sie, dass sich Tierköpfe und Früchte daraus hervorhoben.
»Este frumoasa, hm?«, flüsterte Ion. Hemma nickte.
»Das ist erste Taschenuhr mit Repetiereinrichtung.« Ions plötzlicher Rückfall in den Ton des Museumführers, ließ Hemma erschrocken aufschauen. Er nickte wissend und fuhr fort: »Repetieruhr. So genannt sind Uhren, mit denen Mechanismus oder Werk verbunden ist, so man nicht auf Zifferblatt zu schauen muss, um zu beliebiger Stunde daran erinnert zu werden, welche Zeit die Uhr angibt.« Er holte tief Luft. »Repetieruhren gibt es seit Siebzehnhundertzwanzig? Nu! Liebe Dame, diese hier ist aus dem Jahre sechzehnhunderteinundsiebzig. Meister Weiss war durchaus Meister. Er vollbrachte, was anderswo noch nicht einmal in Vorstellung war. Wie Zauberer. Sehen sie kleine silberne Kratzer hinten?« Er drehte die Uhr in ihrer Hand um. Tatsächlich wies das goldene Gehäuse auf der Rückseite silberne Kratzer auf.
»Das ist Signatur«, verkündete Ion stolz, »Signatur des Meisters! So kann man wissen, liebe Dame.«
In diesem Augenblick fing die große Standuhr im Vorzimmer zu Schlagen an.
»Ist spät«, sagte Ion, nachdem der elfte Schlag verklungen war, und zog an der Kette der Uhr, sodass sie aus ihrer Handfläche rutschte und in seiner Westentasche verschwand. Erleichtert atmete Hemma auf.
»Wirklich spät. Ja. Tom, bist du auch so fertig? Vielen Dank für die interessante Führung. Es war sehr …« »Da! Das finde ich auch, liebe Dame. Mulțumesc!« Ion war plötzlich sehr nahe. Sie konnte ihn riechen. Eine Mischung aus Regen und Schnee. Irgendwo tickte eine Wanduhr. Hemma meinte sogar, das zarte Ticken der Taschenuhr zu vernehmen. Und das Rattern des Werks der großen Standuhr. Gedämpft durch die geschlossenen Fenster mischte sich das Heulen der Wölfe oder der Hunde darunter. Ions dunkler Blick bohrte sich schmerzhaft in ihren Kopf. Hemma fuhr herum.
»Tom? Bist du auch so fertig wie ich?« Zu ihrem Entsetzen konnte sie Tom nicht sehen. War er nicht gerade noch hinter ihr gestanden? Hatte sie nicht seinen Atem in ihrem Nacken gespürt, als er sich vornübergebeugt und die Uhr bestaunt hatte?
»Okay, mein Freund ist wohl schon oben«, stammelte sie. Ion hatte die Arme vor der Brust verschränkt.
»Ich gehe jetzt auch. Gute Nacht.« Sie drehte sich auf dem Absatz um, und unterdrückte den Impuls zu rennen.
»Schlafen Sie wohl und ohne Störung.« Ions Stimme war nicht mehr als ein Flüstern mit einem Unterton, der Hemma abwechselnd heiße und kalte Schauer über den Rücken jagte. Das Gefühl, aus seinem Wirkungskreis verschwinden zu müssen, wurde übermächtig. »Ja«, stieß sie hervor, »Sie auch.« Damit beschleunigte sie ihre Schritte. Erst als sie oben war, rannte sie den Korridor entlang bis zu ihrem Zimmer und sperrte die Tür hinter sich ab.
Nachdem sie mit der Stirn gegen die Tür gelehnt verschnauft hatte, drehte sie sich um und schaute sich im Zimmer um. Modernes Einzelbett aus Eichendekorholz, passendes Nachtkästchen mit metallener Leuchte darauf. Bettbezug zurückhaltend gemustert, passende Vorhänge zum Bezug. Ein Teppich in Grau und Beige. Alles sauber. Unpersönlich und unaufdringlich. Erschöpft und etwas beschämt ließ sich Hemma auf das Bett fallen. Sie war übermüdet und ihr Hirn übersättigt von Informationen und Eindrücken. Sie war hysterisch geworden. Ihr blieb nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass Ion ihr Verhalten nicht bemerkt hatte. Oder Tom. War er deshalb einfach raufgegangen?
»Scheißdreck!« Hemma strampelte ihre Schuhe von den Füßen, robbte rittlings auf dem Bett nach oben und schob sich den Kopfpolster in den Nacken. Es war stickig in dem Zimmer. Sie fiel in einen unruhigen Schlaf mit lebhaften Träumen. Ion trat leise in ihr Zimmer. Sie erwachte davon, dass der Schlüssel innen aus dem Schloss fiel. Da hatte sich Ion bereits über ihr Bett gebeugt. Der Geruch nach Schneeregen nahm eine greifbare Intensität an, schien sie wie eine schwere Decke einzuhüllen. Kurz flammten seine dunklen Augen im nächtlichen Zimmer auf. Ein gelbstichiger Blick. Wolfsaugen. Hemma schrak hoch, setzte sich im Bett auf und rieb sich die Augen. Vor dem Fenster zeigte sich das erste Grau des Morgens. Nebelfetzen trieben dicht über Wiesen und Felder. Müde sank sie zurück in die Kissen. Aber der Schlaf wollte nicht zurückkehren. Als sie den Grund dafür endlich erkannte, setzte sie sich erneut im Bett auf. Es war der Wecker, der auf dem Nachtkästchen stand. Sein Ticken ließ sie nicht einschlafen. Jede Sekunde war ein Schlag mit dem Hammer gegen ihren Kopf. Hemma knipste die Nachttischlampe an und griff nach der kleinen quadratischen Uhr. Fest entschlossen, dem Ticken ein Ende zu machen, drehte sie sie um, um nach dem Batteriefach zu sehen. »Was sonst«, stöhnte sie auf. Das Fach war mit einer winzigen Schraube fixiert. Entnervt nahm sie das zweite Kissen von ihrem Bett und legte es über den Wecker. So war sein Ticken etwas gedämpft. Erschöpft legte sie sich wieder hin. Nach wenigen Augenblicken war sie zurück an der Schwelle zum Schlaf. Doch mit einem Mal kroch ihr eine Gänsehaut vom Scheitel über das Rückgrat bis zu den Fersen. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie in die Dämmerung. Das erstickte Ticken verseuchte den Raum. Hemmas Herz setzte einen Schlag aus. Denn sie war sicher, dass da kein Wecker gewesen war, als sie zu Bett gegangen war.
Früh am Vormittag des nächsten Tages saß Hemma schweigend auf der Rückbank des Kleinbusses und schaute aus dem Fenster. Es war heiß. Draußen hingen die Wolken tief von einem bleiernen Himmel. Die Straße war abwechselnd gesäumt von eintönigen Städtchen, hohen bewaldeten Hügel und weiten Ebenen. Als Hemmas Kopf schmerzhaft gegen das Fensterglas schlug, konstatierte sie, dass sie eingeschlafen war. Tom schob umständlich seinen Arm in ihren Nacken. Sie hörte das kristallene Ticken seiner Armbanduhr.
»Lass mich dein Nackenhörnchen sein«, scherzte er.
Hemma bedachte ihn mit einem geringschätzenden Blick, beugte sich nach vor, sodass sein Arm nutzlos über der Lehne lag und zog ihre Jacke aus der kleinen Tasche, die zwischen ihren Beinen stand.
»Ich nehme lieber die«, sagte sie und knüllte die Jacke zu einem kompakten Kopfpolster zusammen.
Tom machte den Mund auf, sagte jedoch nichts.
Vier Stunden später wurde Hemma davon wach, dass jemand die Autotür auf ihrer Seite öffnete und sie beinah hinausgefallen wäre.
»Observatorium Bacâu!«, verkündete Goldkehl voller Energie. Versöhnlich bot er ihr seinen Arm beim Aussteigen. Hemma tat, als bemerkte sie es nicht. Während die anderen Studenten zielstrebig auf einen Imbisswagen zusteuerten, wartete Goldkehl, bis sie ausgestiegen war.
»Haben Sie nicht gut genächtigt?«, erkundigte er sich.
Hemma schulterte ihre Tasche und schlug die Autotür zu.
»Es war Okay«, antwortete sie ausweichend. Dann schirmte sie ihre Hand gegen die Nachmittagssonne ab und blickte zu dem Turm des Observatoriums hinüber, auf dessen Dach sich die Elemente der Kuppel vor einem düsteren Himmel abzeichneten. Ein leichter Wind war aufgekommen. Unter der dunklen Wolkenschicht am Horizont war der Himmel gelb. Goldkehl folgte Hemmas Blick.
»Sieht nicht gut aus«, bemerkte er lakonisch. Im selben Moment fuhr ein scharfer Windstoß durch die staubigen Straßen. Von der Baustelle her waren aufgeregte Stimmen zu vernehmen.
»Kommen Sie. Es wird …«
»Was wissen Sie noch über den Tempurameteorit?«, platzte es aus Hemma heraus. Verdutzt schaute Goldkehl auf sie hinab.
»Sie interessieren sich dafür?«
»Scheinbar.«
»Warum?« Goldkehl musste gegen einen neuerlichen Windstoß rufen, der über den Platz toste.
»Ich weiß es nicht!« Es entsprach der Wahrheit. Sie wusste nicht, wie die Frage nach dem kleinen Meteoriten auf ihrer Zunge gelandet war. Tatsache war, dass, nachdem sie nun ausgesprochen zwischen ihnen stand, es kein Zurück mehr gab.
»Ich würde gerne alles darüber erfahren, was Sie …«
Ehe sie zu Ende sprechen konnte, schlug ein einzelnes Hagelkorn vor ihren Füßen ein. Für den Bruchteil einer Sekunde starrten Goldkehl und Hemma wie paralysiert auf die Stelle, an der das Hagelkorn auf dem glutheißen Asphalt zu schmelzen begann. Eine furchtbare Stille lag über der Stadt. Einzelne Geräusche – Verkehr, Vogelzwitschern, Stimmen – wurden aus ihrem Zusammenhang gerissen und schaukelten leblos wie in einem Vakuum. Beim nächsten Wimpernschlag aber öffnete der Himmel seine Schleusen. Goldkehl riss die Autotür auf und stieß Hemma ins Innere des Wagens. Er selbst rannte über den Platz in Richtung Observatorium und war nach wenigen Schritten hinter einem undurchdringlichen Vorhang aus Hagel verschwunden. Wie elektrisiert hockte Hemma im Wagen, starrte gegen die Fensterscheibe, die unter ihrem heißen Atmen beschlug. Jedes Hagelkorn war ein Schlag mit dem Hammer gegen ihr Herz. Als tickten sämtliche Uhren der Welt.
2. Zwischenspiel
Setz dich.
Dieser Schritt bedeutet mir viel. Es kostet mich einiges an Überwindung. Aber bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Von Anfang an gehabt. Es wird mir guttun, mir alles von der Seele zu reden. Jetzt, da ich niemanden mehr habe, der mir zuhört.
Von Anfang an also.
Nachdem meine Geburt meine Mutter umgebracht hatte, beschloss mein Vater, mich zu seiner Mutter zu geben. Damals steckte sein Business in den Kinderschuhen. Da wäre es unzumutbar gewesen, sich um etwas zu kümmern, das noch nicht einmal Kinderschuhe brauchte. Weil ich schon immer ein außergewöhnlich einfühlsamer Mensch war, konnte ich dafür volles Verständnis aufbringen. Bei meiner Großmutter aufzuwachsen war zudem das größte Glück.
Meine Großmutter war eine tolerante Frau. In ihrem Badezimmer fühlte ich mich sicher. Bereits als Junge, in dessen Alter das Türenabschließen eine kleine Wissenschaft für sich ist und dem eine recht penetrante innere Stimme noch davor warnt, aus Angst, besagte Tür würde sich aus irgendeinem Grund nicht mehr öffnen lassen. Versperrte Türen sind mir heute noch unheimlich. Im Badezimmer meiner Großmutter brauchte ich den Schlüssel nicht umzudrehen. Sie wusste, was ich dort tat. Sie musste es einfach wissen. Ihr Haus war klein. Die Wände hatten nicht nur Ohren, sondern auch Münder. Aber meine Großmutter ließ mich machen. Sie war tolerant, verständnisvoll und sie liebte mich. Wenn ich darüber nachdenke, liebten mich alle Erwachsenen. Insbesondere alte Menschen. Ich war in der Tat liebenswert. Mein goldblondes Haar war an den Schläfen zu feinen Locken geringelt. Eine Stubsnase und himmelblaue Augen. Ich war von kleiner Statur. Nicht so klein, dass es lächerlich wirkte, aber auch nicht größer, als es für eine goldlockige Stubsnase angebracht war. Ich denke, mein Aussehen allein war nicht der Grund für meine Beliebtheit bei den Erwachsenen. Ich konnte reden. Schon früh wusste ich zu jedem Thema etwas zu sagen. War es Politik, Geschichte, Kultur, Sport oder aber Übersinnliches. Dabei war ich ein mäßig guter Schüler. Im oberen Mittelfeld. Ein Genie war ich nur insgeheim. Mein Geheimnis ist die Mathematik. Alles, aber auch wirklich alles, lässt sich errechnen. Auch Antworten und Gesprächsthemen. Ich erspare dir die Einzelheiten. Nur so viel: Die Anzahl der bereits gewechselten Worte und die Anzahl eines einzelnen sich wiederholenden Wortes geben Ausschlag. Hat man dieses Wort eruiert, ist es ein Leichtes, sich die baldigst folgende Frage auszurechnen. Einen guten Mathematiker zeichnet sein tiefes Verständnis für Zahlen aus. Ein exzellenter Mathematiker allerdings muss nur eines können; Zuhören. Zuhören, bis genug Worte gefallen, die daraus konsultierenden Fragen und Themen errechnet und darauf entsprechend reagiert werden kann. Was bringt es, ein guter Mathematiker zu sein, wenn man ein schlechter Mensch ist? Die Menschen wollen sich verstanden fühlen. Ihnen dieses Gefühl zu geben, hatte für mich immer schon hohen Stellenwert. Letztendlich ist das Glück deiner Nachbarn die Güte deines Schlafes. Aus diesem Grund war ich auch nie ein Genie. Genies sind kalt. Ihre soziale Ader ist verstopft von Zahlen, Fakten und Theorien. Das Leben ist ihnen fremd. Ich aber liebte das Leben, liebe es immer noch. Und ich liebte die Menschen und deren Leben. Mein mathematisches Genie verwendete ich ausschließlich darauf, die Welt für meine Mitmenschen zu optimieren. Folglich auch für mich. Das war ein Nebeneffekt. Ein Kollateralbonus. Einen anderen Nutzen der Mathematik habe ich nicht erkannt. Zahlen. Was sind schon Zahlen? Glück hingegen ist alles. Und die Erwachsenen, mit denen ich mich abgab – Freunde meiner Großmutter meist – waren glücklich mit mir. Ich hatte zu meinem Leidwesen keine Freunde meines Alters. Oft, wenn die Kinder gruppenweise durch die Straßen unseres Wohnortes zogen, packte mich der starke Wunsch, mich ihnen einfach anzuschließen. Einmal nur hatte ich diesem Verlangen nachgeben, mir in meine Jeans ein Loch gerissen und ein T-Shirt angezogen, das meine Großmutter zu den Sachen für den Sozialmarkt gegeben hatte, da es mir zu klein war. Die Kinder aber trugen immer solche Sachen. Zu klein, zu eng, zu kurz, zerrissen, fleckig. Umteufelzeug nannten deren Eltern das. So ein Umteufelzeug zog ich mir an und rannte zur Tür hinaus. Ich hatte mir eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort ausgerechnet, wo ich mich ihnen unauffällig anschließen könnte. Meinen Berechnungen zufolge, würde bis zirka vier Uhr nachmittags niemanden auffallen, dass ich dabei war – genug Zeit, damit sich meine Anwesenheit unterbewusst manifestierte und ein intuitives Recht auf Mitgliedschaft in der Gruppe erhielt. Beinah sofort jedoch, als ich mich unter die Kinder mischte, musste ich erkennen, dass das Prinzip der mathematischen Errechnung des Glücks bei Kindern nicht griff. Ein Mädchen flüsterte ihrer Freundin etwas ins Ohr, woraufhin diese laut lachte und den Jungen, der neben ihr stand, mit dem Ellbogen in die Seite stieß, sodass der mitlachte, ohne jedoch verstanden zu haben, was das Mädchen zum Lachen gebracht hatte, was wiederum die verbliebenen drei Jungen zum Lachen brachte, aus deren Mitte sich der massivste löste und mir mit der flachen Hand kräftig gegen die Brust stieß. »Schleich dich, Freak!« Und das tat ich. Seine Berührung hinterließ ein Brennen in meinem Herzen.
Meine Großmutter empfing mich an der Schwelle. Ihr Blick gefiel mir nicht. Es lag so viel Traurigkeit dort, wo Mitleid hätte sein sollen. Mein Magen krampfte sich zusammen und mein Herz – immer noch heiß und rot, - schlug schnell. Ich fühlte mich schuldig, so schuldig. »Oma, im Vogelhaus ist kaum noch Futter«, beeilte ich mich zu sagen, bevor sie meine Schuld erkennen und diese ihre Traurigkeit noch befeuern würde. »Die Kernderl sind im Schuppen, Jungerl«, erwiderte meine Großmutter mild. »Vielleicht magst du was reinfüllen, hm?«
Ich biss mir auf die Unterlippe, bemerkte just in diesem Moment zum ersten Mal, dass sie dieselbe Augenfarbe wie ich hatte und der Himmel ein ganz anderes Blau und holte dann tief Luft.
»Ich wollte eigentlich noch das Bad putzen«, sagte ich bestimmt.
Meine Großmutter tätschelte mir die Wange und nickte.
»Mach das, Jungerl.«
Ich lächelte tapfer und wischte an ihr vorbei ins Bad. Sie sagte nie etwas. Nie. Das rechnete ich ihr hoch an. Meine Großmutter war eine tolerante Frau und voller Fantasie.
Ich verliere den Faden.
Wo war ich stehengeblieben. Ah ja!
Kleine Tiere. Vögel. Ich erinnere mich an einen furchtbaren Knall. Mir blieb das Herz stehen. Kurz fühlte ich einen Druck auf dem Brustkorb, als hätte jemand ein heißes Bügeleisen darauf gepresst. Ich starrte auf das Fenster, erwartete, dass es bersten würde, erwartete einen zweiten Knall, einen Bombeneinschlag. Sirenen. Das Geräusch von Radios, die angekurbelt werden müssen. Nichts. Ich kroch auf die Fensterbank und spähte hinaus. Der Regen hämmerte gnadenlos gegen den geschotterten Platz hinter dem Haus. Ein Buchfink war gegen die Fensterscheibe geflogen. Sein kleiner Körper zuckte. Ich zog meine Regenjacke an und ging hinaus.
Einen Vogel in den Händen zu halten ist wie ein Organ zu halten. Es war so, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Sein Schnabel war leicht geöffnet. Sein Herz schlug schnell. Behutsam barg ich ihn in meinen Händen, schützte ihn vor dem Regen und der Maikälte. Dann nahm ich mit der freien Hand meine Kappe ab und setzte den Vogel hinein.
„Du darfst dich nicht aufregen. Dein Herz ist ohnehin schon viel zu schnell. Nein, verschwende keinen Gedanken daran, ob du mir trauen kannst. Nein, denk nicht darüber nach, woher diese Wärme kommt.“ Je mehr ich dem Vogel zuflüsterte, desto mehr wurde mir klar, dass ich nicht mehr tun konnte, als den Mund zu halten. Alles regte ihn auf, brachte sein kleines Herz zum Flattern. Deshalb setzte ich mich mit der Kappe auf dem Schoß auf die Gartenbank und hielt meine Hand über den bebenden Federkörper. Ich konzentrierte mich auf das Leben, stellte mir vor, wie es aus mir heraus in seinen Leib rann. Als ich spürte, wie meine Handfläche heiß wurde, erschrak ich über die Tatsache, dass es funktionierte. Die Energie war fühlbar, fassbar. Der Vogel in meiner Kappe gab einen heiseren Laut von sich. Ein Beben durchlief seinen Körper. Er streckte die Flügel aus. Ich gab ihm von meinem Leben. Er starb so, als würde er fliegen.
Das war an einem Tag, da war ich etwa zwölf Jahre alt. Bereits am frühen Morgen hatte es stark geregnet. Dazu ging ein böiger Wind. Ich hatte meinen Vater angebettelt, mich mit dem Auto zur Schule zu fahren. Ich glaube, er hörte mich nicht. Ich war wohl zu leise. Ich bin oft zu leise.
Sie lauerten mir vor der Schule bei den Fahrradständern auf. Robert hatte genauso blondes Haar wie ich. Ich war fest davon überzeugt gewesen, dass wir Freunde werden würden. Müssen! Aber schon nach dem ersten Tag in der neuen Schule hatte er mich eines Besseren belehrt, indem er mir die Faust in den Magen gerammt und mich Schleimscheißer genannt hatte. Ich hasse Kraftausdrücke. Aber es nutzte nichts, ihm das zu sagen. Auch mein Name zeigte keine Wirkung.
An diesem regnerischen Morgen bei den Fahrradständern war Robert Rob, der Anführer der coolen Jungen. Ich war Schleimscheißer. Sie packten mich unter den Armen und schleiften mich in eine Ecke, die nicht einsehbar war. Dort standen zwei Mädchen und rauchten. Als die Jungen mit mir auftauchten, schnippten sie ihre Zigaretten weg. Die größere, ich glaube ihr Name war Lena, zog sich ihre Kapuze über den Kopf und lief durch den strömenden Regen zum Eingang der Schule hinüber. Ihre Freundin hiefte umständlich ihren Rucksack über den Kopf. Sie trug nur ein dünnes Sweatshirt. Ich fing an, um mich zu treten, schrie, dass sie mich loslassen sollten. Aber ich hatte keine Chance. Das waren vier gegen einen. Ich war klein und dünn. Schließlich gelang es mir, den Knirps aus der Seitentasche meines Rucksackes zu ziehen. Ich warf ihm dem Mädchen vor die Füße. Ihr Lächeln. Sie hatte ein Mohnkorn zwischen den Vorderzähnen. Dann rannte sie unter meinem Schirm hinter ihrer Freundin her. »Bist ein Kavalier, hä, du Arsch?«, bellte mich Robert an. »Arschkavalier!« »Arschklavier!« Ich biss die Zähne zusammen, als sie mich gegen die Wand drängten, und machte mich auf die Schläge gefasst. Schläge … ich schloss die Augen, lehnte den Hinterkopf gegen den kalten, feuchten Beton. Aber die Schläge blieben aus. Stattdessen zogen sie mir die Hosen aus. Ich schlug die Augen auf, als ich die kalte Luft auf meiner nackten Haut spürte. Robert knüllte meine Unterhose und meine Jeans zu einem Ball zusammen und warf sie auf den Boden. Es gab ein großes Gejohle, als er darauf sein Wasser ließ. In diesem Moment hörte ich die Schulglocke schrillen. »Komm nicht zu spät, Arschklavier«, zischte Robert mir ins Ohr. Dann ließen sie mich los. Ich blickte Robert und seinen Freunden hinterher.