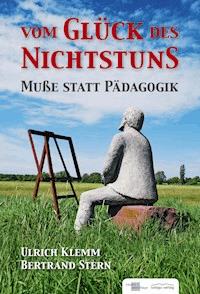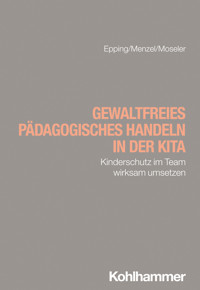
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
KiTas müssen sichere Orte für Kinder sein. Dies erfordert eine klare Ausrichtung der pädagogischen Arbeit an Kindeswohlkriterien und die (machtkritische) Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns. Anhand von Praxisbeispielen legt das Buch die gesetzlichen Grundlagen des institutionellen Kinderschutzes dar und ordnet das Thema berufsethisch ein. Dabei werden Leitlinien gewaltfreien pädagogischen Handelns ebenso vorgestellt wie Möglichkeiten, mit (Verdachts-)Fällen grenzverletzenden Verhaltens umzugehen. Darüber hinaus stellen die Autorinnen und Autoren zahlreiche Methoden zur Auseinandersetzung mit dem Thema in der eigenen Einrichtung zur Verfügung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Einführung
Teil 1: Theorie
1 Ein Blick auf grenzachtendes und gewaltfreies pädagogisches Handeln
1.1 Eine fachliche Einordnung von grenzachtendem und gewaltfreiem pädagogischen Handeln
Zwang muss erklärt werden
1.2 Der Zusammenhang von grenzachtendem und gewaltfreiem pädagogischen Handeln und der eigenen Biografie
1.3 Die Wechselbeziehung von Grenzen pädagogischer Möglichkeiten und grenzverletzendem Verhalten
2 Rechtliche Einführung in grenzachtendes und gewaltfreies pädagogisches Handeln in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
2.1 Internationale (Schutz-)Rechte von Kindern in Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe
2.2 Nationale (Schutz-)Rechte von Kindern in Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe
2.3 Der pädagogische Auftrag in Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe
3 Einordung des Themas »grenzachtendes und gewaltfreies pädagogisches Handeln« in berufsethische Maßstäbe der Sozialen Arbeit/Frühpädagogik
3.1 Nationale berufsethische Perspektive
3.2 Internationale berufsethische Perspektive
3.3 Zwischenfazit
4 Institutioneller Kinderschutz geht alle an – ein akteursübergreifendes Modell
5 Standards zur Verhinderung von grenzverletzendem Verhalten durch Fachkräfte und Implementierung eines Verfahrens zum Umgang mit Verdachtsmomenten institutioneller Kindeswohlgefährdung in einer KiTa
5.1 Einführung
5.2 Zur Notwendigkeit eines Leitbildes
5.3 Zum Umgang mit Verdachtsfällen
Der Beginn eines Fallgeschehens
Die Fallbearbeitung
Untersuchung des Verdachtsfalls durch externe Fachleute
Freistellung der betroffenen Fachkraft
Das Ende des Fallgeschehens
6 Die KiTa-Leitung: Schlüsselrolle im institutionellen Kinderschutz
Teil 2: Methoden
7 Methoden zur Bearbeitung des Themas »grenzachtende und gewaltfreie Erziehung« mit pädagogischen Teams
7.1 Methodenblatt: »Ist das schon übergriffig?!« (Teamreflexion)
7.2 Methodenblatt: »... und wie fühlt es sich an?«
7.3 Methodenblatt »Das wird man wohl noch sagen dürfen«
7.4 Methodenblatt: »Solang du deine Beine unter meinem Tisch stellst ...«
7.5 Methodenblatt: »Können wir wirklich über alles reden?«
7.6 Methodenblatt: »Was ich dir schon immer sagen wollte ...«
7.7 Methodenblatt: »Die armen Kinder in Afrika«
7.8 Methodenblatt: »Sätze, die beflügeln können«
7.9 Methodenblatt: »... und andererseits, dann ...«
7.10 Methodenblatt: »Bei uns doch nicht! ... oder vielleicht doch?«
7.11 Methodenblatt: »Jede Meinung zählt! Lasst es uns zusammentun«
7.12 Methodenblatt: »Das ist eindeutig am wichtigsten!«
7.13 Methodenblatt: »Also, ich sehe das so.«
7.14 Methodenblatt: »Jetzt reden wir!«
7.15 Methodenblatt: »Sollen die denn dann bald alles allein entscheiden?«
7.16 Methodenblatt: »Ich sehe was, was du nicht siehst ...«
7.17 Methodenblatt: »Gemeinsam schaffen wir das ...!«
7.18 Methodenblatt: »Schatzkiste«
7.19 Methodenblatt: »Mein Kompass«
7.20 Methodenblatt: »Die Routinefalle und der Umgang mit Macht«
8 Methoden zur Entwicklung und Implementierung eines Leitbildes zum gewaltfreien und grenzachtenden pädagogischen Handeln mit Teams als Fundament für den institutionellen Kinderschutz
8.1 Partizipativer Einstieg als Kick-off in den Arbeitsprozess
8.2 Teilprozess 1: Arbeit mit den pädagogischen Fachkräften
8.3 Teilprozess 2: Arbeit mit der Leitungsebene
8.4 Finalisierung der Ergebnisse aus den Teilprozessen und erneute Einbindung aller (vieler) Mitarbeiter*innen
8.5 Implementierung des Leitbildes in die Teams und Einrichtungen des Trägers
8.6 Kommunikation des Leitbildes in die Elternschaft und Öffentlichkeit
8.7 Wachhalten des Leitbildes in den Teams und Einrichtungen
Anhang
Sammlung der Fallvignetten
Literatur- und Quellenverzeichnis
Die Autor*innen
Dennis Epping, staatlich anerkannter Erzieher, staatlich anerkannter Sozialpädagoge, Pädagoge der frühen Kindheit (B. A.), Kindheits- und Sozialwissenschaftler mit Schwerpunkt Kinderschutz und Diagnostik (M. A.), Doktorand an der Universität Oldenburg, Lehrbeauftragter der Universität Graz (Kinderrechte und Kinderschutz). Zurzeit ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im PEP gGmbH – Internationales Zentrum für Professionalisierung der Elementarpädagogik beschäftigt. Dort begleitet er u. a. die österreichische Bundesinitiative Elementarplus. Im Jahr 2023 wurde er in den Expert*innenbeirat der Stadt Wien (Schwerpunkt: Institutionelles Kinderschutzkonzept) berufen. Seit 2021 kooperiert er mit dem Land Kärnten zu Themen des Kinderschutzes in elementarpädagogischen Institutionen. Er arbeitete über 15 Jahre in KiTas, zuletzt als Verbundleitung. Seit vielen Jahren ist er als Referent in der Erwachsenenbildung tätig.
Prof. Martin Menzel, Diplom-Sozialpädagoge (FH); Master of Arts (Sozialmanagement). Er arbeitet nach beruflichen Stationen in der Heimerziehung und der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe seit 14 Jahren als Verfahrensbeistand (»Kinder- und Jugendanwalt«) in familiengerichtlichen Verfahren, als berufsmäßiger Vormund und als Fortbildner und Forscher zu Kinderschutzthemen. Sein besonderes Interesse gilt dem institutionellen Kinderschutz. Hier berät er Träger der Kinder- und Jugendhilfe bei der Entwicklung institutioneller Schutzkonzepte und überprüft als externe Fachkraft Verdachtsfälle auf institutionelle Kindeswohlgefährdungen. Er ist seit 2016 Lehrbeauftragter und seit 2022 Honorarprofessor und Sprecher des Kompetenzzentrums Kinderschutz an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf.
Sophia Moseler, staatlich anerkannte Erzieherin, Kinderschutzfachkraft und Kindheitspädagogin (B. A.). Nachdem sie fünf Jahre in der KiTa sowohl im Nestgruppenbereich als auch in der Altersgruppe von zwei- bis sechsjährigen Kindern Berufserfahrung gesammelt hat, arbeitet sie seit 2023 als stellvertretende Leitung eines Familienzentrums. Zudem ist sie als Lehrbeauftragte an der Fliedner Fachhochschule tätig.
Dennis EppingMartin MenzelSophia Moseler
Gewaltfreies pädagogisches Handeln in der KiTa
Kinderschutz im Team wirksam umsetzen
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-045337-1
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-045338-8epub:ISBN 978-3-17-045339-5
Einführung
Seit einigen Jahren sind Themen, die den Schutz von Kindern betreffen, Inhalt eines breiten (fachlichen) Diskurses zwischen Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Praxis. Ziel aller Akteur*innen ist es, sowohl einen vorbeugenden Schutz von Kindern als auch ein konkretes Vorgehen bei Verdachtsmomenten möglicher Kindeswohlgefährdung zu etablieren. Das Wohlergehen eines jeden Kindes sollte dabei im Fokus stehen. Den Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe wird seitens des Gesetzgebers eine besondere Rolle im Kinderschutz zugeschrieben. Einerseits sind die Fachkräfte in der Regel professionelle Erstmelder*innen. Andererseits sind sie in der Verantwortung, die Beziehungen zu den Kindern zu gestalten und den pädagogischen Ablauf an den Bedürfnissen und Interessen eines jeden Kindes auszurichten, so dass das Wohl des Kindes zu jeder Zeit gewahrt wird.
Dennoch kommt es im pädagogischen Alltag vor, dass Kinder psychische/emotionale, körperliche und sexualisierte Gewalt durch Fachkräfte erfahren müssen. Welche Haltung brauchen pädagogische Fachkräfte, um grenzachtend tätig zu sein? Wie kann ein grenzachtendes Handeln im KiTa-Alltag gelingen? Was braucht es, damit ein Team einen gemeinsamen Konsens finden kann? Wer trägt Verantwortung für das Gelingen institutionellen Kinderschutzes? Wie können sowohl Kinder vor Übergriffen als auch pädagogische Fachkräfte vor Unterstellungen oder Verdachtsmomenten geschützt werden?
Ziel dieses Buches ist es, dazu anzuregen, sich als einzelne Fachkraft, als (Gesamt-)Team und/oder als Trägerschaft auf den Weg zu machen, sich mit grenzachtendem Handeln in der KiTa auseinanderzusetzen und den Kinderschutz im pädagogischen Alltag zu implementieren. Kinderschutz braucht Wissen, Mut und Mitgefühl. Durch die Auseinandersetzung mit den Inhalten und Methoden kann ein erster Schritt gegangen werden.
Im ersten Kapitel wird ein Blick auf grenzachtendes und gewaltfreies Handeln im pädagogischen Alltag gelegt (▸ Kap. 1). Zunächst wird der Begriff fachlich eingeordnet, bevor der Zusammenhang zwischen der eigenen Biografie und dem professionellen Handeln gezogen wird. Das erste Kapitel schließt mit der Darstellung der Wechselbeziehungen von pädagogischen Möglichkeiten und grenzverletzendem Verhalten seitens der Fachkräfte ab. Dies soll vor allem auch durch den Transfer auf die eigene Tätigkeit gelingen, da beispielhafte Fallvignetten aus dem pädagogischen Alltag in den Text eingewoben sind.
Neben einem fachlich fundierten Wissen über die kindlichen (Grund-)Bedürfnisse bedarf es ebenfalls Kenntnisse über rechtliche Rahmenbedingungen, die den Schutz von Kindern sichern. Daher werden im zweiten Kapitel sowohl nationale als auch internationale (Schutz-)Rechte der Kinder und der pädagogische Auftrag von KiTas beschreibend vorgestellt (▸ Kap. 2).
Ein weiterer Schwerpunkt des Theorieteils widmet sich dem nationalen und internationalen Berufsethos der Sozialen Arbeit (▸ Kap. 3). Aus den gesetzlichen Normen leitet sich der Auftrag zum institutionellen Kinderschutz ab. Die Berufsethik der Sozialen Arbeit beschreibt vertiefend das fachliche Selbstverständnis, nach dem im täglichen Miteinander in der KiTa gearbeitet werden sollte.
Die Kapitel vier und fünf kombinieren Theorie und Praxis, in dem auf theoretischen Grundlagen und aktueller Forschung beschrieben wird, wie institutioneller Kinderschutz erarbeitet und implementiert werden kann (▸ Kap. 4, ▸ Kap. 5).1 Da KiTa-Leitungen eine Schlüsselrolle im institutionellen Kinderschutz zuteilwird, wird ihnen im sechsten Kapitel besondere Beachtung geschenkt (▸ Kap. 6). In den meisten Fällen ist die Einrichtungsleitung die Person, die interne Prozesse koordiniert, (kollegiale) Beratungen anstößt, sich um einzelne Fachkräfte im häufig emotional herausfordernden Mitteilungsprozess kümmert und den Gesamtüberblick behält. Zudem ist die Leitung Bindeglied zwischen den verschiedenen Akteursgruppen im Kinderschutz.
Der zweite Teil des Buches bietet eine Vielzahl an Methoden, die Referent*innen, Trägervertretungen, Leitungen, pädagogische Fachberatungen, Fachaufsichten, pädagogische Fachkräfte u.v.m. nutzen können, um die Haltung sowie Inhalte zur Erarbeitung von grenzachtendem, gewaltfreiem Handeln mit Teams zu nutzen. Abschließend wird exemplarisch ein Prozess einer Leitbildentwicklung zum grenzachtenden und gewaltfreien pädagogischen Handeln im KiTa-Alltag dargestellt (▸ Teil 2).
Wir wünschen Ihnen beim Lesen des Buches viel Freude, erhellende Momente, fortführende Erkenntnisse und bei der Anwendung verschiedener Methoden gutes Gelingen. Mit dem Kauf des Buchs zeigen Sie Interesse für die Wahrung des Kindeswohl und übernehmen Verantwortung, denn der Schutz von Kindern sowohl in familiären, häuslichen als auch in institutionellen Settings geht uns alle an.
Dennis Epping, Martin Menzel & Sophia Moseler
Endnoten
1Ein herzliches Dankeschön gilt dem Träger und dem Team der Städtischen KiTa am Bach Hamminkeln-Dingden sowie dem Träger und dem Team der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Nikolaus Wesel für die Zusammenarbeit sowie die Bereitstellung von Good-Practice-Beispielen.
Teil 1: Theorie
1 Ein Blick auf grenzachtendes und gewaltfreies pädagogisches Handeln
Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) heißt es in § 1631 Abs. 2: »Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafung, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Erziehungsmaßnahmen sind unzulässig.« Durch die rechtlichen Regelungen (▸ Kap. 3) ist ein klares Leitbild zur gewaltfreien Erziehung postuliert worden. Die rechtliche Entwicklung spiegelt die gesellschaftliche Entwicklung und Haltung bezüglich Gewalt als Erziehungsmittel wider. Somit sind jegliche Formen der Gewalt als Mittel der Erziehung, sowohl im privaten als auch im institutionellen Umfeld, nicht zu rechtfertigen (Deutscher Kinderschutzbund 2022).
Doch was bedeutet gewaltfreie Erziehung? Wie ist grenzachtendes Handeln zu definieren?
KiTas sollten ein Ort für Kinder sein, an dem sie sich sicher, geborgen und in ihrer Individualität geschätzt und angenommen fühlen. Ihre Bedürfnisse und persönlichen Grenzen sollten respektiert, geachtet und geschätzt werden. Ebenso sollte die KiTa ein Ort sein, an dem Kinder lernen, ihre Grenzen zu artikulieren und bewusst zu setzen. Gewaltfreie Erziehung sollte selbstverständlich sein. Wissenschaftlich belegt ist, dass Kinder dann ein Selbstwertgefühl und Wohlbefinden entwickeln, wenn sie Geborgenheit durch vertraute Bezugspersonen erhalten. Diese Geborgenheit entsteht durch eine kontinuierliche Betreuung von Bezugspersonen, die die körperlichen und psychischen Grundbedürfnisse von Kindern erfüllen und angemessen und vorhersehbar auf das Kind reagieren (Boll & Remsperger-Kehm 2021a).
Für einen gelingenden Bildungs- und Entwicklungsverlauf von Kindern ist der Aufbau einer emotional tragfähigen und Sicherheit vermittelnden Beziehung in KiTas die Basis (ebd.). Dennoch zeigen aktuelle Studien, dass grenzverletzendes und gewaltsames Handeln in KiTas vorhanden ist (u. a. Boll & Remsperger-Kehm 2021, Hildebrandt et. al. 2021, Maywald 2021, Prengel 2019).
Um grenzachtendes und gewaltfreies pädagogisches Handeln im Rahmen von institutionellem Kinderschutz in KiTas zu etablieren und das Thema in den Fokus zu rücken, ist zunächst eine fachliche Einordnung der Begrifflichkeiten notwendig. Diese stellt die gemeinsame Gesprächs- und Verständnisebene dar.
Zudem sind die Grundbedürfnisse von Kindern als Basiswissen zu verstehen: Unter Grundbedürfnissen werden alle Bedürfnisse verstanden, die für einen Menschen angemessen erfüllt sein müssen, damit eine gesunde Entwicklung möglich ist. Hierzu zählen sowohl physiologische als auch psychische Bedürfnisse. Um die körperliche Gesundheit zu gewährleisten, bedarf es einer ausreichenden Pflege und Ernährung. Schutz, Nähe, Geborgenheit und vertraute Personen sind die Grundlage für psychische Gesundheit (Largo 2014).
1.1 Eine fachliche Einordnung von grenzachtendem und gewaltfreiem pädagogischen Handeln
Um Grenzen von Kindern zu achten, gewaltfreies Handeln als selbstverständlich sowie als Basis des pädagogischen Handelns zu etablieren, ist es von besonderer Bedeutung, sich selbst zu reflektieren und mit den eigenen pädagogischen Selbstverständlichkeiten auseinanderzusetzen. Wenn Sie ins Gespräch mit Kolleg*innen gehen werden, könnten Aussagen getroffen werden, wie beispielsweise: »Ich muss mich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen, mir passiert so etwas nicht« oder »Das verunsichert mich alles sehr, so kann man sich ja nur noch falsch verhalten!«. Die folgenden Inhalte sollen Ihnen helfen, Ihr eigenes Handeln und vor allem die Haltung zum Kind in Ihrer pädagogischen Arbeit zu reflektieren und differenziert betrachten zu können.
Wieso muss ein Kind Essen probieren?
Wer gibt Ihnen das Recht zu bestimmen, wann ein Kind auf Toilette muss und wann nicht?
In welchem Verhältnis stehen Verantwortung, Macht und Gewalt?
Auf diese Fragen wird im Verlauf des Kapitels eingegangen. Zunächst werden wir uns dem Begriff des grenzachtenden und gewaltfreien Handelns nähern. Dies soll Sie dazu befähigen, sich selbst zu reflektieren, aber auch Sicherheit gegenüber Kolleg*innen zu entwickeln, um eine fachlich fundierte Diskussion führen zu können.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Missbrauch von Kindern als Schutzbefohlene diverse Erscheinungsformen haben kann. Hierzu zählen Zwang, alle Formen körperlicher Gewalt, unangemessene Sprache, seelische Grausamkeiten, Stigmatisierung und sexualisierte Gewalt (Enders, Kossatz & Kekel 2010).
Begriffsdefinition: Gewalt
Die Bewertung von Gewalt wird in Abhängigkeit der kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung getroffen wie auch dem geltenden Recht. Dies wird daran deutlich, dass erst im November 2000 der nun geltende § 1631 Abs. 2 BGB (Recht auf gewaltfreie Erziehung) – zuvor noch als »Züchtigungsparagraf« bezeichnet –, novelliert worden ist. In Deutschland wird durch die Gesetzeslage nun klar definiert, welche Rechte Kinder haben. Hieraus ergibt sich das für alle KiTas gültige Leitbild, dem die Fachkräfte nachkommen müssen: eine gewaltfreie Erziehung (Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e. V. 2022).
»Allgemein wird unter Gewalt der Einsatz von psychischem oder physischem Zwang gegenüber Menschen verstanden, wie auch die physische Einwirkung auf Sachen oder Tiere. Aus soziologischem Blickwinkel bedeutet Gewalt die Anwendung physischer oder psychischer Mittel, mit dem Ziel einen anderen Menschen gegen seinen Willen a) zu schädigen b) ihn seinen Willen zu oktroyieren oder c) ausgeübter Gewalt mit Gegengewalt zu begegnen« (Schubert & Klein 2020).
Die Weltgesundheitsorganisation (kurz: WHO) beschreibt den Begriff »Gewalt« als einen sehr undurchsichtigen und komplexen Terminus, zu dem bisher noch keine exakte wissenschaftliche Definition vorliegt. Die Definition von Gewalt stellt eine große Herausforderung dar, da das, was wir als Gewalt empfinden, von kulturellen und sozialen Einflüssen sowie gesellschaftlichen Normen und persönlichen Werten abhängig ist. Die WHO hat den Begriff der Gewalt in vier Kategorien unterteilt:
körperliche Gewalt,
psychische Gewalt,
sexualisierte Gewalt,
Vernachlässigung.
Die Intention der ausübenden Person stellt das wichtigste Merkmal dar (Boll & Remsperger-Kehm 2021b):
»Der absichtliche Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichem Zwang oder physischer Macht gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, der entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt.« (Dimitrova-Stull 2014, S. 9, aus WHO 2002, S. 5)
Um von Gewalt sprechen zu können, muss demnach die Macht- und Zwangsausübungsabsicht belegt werden können. Hieraus ergibt sich ein Interpretationsspielraum, da es sich bei dem Gewaltbegriff um ein »bewertendes Phänomen« handelt (Boll & Remsperger-Kehm 2021a, S. 29).
»Im institutionellen Kontext der Kindertagesbetreuung kann Gewalt in den genannten vielfältigen Formen vorkommen. Die Arbeiten der letzten zehn Jahre thematisieren hierzu ›unbeabsichtigte Grenzverletzungen, Übergriffe und strafrechtlich relevante Formen der Gewalt‹ (Enders et al. 2010, 1 f.) ›körperliche und seelische Gewalt und entwürdigende Maßnahmen‹ (Hundt 2016, 24 f.) ›subtile Formen von Gewalt, seelische Verletzungen und gewaltvolles Handeln‹ (Schulz & Frisch 2015, 6 f.), leicht und sehr verletzendes Verhalten (Prengel 2019, 103) sowie destruktives pädagogisches Handeln« (Boll & Remperger-Kehm 2021a, S. 29).
Was ist grenzverletzendes, übergriffiges oder strafrechtlich relevantes Verhalten?
Alle Verhaltensweisen gegenüber Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, bei denen die persönliche Grenze im Kontext eines Versorgungs-, Ausbildungs- oder Betreuungsverhältnisses überschritten wird, sind Grenzverletzungen. Im pädagogischen Kontext eignet sich hinsichtlich eines fachlich fundierten Umgangs mit grenzverletzendem Verhalten eine Differenzierung zwischen Grenzverletzungen, die unabsichtlich verübt werden, Übergriffen und strafrechtlich relevanten Formen der Gewalt (Enders, Kossatz & Kekel 2010).
Unter Grenzverletzungen, die unabsichtlich verübt werden, werden jene verstanden, die aus persönlicher bzw. fachlicher Unzugänglichkeit und/oder einer »Kultur der Grenzverletzungen« entstehen. Grenzverletzungen geschehen in der Regel einmalig oder gelegentlich und sind ein unangemessenes Verhalten von Fachkräften gegenüber Kindern. Hierbei wird die persönliche Grenze des Kindes überschritten. Neben objektiven Kriterien wird die Unangemessenheit des Verhaltens der Fachkraft gegenüber dem Kind auch immer vom subjektiven Erleben des betroffenen Kindes bestimmt (ebd.).
Grenzverletzungen können auch bei Kindern untereinander vorfallen. Es gilt grundsätzlich zwischen unbeabsichtigten und beabsichtigten bzw. hingenommenen Grenzverletzungen zu differenzieren. Wie erwähnt, können Grenzverletzungen auf Grund von unklarer oder fehlender Einrichtungsstruktur, Stresssituationen, fehlendem Fachwissen, oder persönlichen Unzulänglichkeiten wie beispielsweise Unachtsamkeit, fehlender Sensibilität, unzureichender Reflexionsfähigkeit, mangelnder Kritikfähigkeit oder missender Übernahme von Verantwortung für das eigene pädagogische Handeln o. ä. begünstigt werden (Landschaftsverband Rheinland 2019).
Zwischen Grenzverletzungen und Übergriffen ist zu unterscheiden: Bei Übergriffen handelt es sich um Situationen und Momente, die einen mangelnden Respekt gegenüber den Kindern zum Ausdruck bringen, auf Grund basalen fachlichen Mängeln geschehen und/oder Ausdruck einer gezielten Desensibilisierung innerhalb der Vorbereitung eines Machtmissbrauchs jeglicher Form sind. Unter strafrechtlich relevanten Formen der Gewalt wird die körperliche Gewalt, Erpressung oder sexualisierte Gewalt verstanden (Enders, Kossatz & Kekel 2010).
Gemäß § 47 SGB VIII sind dem Landesjugendamt unter anderem unverzüglich Meldungen über »Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen«, seitens des Trägers zu erstatten. Die Ereignisse und Entwicklungen sind vielzählig und unterschiedlich:
Straftaten und Strafverfolgung,
Fehlverhalten von Mitarbeiter*innen,
massive Beschwerden,
schwere Unfälle,
betriebsgefährdende und katastrophenähnliche Ereignisse,
personelle und strukturelle Rahmenbedingungen
grenzverletzendes/übergriffiges Verhalten unter Kindern.
Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) betont die große Verantwortung seitens der Träger bezüglich KiTas und der Sicherstellung des Kindeswohls in diesem Kontext. Ein professioneller Umgang sowie etablierte Meldeketten zum sofortigen professionellen Umgang mit Vorfällen dieser Art muss in jeder KiTa verankert sein. Die Meldeverfahren müssen sowohl der Leitung als auch den Mitarbeiter*innen der Tageseinrichtung bekannt sein (LVR 2020).
Es gilt hervorzuheben, dass es sich bei den Ereignissen und Entwicklungen um außergewöhnliche Situationen handelt, die akut und/oder über einen längeren Zeitraum andauern, so dass das Wohl des Kindes beeinträchtigt oder der Betrieb der Einrichtung gefährdet wird. Im Folgenden werden eine Reihe von meldepflichtigen Ereignissen und Entwicklungen aus dem Bereich »Fehlverhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (oder anderen Personen)« vorgestellt (ebd.). Diese dienen der Abgrenzung vom grenzachtenden und gewaltfreien Handeln als pädagogische Fachkraft, zeigen aber auch eine Reihe von geeigneten Beispielen, die das Kindeswohl gefährden könnten.
Der LVR zählt zu den meldepflichtigen Ereignissen im Bereich Fehlverhalten der Mitarbeiter*innen unangemessenes Erziehungsverhalten. Hierunter werden folgende Beispiele angeführt:
Fixieren von Kindern,
Isolieren,
Separieren und/oder Einsperren von Kindern,
Zwangsmaßnahmen beispielsweise beim Schlafen oder Essen,
Verbale und psychische Übergriffe wie ein grober Umgangston, Bloßstellen oder Herabwürdigen,
Androhen und die Umsetzung unangemessener Straf- und Erziehungsmaßnahmen,
Verletzung der Rechte von Kindern (ebd.).
Das Landesjugendamt Rheinland gibt somit eine klare Richtlinie zu Ereignissen bzw. Handlungen von pädagogischer Seite, die geeignet sind, das Kindeswohl zu beeinträchtigen. Ein gewaltfreies und grenzachtendes Grundverständnis der Mitarbeiter*innen trägt dazu bei, solchen Situationen präventiv zu begegnen und diese zu verhindern.
Des Weiteren zählen zu den meldepflichtigen Ereignissen und Entwicklungen:
Aufsichtspflichtverletzungen,
Übergriffe/Gewalttätigkeiten, wie beispielsweise Kneifen, Treten, Zerren, Schlagen o. ä.,
sexualisierte Übergriffe/sexualisierte Gewalt,
Vernachlässigung und/oder Verletzung der Fürsorgepflicht durch beispielsweise mangelnde Getränkeversorgung oder nicht ausreichendes Wechseln von Windeln (ebd.).
Das Projektnetz INTAKT (Soziale Interaktionen in pädagogischen Handlungsfeldern) geht in verschiedenen Vorhaben der in Kürze zusammengefassten Fragestellung »Wie und wie oft werden Kinder in pädagogischen Interaktionen anerkannt oder verletzt?« nach (Prengel 2019). Hierzu wurde die Qualität der Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung und -Interaktion wie auch die der Kind-Erzieher*innen-Beziehung und -Interaktion anhand von direkten Beobachtungen aus der Außenperspektive dokumentiert (Prengel 2019). Die Ergebnisse der Beobachtungsstudie im Elementarbereich zeigen, welche Bedeutung die Auseinandersetzung und Implementierung einer gewaltfreien und grenzachtenden Pädagogik in KiTas hat.
Das Projektnetz INTAKT stellte bei Auswertungen von umfangreichen Beobachtungsstudien, die in KiTas und Krippen durchgeführt wurden, fest, dass 26,7 % der beobachteten Situationen als ambivalent und verletzend einzuordnen sind. 73,3 % der Szenen in Kindergärten (inklusive Krippenbereiche) wurden als anerkennend und neutral kategorisiert. Prengel betont, dass es bemerkenswert sei, wie hoch der Anteil der pädagogischen Interaktionen (7,2 %) ist, die als stark verletzend einzuordnen seien (ebd.).
»Verletzende frühpädagogische Handlungsmuster sind destruktive Kommentare und Anweisungen, das Ignorieren bedürftiger Kinder, negative Zuschreibungen, Anbrüllen, Verweigerung notwendiger Hilfen« (ebd., S. 118). Ausgrenzungen, Drohungen, aggressiven Körperkontakt und Spott gibt es seltener.
Als anerkennende pädagogische Interaktionen werden Hilfe, Trost, Lob, und Anleitung zu Selbstständigkeit des Kindes, zur Kooperation mit anderen Kindern sowie auch konstruktiven Grenzsetzungen eingeordnet. Ein weiteres Ergebnis der Studien ist, dass sowohl sehr anerkennende als auch sehr verletzende Pädagog*innen in der gleichen Einrichtung tätig sein können. Es zeigen sich institutionell bedingte Richtungen im Verhalten. Jedoch gibt es auch in Einrichtungen, die eine überdurchschnittlich gute Anerkennungsbilanz zeigen, häufig einzelne pädagogische Fachkräfte, die stark dazu neigen, Kinder verletzend zu behandeln (ebd.).