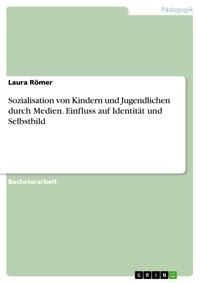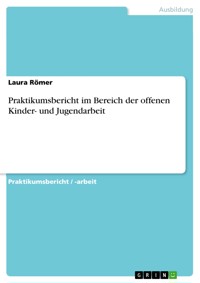13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Pädagogik - Wissenschaftstheorie, Anthropologie, Note: 1,3, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit beschäftigt sich mit folgender Frage: „Gibt es eine allgemeingültige Definition des Bildungsbegriffs?“ Der Bildungsbegriff ist allgegenwärtig, er ist nicht nur einer der Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft, sondern auch in vielen anderen Disziplinen vertreten und gehört zur Alltagssprache der Deutschen. Nicht nur deswegen ist er so interessant, sondern auch, weil es seit Jahrhunderten verschiedene kontroverse Bildungstheorien gibt. In dieser Arbeit wird geforscht, was „Bildung“ überhaupt bedeutet beziehungsweise welche Faktoren beim Definieren eine Rolle spielen. Hierfür wird die Begriffsentstehung knapp umrissen, um die Wandlung des Begriffs deutlich zu machen. Des Weiteren werden verschiedene Lexikon- beziehungsweise Wörterbuchartikel aus pädagogischer, soziologischer und psychologischer Sichtweise dargestellt und unter verschiedenen Schwerpunkten miteinander verglichen. Hierfür werden pro Disziplin mehrere Quellen benutzt, da in ihnen verschiedene wichtige Aspekte zu finden sind. Dabei ist zu beachten, dass nur in wenigen soziologischen und psychologischen Wörterbüchern eine Definition von Bildung zu finden war und diese meist knapp sind. Anschließend folgt eine Diskussion über die oben genannte Frage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
1. Einleitung
2. Historischer Kontext
3. Darstellung der Definitionen
3.1. „Bildung“ aus pädagogischer Sichtweise
3.2. „Bildung“ aus soziologischer Sichtweise
3.3. „Bildung“ aus psychologischer Sichtweise
4.Analytischer Teil
4.1. Gemeinsamkeiten und Unterschiede
4.1.1. Vergleich unter dem Aspekt „Einfluss“
4.1.2.Vergleich unter dem Aspekt „Voraussetzungen“
4.1.3.Vergleich unter dem Aspekt „Ziele/ Ergebnisse“
4.1.4. Vergleich unter dem Aspekt „geschichtlicher Kontext“
4.2. Minimal- Konsens
4.3. Diskussion über die Frage: „Gibt es eine allgemeine Definition?“
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Der Bildungsbegriff ist allgegenwärtig, er ist nicht nur einer der Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft, sondern auch in vielen anderen Disziplinen vertreten und gehört zur Alltagssprache der Deutschen. Nicht nur deswegen ist er so interessant, sondern auch, weil es seit Jahrhunderten verschiedene kontroverse Bildungstheorien gibt.
In dieser Arbeit wird unter der Fragestellung „Gibt es eine allgemein gültige Definition des Bildungsbegriffs?“ geforscht, was „Bildung“ überhaupt bedeutet bzw. welche Faktoren beim Definieren eine Rolle spielen.
Hierfür wird die Begriffsentstehung knapp umrissen, um die Wandlung des Begriffs deutlich zu machen. Des Weiteren werden verschiedene Lexikon- bzw. Wörterbuchartikel aus pädagogischer, soziologischer und psychologischer Sichtweise dargestellt und unter verschiedenen Schwerpunkten miteinander verglichen. Hierfür werden pro Disziplin mehrere Quellen benutzt, da in ihnen verschiedene wichtige Aspekte zu finden sind. Dabei ist zu beachten, dass nur in wenigen soziologischen und psychologischen Wörterbüchern eine Definition von Bildung zu finden war und diese meist knapp sind. Anschließend folgt eine Diskussion über die oben genannte Frage.
2. Historischer Kontext
Der Anfang des Bildungsdenkens führt bis in die Antike zu Platon und Isokrates zurück. Für Isokrates war jemand gebildet, der „Urteilskraft in den wesentlichen Dingen des praktischen Lebens, angenehme und gute Umgangsformen und Selbstbeherrschung sowie Bescheidenheit besitzt.“[1]
Das erste Mal wörtlich die Rede von Bildung war allerdings erst im 14. Jahrhundert. Dort bezog er sich, aufgrund der Verwandtschaft mit dem Wort „Bild“, vorerst auf die äußere Erscheinung des Menschen. In dem Zusammenhang war der Begriff theologisch geprägt, da er von dem Mystiker Meister Eckhart in Verbindung mit einer Bibelstelle, die sich auf die Gottesebenbildlichkeit bezieht, gebracht wurde. [2]
Aus historischer Sicht ist der Begriff der Bildung auch als „Reaktion auf den Erziehungsbegriff [zu] verstehen“.[3] Der Bildungsbegriff aber, bezieht sich, hingegen zu dem Begriff der Erziehung, auf den, der sich bildet, also auf den „Vorgang des Sich-Bildens bzw. der Selbstbildung“ und nicht auf den Vorgang von anderen erzogen/gebildet zu werden. Bildung wirkt sich also von innen, Erziehung von außen aus.[4]
3. Darstellung der Definitionen
3.1. „Bildung“ aus pädagogischer Sichtweise
In der Pädagogik wird darauf Wert gelegt, dass man die Entstehung des Bildungsbegriffs kennt.[5] Denn alte Bedeutungen wie „Schöpfung, Gestaltung, Verfertigung, Verfeinerung und Bildnis“ sind auch heute noch im übertragenen Sinne erhalten geblieben.[6] Auch wenn schon in der Antike von dem Begriff die Rede war, wurde er erst im 18.Jh. in die pädagogische Fachsprache übernommen. Dort wurde er zuerst mit Entwicklung verbunden und ließ sich mit Herausbildung übersetzen.[7]
Bei einer Begriffsdefinition spielt auch die Aufklärungsbewegung und die „Emanzipation“ von Kirche und Staat eine Rolle. Der Mensch, der von Natur aus „Vernunft“ besitzt, sei zur Freiheit, „Mündigkeit“ bzw. zum Selbstdenken aufgerufen, wodurch man Bildung erwirbt.[8]
Einen großen Einfluss übt außerdem die Bildungstheorie von W. von Humboldt auf die heutige Bedeutung aus. So verknüpfte er Bildung mit der Erfüllung der menschlichen Bestimmung und der „Entfaltung der menschlichen Kräfte“.[9] Der Zweck des Menschen sei „die höchste und proportionirlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen.“[10]Der Mensch solle somit seine Fähigkeiten so gut und so gleichmäßig wie möglich ausbilden und miteinander verbinden.
Der Bildungsbegriff bezieht sich auch auf die Beziehung zwischen Mensch und Welt. So z.B. legen die Erziehungswissenschaftler M. Horkheimer und W. Klafki Wert darauf, dass der Mensch die Möglichkeit haben soll, die Gesellschaft mitbestimmen zu können. W. Klafki definiert Bildung als Fähigkeit zur „Selbstbestimmung“, „Mitbestimmung“ und „Solidarität“. Solidarität meint hierbei Verantwortung gegenüber anderen zu übernehmen.[11]
Auch die Pädagogen T. Litt und H. Weinstock haben den Bildungsbegriff, in Verbindung mit Arbeit, Technik und Politik, neu definiert. Als „entscheidendes Moment“ von Bildung sehen sie die „Auseinandersetzung mit dem Anderen und Fremden, das Aushalten von Widersprüchen und das Ertragen von Spannungen und Antinomien“.[12]
Bildung wird oft mit Schule in Verbindung gebracht, aber sie darf nicht nur auf schulische Leistungen reduziert werden, da Bildung im ganzen Leben erweitert, bzw. erworben wird.[13] Wobei Bildung immer auch „Ausbildung“ sei und als solche „ein organisierter Prozeß“. Hierbei sei Bildung zwar ein „Angebot von außen“, aber nur vom Mensch selbst zu verwirklichen.[14]