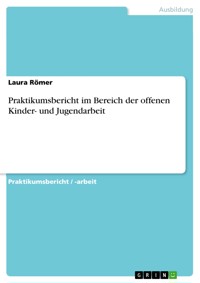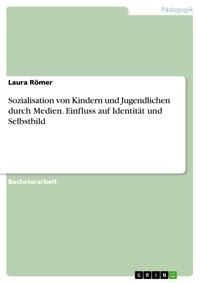
Sozialisation von Kindern und Jugendlichen durch Medien. Einfluss auf Identität und Selbstbild E-Book
Laura Römer
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Pädagogik - Medienpädagogik, Note: 2,7, Universität Duisburg-Essen (Bildungswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel der Arbeit ist es, herauszuarbeiten, ob es einen Einfluss von Internet und Fernsehen als Sozialisationsinstanz auf Kinder und Jugendliche gibt. Die leitende Fragestellung hierfür lautet: „Wie wirken Medien auf die Identität und das Selbstbild von sechs bis 18-Jährigen ein?“ „Sozialisation ist ohne Medien heute nicht mehr denkbar, sie erfolgt unter dem Vorzeichen eines aktiven Subjekts, das sich von klein auf mit den Medien auseinandersetzt, sie zielgerichtet nutzt und sich ihrer bedient, um seinen Alltag zu gestalten, das Wert und Normgefüge seines sozialen Umfeldes, seine Persönlichkeits- und Lebenskonzepte zu prüfen, zu erweitern, zu revidieren.“ Diese Aussage zeigt beispielhaft, die (immer größer) werdende Rolle von Medien bei der Sozialisation. Besonders hervorzuheben ist hierbei das Internet, das neben Recherche und Kommunikation viele Möglichkeiten der Selbstdarstellung bietet. Neben dem Internet ist das Fernsehen ein wichtiges Medium für die Menschheit und somit auch für diese Untersuchung. Oft wird die Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche von Wissenschaftlern kritisch beurteilt. Medien hätten z.B. einen negativen Einfluss auf die Entwicklung und seien manipulativ. Die Sozialisationsforschung beschäftigt sich allerdings kaum mit der zunehmenden Bedeutung von Medien. Die Ursache für diese Vernachlässigung sieht Dagmar Hoffmann darin, dass man in der Sozialisationsforschung die Auffassung hat, dass es keine wechselseitige Beziehung zwischen den Menschen und den Medien gibt und Medien somit nicht als Sozialisationsinstanz gezählt werden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definitionen der Begriffe „Sozialisation“ und „Identität“
2.1 Sozialisation
2.2 Identität
3. Mediennutzung
3.1 Einführung
3.2 Zahlen, Daten und Fakten zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen anhand von der Shell-, KIM-, und JIM- Studie
3.3 Art der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen
3.4 Funktionen von Medien
4. Einfluss von Medien auf die Sozialisation und Identitätsbildung
4.1 Vorstellung der gewählten Medien
4.1.1 Fernsehen
4.1.2 Internet /Smartphone
4.2 Aktuelle Studienergebnisse
4.3 Facebook als Beispiel sozialer Netzwerke
4.4 Beliebtheit von „Pseudo- Dokus“: Familien im Brennpunkt und Berlin- Tag und Nacht als Beispiel
4.4.1 „Scripted- Reality- Serien
4.4.2 „Familien im Brennpunkt“
4.4.3 „Berlin- Tag & Nacht“
4.5 Das Fernsehen als negativer Einfluss auf das Selbstbild und Auslöser für Essstörungen
4.5.1 Das Frauenbild in den Medien
4.5.2 Fernsehen als Auslöser für Essstörungen
4.6 Zwischenfazit
5. Stichprobenuntersuchung in einer offenen Kinder- und Jugendeinrichtung
5.1 Umfrage
5.1.1 Fragebogenerstellung
5.1.2 Auswertung
5.1.3 geschlechterspezifische Unterschiede
5.1.4 Vergleich Kinder und Jugendliche
5.2 Fazit der Umfrage
5.3 Interviews
5.4 Fazit der Interviews im Zusammenhang mit der Umfrage
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Sozialisation ist ohne Medien heute nicht mehr denkbar, sie erfolgt unter dem Vorzeichen eines aktiven Subjekts, das sich von klein auf mit den Medien auseinandersetzt, sie zielgerichtet nutzt und sich ihrer bedient, um seinen Alltag zu gestalten, das Wert und Normgefüge seines sozialen Umfeldes, seine Persönlichkeits- und Lebenskonzepte zu prüfen, zu erweitern, zu revidieren.“[1]
Diese Aussage zeigt beispielhaft, die (immer größer) werdende Rolle von Medien bei der Sozialisation. Besonders hervorzuheben ist hierbei das Internet, das neben Recherche und Kommunikation viele Möglichkeiten der Selbstdarstellung bietet. Neben dem Internet ist das Fernsehen ein wichtiges Medium für die Menschheit und somit auch für diese Untersuchung.
Oft wird die Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche von Wissenschaftlern kritisch beurteilt. Medien hätten z.B. einen negativen Einfluss auf die Entwicklung und seien manipulativ.[2]
Die Sozialisationsforschung beschäftigt sich allerdings kaum mit der zunehmenden Bedeutung von Medien.[3] Die Ursache für diese Vernachlässigung sieht Dagmar Hoffmann darin, dass man in der Sozialisationsforschung die Auffassung hat, dass es keine wechselseitige Beziehung zwischen den Menschen und den Medien gibt und Medien somit nicht als Sozialisationsinstanz gezählt werden können.[4]
Ziel der Arbeit ist es demnach, herauszuarbeiten, ob es einen Einfluss von Internet und Fernsehen als Sozialisationsinstanz auf Kinder und Jugendliche, gibt. Die leitende Fragestellung hierfür lautet: „Wie wirken Medien auf die Identität und das Selbstbild von sechs bis 18- Jährigen ein?“
Untersucht wird die Nutzung von Medien und deren Bedeutung für Heranwachsende auch mithilfe einer Umfrage in einer offenen Kinder- und Jugendeinrichtung sowie diversen Studienergebnissen.
2. Definitionen der Begriffe „Sozialisation“ und „Identität“
2.1 Sozialisation
Zu Beginn des 20.Jh ist der Sozialisationsbegriff entstanden, indem Emile Durkheim zum ersten Mal die gesellschaftliche Bedeutung für die Entwicklung des Menschen herausarbeitete und Sozialisation als „die Vergesellschaftung des Menschen“[5] beschrieb. Damit gemeint ist der Einfluss der gesellschaftlichen Bedingungen auf die Entwicklung der Heranwachsenden.[6]
Der Sozialisationsbegriff sollte außerdem vom Erziehungsbegriff abgegrenzt werden. Erziehung kann als „Sozialmachung“ beschrieben werden und Sozialisation als „Sozialwerdung“.[7] Somit meint Sozialisation Prozesse, die auf die Entwicklung eines Menschen einwirken und nicht wie bei dem Begriff der Erziehung, die absichtliche Einwirkung eines anderen.[8]
Eine klassische Definition lautet: „Sozialisation ist der Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt. Vorrangig thematisch ist dabei wie sich der Mensch zu einem gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt bildet.“[9]
Neben den klassischen Sozialisationsinstanzen Eltern, Schule und Peergroups kann man heutzutage Medien als weitere wichtige Instanz zählen, die auch immer mehr eine besondere Rolle bei der Sozialisation einnehmen, da Kinder schon vom ersten Lebensjahr an mit Medien konfrontiert werden.
Jugendforscher sprechen von „Selbstsozialisation“ von Kindern und Jugendlichen wenn es um den Gebrauch von Medien geht, da sie sich die Geräte und Inhalte weitestgehend selbst aussuchen und dadurch auch ihre eigene Identität und Autonomie erlangen.[10]
2.2 Identität
Wer bin ich? Was zeichnet mich aus? Wie sehen mich andere? Solche Fragen stellen sich die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens. Die Wahrnehmung des Ichs, sich zu reflektieren und zu beurteilen, sind Prozesse, die schon im frühen Kindesalter beginnen und ein Leben lang andauern.[11]
Identität ist somit ein „komplexes und unabgeschlossenes Gefüge, an dem wir in Interaktion mit der sozialen Umwelt kontinuierlich und lebenslang feilen.“[12] Modelliert werden „Eigenschaften, Fähigkeiten, Talente, Werthaltungen und Positionierungen im sozialen Umfeld und in der gesellschaftlichen Welt.“[13]