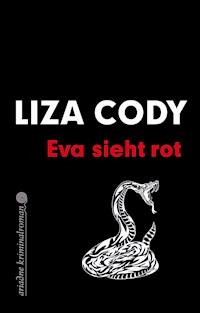13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Birdie Walker! Ich hab gedacht, du bist längst tot !«, ruft David Bowie in einem hippen Londoner Gastro¬tempel beim Anblick einer geheimnisvollen Frau: Bühne frei für Birdie Walker, schnell, skrupellos, härter als das Leben. Und Witwe von Jack … Linnet ›Birdie‹ Walker ist die längst vergessene Gefährtin der großen Rocklegende Jack. Der soll fünfundzwanzig Jahre nach seinem Tod in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen werden. Das heißt, altes Material – unfertige Songs, Probetakes und sonstige Mitschnitte – ist plötzlich Gold wert. Erst recht die sagenumwobenen Filmaufnahmen der Antigua-Sessions. So dass Birdie vielleicht endlich einen Hebel in der Hand hat – gegen die Musikmafia und ihre professionellen Abzocker! Mit Erfahrung und Kalkül tritt Birdie Walker ihre große Pokerpartie gegen die Musikmafia an. Liza Codys heißester Rock ’n’ Roll-Roman, umwerfend zeitlos, in der kongenialen Übersetzung von Pieke Biermann. .
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2019
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Titel der englischen Originalausgabe: Gimme more
© 2000 by Liza Cody
Pieke Biermanns Übersetzung erschien zuerst 2003 im Unionsverlag
Neuauflage der Printausgabe: © Argument Verlag 2020
Lektorat: Iris Konopik
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: März 2020
ISBN 978-3-95988-164-7
Über das Buch
Linnet ›Birdie‹ Walker ist die längst vergessene Gefährtin der großen Rocklegende Jack. Der soll fünfundzwanzig Jahre nach seinem Tod in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen werden. Das heißt, altes Material – unfertige Songs, Probetakes und sonstige Mitschnitte – ist plötzlich Gold wert. Erst recht die sagenumwobenen Filmaufnahmen der Antigua-Sessions. So dass Birdie vielleicht endlich einen Hebel in der Hand hat – gegen die Musikmafia und ihre professionellen Abzocker!
Mit Erfahrung und Kalkül tritt Birdie Walker ihre große Pokerpartie gegen die Musikmafia an. Liza Codys heißester Rock ’n’ Roll-Roman, umwerfend zeitlos, in der kongenialen Übersetzung von Pieke Biermann.
Über die Autorin
Liza Cody (* 1944) wuchs in London auf, wurde an einem üblen Mädcheninternat zur Legasthenikerin, studierte dann Kunst und arbeitete u. a. als Roadie, Fotografin, Malerin und Möbeltischlerin sowie in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett, bevor sie zum Schreiben kam. Ihre Kriminalromane um die Londoner Privatdetektivin Anna Lee wurden mit etlichen Preisen ausgezeichnet, in viele Sprachen übersetzt und fürs Fernsehen verfilmt. In den Neunzigern begann sie mit der weltweit als Genrebreaker berühmt gewordenen Bucket-Nut-Trilogie um Catcherin Eva Wylie, für die sie u. a. den Silver Dagger erhielt. Es folgten Storys und sechs weitere Romane, darunter »Lady Bag«, ausgezeichnet mit dem Deutschen Krimi Preis 2015. 2019 erhielt sie den Radio Bremen Krimipreis für »Ballade einer vergessenen Toten« und ihr kriminalliterarisches Lebenswerk ausgezeichnet. Liza Cody lebt heute unweit von Tochter und Enkeln in Bath.
Liza Cody
Gimme more
Deutsch von Pieke Biermann
Vorbemerkung von Else Laudan
Natürlich wissen wir alle, dass das Musikbusiness brutal ist, korrupt, frauenfeindlich, ein Killer. Leichen pflastern seinen Weg, nicht nur die des Club 27, auch vergessene Tote wie die geniale Elly Astoria aus Codys letztem Roman, der Ballade. Die große Abzocke und das Schicksal unter die Räder gekommener Musiker*innen sind Thema unzähliger Songs, Romane und Reportagen. Aber mit Linnet ›Birdie‹ Walker erschuf Liza Cody eine Figur, deren titelgebender Schlachtruf Gimme more! als Feedbackschleife durch die Dekaden hallt: vor 20 Jahren geschrieben und ernüchternd aktuell, wie wir an #frauenzaehlen sehen; zum Heulen zeitlos, was das Verhältnis von Kunst und Geld betrifft; triumphal laut dank der kratzenden amoralischen Stimme. Gimme more schenkt uns die schamlose Lilith des Rock’n’Roll, die umwerfend giftige Ausputzerin, die es braucht, um all die Verlogenheiten zu brandmarken, gar die wahren Schweine auszutricksen – und dabei weder den Humor zu opfern noch die Magie des Rock’n’Roll. Eine Großtat, die hier wiederaufzulegen ein gewaltiges Vergnügen ist, eine tiefe Verbeugung und ein kulturelles Fanal.
Liza Cody über die Rockmusik: »Es ist ein ur-uralter Zauber, und er hat sich die Macht bewahrt, aus blue Gold zu machen. «
Zickentricks
She’s a kindhearted woman, she studies evil all the time. Hat ein großes Herz, die Kleine,
Die Zicke, die die leeren Nebensitze immer mit ihren Taschen vollpackt, bin ich. Wer sich neben mich setzen will, muss erst mal fragen. Auch in der Holzklasse. Erst recht in der Holzklasse.
Es war voll und heiß im Zug. In den Gepäcknetzen Mäntel wie Dämmmaterial zusammengerollt. Kreischende Kinder, ausgefranst und außer sich. Die anderen Fahrgäste müde, bemüht, die Kinder auszublenden. Ich hatte den Holzklassenblues.
Warten. Die Türen würden erst in ein paar Minuten schließen. Allmählich, nach dem ersten Gewühl, legte Lethargie sich über das Abteil.
»Äh, ’tschuldigung.«
Ich sah hoch in ein bleiches, zuckendes Gesicht.
»Ich hab ’n Problem, könnten Sie mir helfen?«
Ich schob den Kopfhörer von den Ohren. »Kommt drauf an.«
»Nämlich, meine Frau und ich, also wir ham echt ’n Problem«, fing er an. »Wir müssen nach London, aber ich hab kein Geld, weil, also, der Scheck vom Sozialamt, der is noch nich da, und jetzt sind wir im Zug und ham keine Karte.«
Er redete hastig, sah dauernd hinter sich und schwitzte.
»Und wenn der Schaffner kommt, fliegen wir doch raus, und das kost’ Strafe, aber wir müssen doch unbedingt nach London zu unsrer Kleinen, die is doch im Krankenhaus. Im Kinderkrankenhaus. Die is doch ganz krank.«
Ich wollte durch das Abteil gucken, ob der Schaffner unterwegs war, aber der Mann stand mir im Blick. Auch seine Frau konnte ich nicht sehen.
»Wärn bloß zehn Pfund«, fuhr er fort. »Pro Nase. Also, zwanzig Pfund. Ich hätt Sie wirklich nich gefragt, wenn ich nich so verzweifelt wär. Sie kriegens auch gleich wieder. Mein Sozialbetreuer holt uns nämlich ab in Paddington. Wär nur für ’ne Viertelstunde – geht das? Is mir wirklich peinlich, so was zu fragen, aber der Schaffner is unterwegs, und wir sind echt verzweifelt.«
Er ließ mir keine Zeit zum Überlegen. Ich verzog langsam meinen Mund zu einem Lächeln.
»Bitte«, er schwitzte und zuckte, »könnten Sie helfen?«
»Okay.«
»Ach, lieber Gott, danke!« Er streckte die Hand aus. »Nur zwanzig Pfund.«
»Beruhigen Sie sich erst mal. Setzen Sie sich her, Sie und Ihre Frau.«
»Das Geld.« Er hielt noch immer zitternd die Hand ausgestreckt.
»Ich regle das mit dem Schaffner, wenn er kommt. Das geht mit Kreditkarte.«
»Ehrlich?«, sagte er. »Ach toll – ich hol meine Frau.«
Und weg war er. So schnell, dass er mein ach so hilfsbereites, wohlwollendes Lächeln verpasste. Schade eigentlich.
Ich reckte den Hals und sah ihn hinter mir auf die nächste Frau zusteuern. Auch auf sie redete er hastig ein. Er schwitzte noch immer und hatte dieses nervöse Zucken. Auch das war also nicht seine Frau.
Es geht mich ja nichts an, wie andere Leute an ihren Lebensunterhalt kommen. Aber diese Frau hatte zwei kleine Kinder im Zaum zu halten, und das ist kein Kinderspiel. Ich finde aber, Leistung sollte belohnt werden, nicht bestraft. Gut, vielleicht auch die Leistung dieses Mannes. Aber doch bitte nicht von einer Frau, die trotz zweier Kleinkinder noch menschenfreundlich genug ist, einem Fremden etwas abzugeben.
Ich stand auf, ging hin und tippte mit meinem ach so hilfsbereiten, wohlwollenden Lächeln dem Mann auf die Schulter. »Na, wie gehts?«
»Scheiße!«, sagte er. »Verpiss dich bloß. Kümmer dich um dein’ eignen Mist.«
Ich sagte nichts. Ich lächelte ihn nur an.
»Kacke!« Er raste weg und sprang aus dem Zug auf den Bahnsteig.
Der Zug ruckte an und fuhr langsam los.
»Was war ’n das eben?«, fragte die Mutter.
Wir fuhren an dem Mann mit den Zuckungen vorbei. Er war auf dem Bahnsteig stehen geblieben, sah, dass wir ihn anguckten, und zeigte uns den Mittelfinger. Dreimal. Derb.
»Wollte der mich betuppen?«
»Ja.«
»Woher wissen Sie ’n das?«
»Ich hatte ihm angeboten, seine Fahrkarte mit Plastik zu bezahlen«, erklärte ich ihr. »Aber der will keine Karte. Der will Bargeld.«
Sie wurde rot. »Ach.«
Ich ging zurück zu meinem Platz und dachte nach. Rot werden. Ihr, der Mutter, war es peinlich, dass dieser Mann sie rausgepickt hatte, ihre Schwäche gerochen und ausgenutzt hatte. Bestimmt wird sie dauernd ausgenutzt, von jedem, der sie kennt – ihrem Mann, ihren Kindern, Freunden wie Fremden.
Was den zuckenden Mann angeht – der begnadete Abzocker ist der nicht. Gut, ein paar Sachen konnte man nehmen – die Schnelligkeit oder dass man seinem Opfer keine Chance zum Überlegen gibt oder dass man es sozial in Verlegenheit bringt. So was ist taktisch gut. Aber das mit dem kranken Kindchen war zu plump. Da muss er sich mehr Mühe geben, da darf er keine so glaubhafte Geschichte erzählen. Weniger glaubhafte Geschichten werden eher geglaubt. Wer erfolgreich abzocken will, der muss sich was einfallen lassen und etwas darstellen können. Oder bildhübsch und von einnehmendem Wesen sein. Irgendetwas muss man seinem Opfer als Entschädigung zu bieten haben.
Mit Speck fängt man Bauern, und erfolgreich Klauen beruht auf einer Vertrauensbeziehung, auch wenn die bloß dreißig Sekunden dauert. Der Beklaute muss einem etwas geben wollen. Und als guter Klauer will man ihm gefälligst auch etwas zurückgeben.
Ich selbst hatte früher lange Beine, lange Haare, lange Wimpern und den Schmelz der Jugend. All das hab ich bereitwillig mit Fremden geteilt, und wenn nur für den mageren Gegenwert einer Zugfahrkarte. Ich sah fantastisch aus und musste nie irgendwo irgendwas selbst bezahlen. Und warum nicht? Weil Leute gern mit mir gesehen werden wollten, auch für bloß dreißig Sekunden. Ich sah einfach aus wie das, was Rockstars als Belohnung zusteht. Wer mit seiner letzten Platte auf Platz 1 in den Charts ist, der darf mit einer, die so aussieht wie ich, durch die Discos ziehen. Das kann man erwarten. Ich bin im Paket mit drin.
Ich meine, ich war im Paket mit drin. Ich bin das jetzt nicht mehr. Ich kann nicht mehr dienen mit jugendlichem Schmelz. Und hat man je gesehen, dass ein Superstar meiner Generation mit einer gleichaltrigen Frau im Arm durch die angesagten Discos zieht?
Der Zug rollte in Paddington Station ein. Die Mutter kramte Mäntel, Taschen, Kinder und Karre zusammen und wuchtete alles nach draußen. Kein Mensch blieb stehen und half ihr. Ich auch nicht. Ich hatte ihr zwanzig Pfund gespart – das war meine gute Tat für den Tag.
Aber als ich an ihr vorbeigehen wollte, sagte sie: »Ich hätte mich doch bedanken müssen, aber ich war so durcheinander.«
»Schon gut.« Ich wollte vorbei und weiter.
»Doch, das hätt ich. Ich hab die zwanzig Pfund gezückt wie so ’n Schaf. Dabei kann ich mir das gar nicht leisten.«
»Schon klar.« Ich habe mich gequält abgewandt.
»Also, vielen Dank.«
Ihr krabbelkleiner Sohn hat mir ein blendend süßes Lächeln geschenkt und wortlos seine Chips-Tüte hingehalten.
Ich hab einen Kartoffelchip genommen. Wenn ein Mann einem etwas schenken will, dann soll man es annehmen. Selbst wenn er erst drei und das Geschenk nur ein Kartoffelchip ist. Das ist eben das, was er zu bieten hat.
Gehört auch zum Zocker-Einmaleins. So was weiß man im allerersten Moment: Was verschafft einem Beklauten das Gefühl, dass er gut weggekommen ist? Der richtige Preis ist die halbe Miete.
Mr. Zuck hatte meinen Preis auf zwanzig Pfund angesetzt, genauso hoch wie den für die überforderte Mutter. Deshalb fühlte ich mich plötzlich gequält. Zwar tröstete mich der Gedanke ein bisschen, dass Mr. Zuck für einen guten Abzocker viel zu plump und für die Feinheiten der Preisgestaltung vermutlich komplett unbegabt war. Aber ein Schlag in mein Selbstwert-Kontor wars trotzdem.
Zwanzig Pfund? Mr. Zuck – das ist vielleicht ein Preis für Sie, aber doch nicht für mich. Doch nicht für so eine Braut. Nicht mal heutzutage. Ich hab nichts zu tun mit festen Einkommen. Ich verbringe meine Tage auch nicht ausschließlich in Gesellschaft von zwei kribbeligen Krabbelkindern. Obwohl ich mich manchmal, wenn mir eins von denen mit diesem blendend süßen Lächeln begegnet, frage, ob mir etwas entgeht.
Die reine Sentimentalität. Ein blendend süßes Lächeln kann jeder haben. So was hatte ich früher auch, und ich habs auch gnadenlos eingesetzt.
Lächeln ist eine Maske. Mr. Zuck hat eine andere aufgehabt. Seine Maske bestand aus Angst und Augenbrauengezucke. Aber er war zu nervös. Er hat sein Geschwitze nicht im Griff gehabt, und zwar weil er nicht dran geglaubt hat. Man muss an seine Maske glauben, wenn man sie im Griff haben will – ich zum Beispiel glaube an das Lächeln und an Tränen und an die Macht eines Songs.
Ich bin, als ich noch sehr jung war, selber mal reingefallen auf einen Song, ein Lächeln und eine Träne. Ein legendärer Bluesmann namens Dude Dexxy hat mir erzählt, Honey Crawl sei ihm eines Sommerabends eingefallen, genau in dem Moment, in dem ich ins Crawdaddies gekommen war. Ich hatte mich am Türsteher vorbeigeschummelt – ich war noch minderjährig –, stand gerade rum und suchte nach einer Ecke zum Abtauchen, da sagt plötzlich die tiefe dunkle Stimme auf der Bühne: »He, Kleine. Du. Ja, du. Komma her. Is extra für dich jetz.« Für mich. Der hat mich bemerkt. Ich gehe zur Bühne, ich setze mich buchstäblich ihm zu Füßen, da fängt der an mit Honey Crawl und der Saal fängt an zu kochen. Ich war ja noch so grün, ich hatte ja keine Ahnung, dass der Song zehn Jahre alt war und er mit dem alle dämlichen Hühnchen anwärmt. Ich sitze einfach da und Bass und Schlagzeug wummern mir durch den ganzen Körper und Dexxys Stimme kriecht mir in die Ohren und weiter bis ins Herz, bis ich das Gefühl hab, gleich zerspring ich.
Ich wusste auch nicht, dass er in Louisiana im Knast gesessen hatte, weil er öfter Minderjährige gebumst und beklaut hatte. Sehr oft. Mir hatte auch kein Mensch gesagt, dass seine Europatournee in erster Linie Flucht vor dem FBI war und dann erst Londons Hunger nach Blueslegenden stillen sollte.
Dass er im Knast war, hat er mir sogar selbst erzählt, später in derselben Nacht, aber in seiner Darstellung klang das für mich nach irgendwas mit Rassenverfolgung. Was auch nicht völlig falsch ist – jedes Zockergenie manipuliert die Wahrheit mit ein paar zarten Nuancen. Und genauso hat Dexxy mich manipuliert.
Komischerweise bin ich heute noch stolz darauf, dass Dexxy mich als Opfer rausgepickt, dass er meine Schwäche gerochen hatte. Ich hab noch, als er längst weg war – mitsamt meinem Herzen und einem satten Stapel Kohle von meinem Daddy –, als ich endlich kapiert hatte, dass ich auf einen miesen Trick reingefallen war, als ich mitgekriegt hatte, wie alt Honey Crawl ist, genau denselben Schauder weiter verspürt. Weil der Song einfach gut ist und weil eine Blueslegende den einmal gesungen hat, um mich rumzukriegen. Und Dexxy hat mich auf meine ganz eigenen Gleise gesetzt. Als er wieder weg war, war ich nämlich selbst Teil der Legende geworden: das minderjährige wilde Kind mit den langen Beinen, das einmal ein Gott berührt und versengt hatte. Es gab ja so viele Musiker, die selber ein Gott werden wollten, die die Kleine auch mal berühren wollten, die ein goldechter legendärer Bluesmann mal versengt hatte.
Dexxy hat mich wirklich versengt, aber er hat mir auch mein Metier gezeigt. Ich hatte zweifellos zu Füßen des Meisters gesessen. Ich war seine Beute gewesen, und das hatte mich ziemlich gebeutelt. Er hat mir damit nämlich vorgeführt, dass man alle möglichen Leute dazu bringen kann, alles Mögliche zu glauben, und dass auch ich glauben will. Kein Mensch ist immun dagegen – nicht mal du, Püppi.
Und irgendwo in meinem unerfahrenen kleinen Hirn hat es klick gemacht und dann war die Frage da: Willst du dein Leben lang Beute bleiben? Oder willst du dich lieber selbst maskieren und die andern abzocken? Jugend plus Schönheit ist eine Fertigmaske. Alle wollen ein Stück von einem abhaben, wenn man jung und schön ist. Warum sollen die nicht dafür zahlen? Warum soll man was verschenken, was die Zeit irgendwann auslöscht? Man hats ja nur kurz, also soll mans nutzen.
Aber das war früher. Und jetzt ist heute. Wie maskiere ich mich heute, wo ich Jugend und Schönheit nicht mehr einsetzen kann?
Ich führs mal vor. Gut aufpassen, ich machs nämlich nur einmal und ich machs kurz.
Genau gegenüber von Paddington Station steht das Great Western Hotel. Man geht ein paar Stufen hoch, dann durch Glastüren und quer durch die Lobby rein in die Damentoilette. Man kontrolliert die Kabinen. Keine besetzt. Also Mantel aus. In den Spiegel sehen. Ich habe ein schlichtes dunkelblaues Kleid mit langen Ärmeln an, dazu Schuhe mit flachen Absätzen und dunkle Strümpfe. Ich bin dezent geschminkt. Ich sehe nach gediegener berufstätiger Frau aus.
Ich stopfe Mantel und Tasche unters Waschbecken. Ich verlasse die Toilette mit einer Illustrierten in der Hand und gehe zielstrebig durch die Lobby. Ich lege die Illustrierte auf eins der Kaffeetischchen, biege rechts ab und gehe ins Restaurant.
Es ist sehr voll, Mittagszeit. Ich halte Ausschau nach jemandem, der schon da ist. Ich tue das auffällig. Niemand vom Personal hält mich auf.
Ich mustere den ganzen Saal, gucke nach rechts und links. Irgendwo muss eine wartende Frau sitzen. Ich weiß nicht, wo, aber ich muss sie schnell finden, denn ich habe nicht viel Zeit.
Da sitzt sie – Typ mittleres Management, schickes Business-Kostüm. Sie ist mit zwei jüngeren Frauen da. Sie klopft mit der Kreditkarte auf den Tisch, um den Kellner aufmerksam zu machen, und unterhält sich gleichzeitig mit den beiden anderen, die gerade ihren Kaffee austrinken.
Nach ihr halte ich Ausschau, auf sie gehe ich zu. Auf dem Weg zu ihrem Tisch lächle ich den Kellner an. Der sieht, ich will jemanden treffen. Sieht, ich habe ein Ziel. Hält mich also nicht auf.
Ich bin jetzt am Tisch. Stelle mich links von ihr hin, genau da, wo sie mit mir rechnet. Sage: »Darfs noch etwas sein, Madam?«
»Ja, die Rechnung.« Sie sieht kaum hoch.
»Haben Sie’s eilig? Soll ich die Karte schon mitnehmen?«
Sie hält mir die Kreditkarte hin. Ich nehme sie geschmeidig aus ihren Fingern. Ich gehe – aus dem Restaurant, durch die Lobby und zurück in die Toilette. Ich ziehe meinen Mantel wieder über und ein buntes Liberty-Tuch aus der Tasche. Das schlinge ich mir locker um den Hals und hänge mir die Tasche über die Schulter. Ich gehe aus dem Hotel. Ich winke ein Taxi heran.
Der ganze Vorgang braucht mehr Zeit für die Beschreibung als für die Durchführung.
Und wie war ich maskiert? Es waren in Wirklichkeit drei Masken. In der Hotellobby mit der Illustrierten in der Hand war ich ein Hotelgast. Im Restaurant war ich ein Restaurantgast auf der Suche nach einem anderen Restaurantgast. Beim Gespräch mit der Frau war ich die Kellnerin. Der Trick ist – Kellnerinnen tragen keine Handtaschen, weibliche Hotelgäste sehr wohl. Und die hat die Illustrierte ersetzt. In welcher Funktion man irgendwo ist, erkennt das Unterbewusstsein an dem, was man anhat, wie man sich gebärdet und was man bei sich hat oder eben nicht. Eine Maske ist folglich alles, was das Opfer gerade erwartet. Ob glänzende Haare über einem hübschen Gesicht oder höflich-geschäftliches Auftreten – die Regeln sind dieselben.
Die Schuhe habe ich im Taxi gewechselt. Das Tuch, die Frisur und mein höfliches Auftreten auch. Lauter Kleinigkeiten – die aber alle dazu beigetragen haben, dass mein schlichtes dunkelblaues Kleid nach Understatement aussah, nach »war bestimmt extrem teuer«. Von so was isst eine Mutter samt zwei kleinen Kindern jahrelang Chicken Nuggets. Das heißt, hat gegessen. Denn das Kleid ist schon seit etlichen Jahren in meinem Besitz.
Jetzt brauche ich einen neuen heißen Fummel, für meinen nächsten Termin. Und ich halte nun mal nicht viel vom Selberkaufen – zumindest nicht, wenn das eine Bank oder eine Kreditkartenfirma genauso gut erledigen kann. Anders gesagt, ich halte nicht viel davon, meine eigene Kreditkarte für so etwas zu verschwenden. Klamottenkaufen für mein eigenes Geld, das ist für mich gleichbedeutend mit Niederlage. Außerdem müsste ich heutzutage einen Haufen Geld anlegen, um wie eine Frau auszusehen, die viel Geld wert ist.
Mein nächster Termin war ein Mann namens Barry, der einen ziemlichen Haufen Geld hat. Ich hatte ihn seit Jahren nicht mehr gesehen, aber davor war er so scharf auf mich gewesen, dass er schon mal gesabbert hatte.
Mir fehlte seinerzeit allerdings die reflektorische Reife für solche Situationen. Inzwischen habe ich Reife eimerweise, und meine Reflexionen haben ergeben, dass ich seine Verknalltheit nie hätte persönlich nehmen dürfen. Barry, mein nächstes Opfer, ist nämlich Engländer und als solcher seinerzeit auf meinen Lover entschieden schärfer gewesen als auf mich. Mich hat er bloß begehrt, weil er den Mann, der mich besaß, beinah besessen bewunderte. Barry war ein reicher Adabei. Ein Typ, der nach Talent und Glamour regelrecht gelechzt hat. Er war unser Trabant, ständig an uns dran und hinter uns herkrabbelnd wie eine Eidechse, die es auf den warmen Stein zieht. Barry brauchte Hitze, konnte selbst aber keine erzeugen.
Tja, mein Opfer ist ein Reptil, und ich bin die Hitze. Er will noch dasselbe wie immer – im Mittelpunkt eines magischen Kreises sein. Obwohl der Zauber längst verflogen ist, die Magie sich gegen sich selbst gerichtet hat und ein Drittel der Zauberkünstler nicht mehr da ist. Auch mein Lover nicht, mein Spielkamerad, der Goldjunge Jack.
Aber an Jack erinnert sich alle Welt. Und Jack definiert auch mich. Verleiht mir Identität, heute noch. O ja – Jack verdanke ich alles. Ich hab ihn überlebt – ich bin seine Rockwitwe.
Also brauche ich ein Rockwitwenkostüm: irgendwas Dunkles, Geheimnisvolles, Tragödisches. Und Schuhe, die meine Beine zur Geltung bringen. Beine sind haltbarer als Gesichter, die müssten die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben, noch erregen können. Durch ein Paar unerhörte »Fuck off!«-Schuhe mit einem Schuss S/M. Von Kopf bis Saum Mysterium, von Saum bis Stöckel Dekadenz, so soll meine Kleidung rüberkommen. Denn jede gute Maske – und jeder, der erfolgreich anschafft – streift die Wahrheit sachte im Vorbeigehen. Und wer erfolgreich anschafft, setzt geklaute Kreditkarten sofort ein und wirft sie dann fort. Zücken, zahlen und zack – weg.
Nach der Einkaufstour bin ich im Savoy abgestiegen. Der Mann an der Rezeption hatte eine handgeschriebene Notiz für mich: »Liebe Birdie, ich hoffe sehr, dass du dich hier wohl fühlst. Erinnert an alte Zeiten, was? Bitte ruf mich an, sobald du da bist. Ich kanns kaum erwarten, dich zu sehen – Barry.«
Ich habe den Mann an der Rezeption gebeten: »Wenn ein Mr. Barry Stears anruft, würden Sie ihm ausrichten, ich bin um acht hier unten? Bis dahin möchte ich nicht gestört werden.«
»Schon notiert.«
Dann bin ich hochgefahren. Und hab mir ein Bad eingelassen. Ich kenne Barry und seine Panik. »Ruf mich an, sobald du da bist.« Unterstrichen. Von wegen. Ich weiß leider, dass Barry spätestens um halb acht abends essen muss, sonst grollt sein Magengeschwür. Ich musste lächeln. Bis hierher waren wir beide ganz die Alten.
Ich hab also erst mal gebadet. Mich ins Bett gelegt. Geruht. Um sieben habe ich beim Zimmerservice Krabbensalat bestellt. Und mich allmählich angezogen. Der Salat ist gekommen. Ich hab ihn gegessen. Ich wollte ja weder Hunger haben noch so aussehen.
Um acht hat das Telefon geklingelt. Ich bin nicht drangegangen. Es hat immer wieder geklingelt, um Viertel nach acht und um halb neun und um Viertel vor neun.
Um neun bin ich nach unten gefahren. Gereckte Hälse und Stielaugen. Wundert das irgendwen? Wieso eigentlich? So einfach, dass auf ein Leben als Promi-Luder nur noch die Unsichtbarkeit folgt, ist die Sache ja nun nicht. Unsichtbarkeit ist auch nur eine Art von Maske. Und wenn die nichts bringt, kommt sie ab. Dann ist man eben eine Erscheinung. Man geht nicht einfach irgendwo rein – man rauscht rein.
Ich rausche. Also gibts Stielaugen und gereckte Hälse.
Barry steht da. Ein Klops im Maßanzug von der Savile Row. Hip dank Designerbrille, denkt er. »Birdie!«, sagt er. »Mein Gott …« Er erwartet eine Entschuldigung, weil ich ihn hab warten lassen. Ich sehs ihm an. Die Erwartung hat sein Gesicht verändert. Er ist jetzt schon aus dem Gleichgewicht.
»Hallo, Barry«, sage ich, als hätten wir uns erst gestern gesehen. »Und – wohin führst du mich aus?«
»Ich dachte eigentlich, wir könnten auch hier essen.« Damit hat er offenbar den Maître die ganze letzte Stunde bei Laune gehalten.
»Ach, weißt du etwa nicht mehr, welche Läden gerade angesagt sind?«
Er nimmt das Duell an. Wir fahren ins Café d’Arte.
So weit, so gut. Ich kriege ihn also noch dazu, dass er mir gefallen will.
Man muss schon als zickiges Luder vorgehen, wenn man einen Mann dazu kriegen will, dass er Eindruck bei einem schinden will. Nettsein verschafft einem weder ein Zimmer im Savoy noch die Souveränität für einen lässigen Auftritt im Café d’Arte. Hat es nie und wird es nie.
Egal, mit was Barry gerechnet haben mag, eine nette Püppi kanns nicht gewesen sein. Eine nette Püppi zieht einem nicht vor der eigenen Nase den Stecker raus. Eine nette Püppi tritt einem auch nicht in die Eier, wenn man dank des Vorabdialogs zur eigenen Ermutigung so viel Spucke im Mund hat, dass man ihr die Korsage vollsabbert. Die petzt nicht ihrem Rockstar-Lover: »Du, Jack – Stears, die Schwuchtel, hat mich grad angebaggert.«
»Tritt ihm in die Eier.«
»Hab ich schon.«
»Mach, worauf du Bock hast.«
Damals hat Jack erst mal gelacht. Aber am nächsten Tag hat er ein Flugzeug gechartert, und wir sind nach Antigua abgehauen. »Scheißreiche Groupietypen. Die halten einen für ihr Eigentum.«
Jack mochte so was nicht. Jack dachte aber auch immer, dass ich auf reiche Männer stehe. Ich hab ihn gelassen. Hat ihn auf Trab und seinen Hunger nach mir wach gehalten.
Als ich ins Café reinrausche, rauscht David Bowie eben raus. Er bleibt so abrupt stehen, dass seine Trabanten hinter ihm aufeinanderrasseln. »Birdie Walker!«, kräht er. »Gott – ich hab gedacht, du bist längst tot!«
»Bin ich auch, für die Welt. Nicht zu sehen, nicht zu kriegen, nicht zu fassen. Kennst du doch selber.«
»Und wie. Ruf mal an.«
Ich rausche vorbei. Das war Schwein! Barry geht fast einer ab – er ist mit einer Frau da, die David Bowie kennt! Barry, wie er leibt und tickt.
Wir nehmen Platz. Bestellen. Barry hätte jetzt am liebsten ein Glas Milch für sein Magengeschwür. Ich sehe zu, wie Vernunft und Narzissmus in ihm kämpfen. Sieger bleibt der Narzissmus, wie immer: Barry bestellt Wein. Ein verräterisches Indiz.
Ich bin total lässig. Lasse meinen Blick durch den Raum schweifen. Barry versucht, meine Aufmerksamkeit zu heischen. Zeigt mir irgendwelche angesagten Jungschriftsteller, irgendeinen Bildhauer, einen Sänger, ein paar Szenelöwen und Politicos und Banker.
»Du hast dich lange nicht mehr blicken lassen«, sagt er.
»Wenn ich hier so sitze, weiß ich, warum.«
»Hat sich alles so verändert.«
»Mindestens dreimal.«
»Ja«, sagt er. »Kommt aber auch alles wieder. Du glaubst ja nicht, wie scharf die neue Generation auf die Musik von früher ist. Auf unsere Musik.«
Ich sehe ihn direkt an. Immerhin hat er so viel Anstand, dass er rot anläuft. Aber er plappert weiter. »Hatt ich dir ja geschrieben. Ich hab ’n Buch dadrüber gemacht und ’n paar Serien für die BBC und Channel 4.«
Er setzt eine Beifall heischende Pause. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Alte Groupies sterben nicht. Die werden Berufsexperten. Musik-Nerds.
»Hatte alles Resonanz«, fährt er hastig fort. »Tolle Kritiken und so. Die Leute kriegen heute den Hals nicht voll.«
Unser Essen kommt. Eine Suppe für ihn, eine Artischocke mit Dekoration für mich. Er schlürft sofort los. Gut so. An einer Artischocke lässt sich ewig zuzeln. Ich kann ihn verfressen aussehen lassen.
»Jack und ’n paar Leute, die ihr damals – äh – kanntet, sind natürlich Hauptfiguren in meinen Filmen. Du bist auch drin – mit den Aufnahmen von den Live-Konzerten in den Docks und in der Hall und andern Gigs. Und mit den David-Bailey-Fotos – die Szene-Birds. Birdie, du warst ja der Rock-Bird an sich, der Inbegriff der Musikerbraut.«
»Nee, echt?« Glaubt er im Ernst, es schmeichelt meiner Eitelkeit, als Rocktussi qualifiziert zu werden? Ja, tut er. Er hat seine ganze eigene Karriere aus der Zeit gebastelt, in der er die Randerscheinung von ein paar Musikern war. Er ist sicher, dass wir aus demselben Holz sind.
Er hat seine Suppe alle. Ich zuzele zierlich an einem Artischockenblatt.
Er plappert weiter: »Ich bin ja jetzt auch ’n bisschen so ’n Promi. So ’n Meinungsmacher oder so.« Er guckt zu, wie ich esse. »Wieso hast du dich eigentlich nie gemeldet, Birdie? Du weißt doch seit zwei Jahren, dass ich auf der Suche nach dir bin. Ich hatte auch mit deiner Schwester geredet, aber die hat mich total abgeblockt.«
Ist die falsche Frage, Barry, wie immer. Du musst nicht fragen, wieso ich mich zwei Jahre lang nicht gemeldet habe, sondern wieso ich mich jetzt melde.
»Wo warst du eigentlich, Birdie?«
»Angeln.«
»Angeln?« Barry ist verblüfft.
Ich nicke und wähle sorgfältig mein nächstes Artischockenblatt.
»Ich dachte, du bist längst mit einem Millionär verheiratet.«
»Wieso das denn?«
»Wieso?« Wieder ist er verblüfft. Er hat sein Urteil über mich nie revidiert. »Weil du immer so gern Geld ausgegeben hast.«
Völlig richtig, Barry. Nur, wenn das alles ist, wieso hab ich dann wohl mit Jack gefickt statt mit dir? Du hast doch, zumindest am Anfang, so viel Geld gehabt, du hättest Jack mitsamt der Band zwanzigmal kaufen können.
»Da hast du recht«, sage ich. »Und das tue ich immer noch liebend gern. Da bin ich richtig gut drin.«
»Ja und? Hast du heute genug?« Das ist der Kern von Barrys Vorstoß. Barry möchte mich, falls das noch nicht klar war, für etwas einnehmen. Andernfalls würde der Mann, dem ich mal in die Eier getreten habe, kein Zimmer im Savoy für mich springen lassen. Der hätte mich ins finsterste Loch gesteckt, das er finden kann.
»Wenn ich es richtig in Erinnerung habe«, plappert er weiter, »ist genug Geld bei dir ’n ziemlicher Haufen.«
»Absolut richtig, Barry.«
Ich lasse mir Zeit mit dem nächsten Artischockenblatt. Ein schmerzhafter Anblick für Barry. Ihm knurrt der Magen, er möchte dringend an seinen nächsten Gang. Es macht ihn ganz kirre, mit anzusehen, wie ich überdrüssig an kapriziösem Grünzeug herumknibbele. Gut so. Dann muss er schneller auf den Punkt kommen. Er glaubt nämlich, dass er damit die Situation in den Griff kriegt. Hunger und Ungeduld sind seine Feinde und meine Freunde.
»Also Birdie – wie gehts dir wirklich zurzeit?«
»Guck mich doch mal an«, sage ich, geschützt durch ein obszön teures Kleid und ein Paar »Fuck Off!«-Trittchen. Genau die Klamotten, die er nicht erwartet hatte an einer Frau, die so lange aus der Szene raus ist. »Außen Silber, innen Gold.«
»Was?«
Ich lasse das achselzuckend so stehen. Das stammt aus einem Song, aus< Take This Hammer. Hat Taj Mahal gesungen. Ich hatte eines Abends mal zu Jack gesagt: »Du, dein Hammer ist auch außen Silber, aber innen hart wie Gold.« Jack fand das geil. Er hat dann so lange an den Akkorden rumgefummelt, bis er mir das Stück vorspielen konnte. Für solche Momente hab ich gelebt. Gott, war er gut. Echt Gold und Silber, jedenfalls wenn er gerade mal nicht abgedreht war. Und wir ausnahmsweise mal allein für uns und still. Einfach alte Platten hören von Blueslegenden, sich die Akkorde einprägen, die Riffs, die Zwischenstücke, und dann nachspielen, mit einem neuen Dreh, als was Eigenes. So geht ein Klassesong aus den alten Händen über in junge. So geht Musik aus alten Ohren über in junge. Und alte Liebe über in neue. So was fängt nie bei null an. Aber du, Barry, du kannst hier hocken und mir beim Artischockenessen zugucken, bis du die Engel im Himmel singen hörst. Du hörst von mir trotzdem nichts von Bedeutung. Weil du nichts von Bedeutung kapierst. In deinen Händen ist kein Klassesong sicher.
»Du bist ein teures Mädchen«, fängt er wieder an. »Du hast Jack ein Vermögen gekostet.«
»Ganz recht. Und jeden Cent wert.«
»Tja, Jack hats wohl so gesehen.«
O ja, Barry, das hat er. Und du wirst nie kapieren, warum.
»Worauf ich rauswill, Birdie – eventuell hast du ja heutzutage nicht mehr das, was du gewohnt warst.«
»Das stimmt.« Ich lutsche das nächste Artischockenblatt aus. »Egal, wie viel da ist, es ist nie genug.«
»Ich bin in der Lage, dir zu helfen«, erklärt Barry vollmundig. »Ich könnte dein Comeback arrangieren, Birdie.«
»Der Traum meiner schlaflosen Nächte. Meine nächste Viertelstunde Weltruhm.«
»Erzähl mir nicht, dass du das nicht toll fandst«, sagt Barry. »Du hast doch den ganzen Wirbel um dich geschlürft. Du hast doch die ganze Zeit keine Zeitung und keine Illustrierte aufgeschlagen, ohne dein Gesicht zu sehen. Erzähl mir nicht, du hättest das nicht gern wieder.«
»Mitsamt dem Ekelkram? Außerdem – das Gesicht damals war ein anderes. Wer will wohl mein jetziges sehen?«
»Du würdest dich wundern. Die sind heute alle fixiert auf den alten Rock-Adel, das sag ich dir. Die ganzen Wurzeln, Tradition – die kriegen den Hals nicht voll.«
Er schweigt. Er will mich zu etwas kriegen und weiß nicht, womit ich zu fassen bin. Ich warte. Knabbere an winzigen Portionen Essen. Ihm knurrt der Magen.
»Die Folge über die Ära Jack war der Hit. Ich hatte Teddy und Goff da drin – die hatten heiße Storys drauf. Mir wär allerdings viel lieber gewesen, dass du dich gerührt hättest, als ich dich gesucht habe, weil so nämlich was gefehlt hat. Du und Jack, ihr wart doch in den Zeiten – in den echt großen Zeiten – quasi an der Hüfte zusammengewachsen. Gut, du warst auch drin, mit den Konzertsachen und den Fotos. Aber eben nicht live, nicht persönlich, so ›was macht eigentlich‹-mäßig. Klar waren die Jungs schon klasse, aber …«
»Rockmusik ist ’ne ziemlich kerlige Branche. Da reichen auch ’n paar Jungs.«
»Hättest du keine Lust, da mal Balance reinzubringen?«
»Da gibts keine Balance.«
Er glotzt mich an. Er glotzt die Artischocke an. Sie ist nicht mal halb gegessen.
»Birdie, da ist Geld drin. Viel Geld für alte Sachen. Ich mach grad ’n Special zum Jahrestag. Eine Exklusivwürdigung für Jack. Hat ’ne super Finanzierung. Ich könnt ’n super Honorar für dich rausholen.«
»Kein Bedarf.«
»Wird ’ne Gedenksendung. Hast du auch keinen Bedarf, die Erinnerung an Jack wach zu halten?«
»Die ist doch sehr wach. Da muss ich mich nicht zum Schaustück machen, bloß damit du profitierst.«
»Du sollst dich gar nicht zum Schaustück machen«, protestiert Barry, »und profitieren würde Jack.«
»Tote brauchen keine Profite.«
Er glotzt wieder die Artischocke an. Sie ist inzwischen sein persönlicher Feind, genau wie ich. Der Kellner kommt und fragt, ob wir jetzt den nächsten Gang wollen.
»Ja«, sagt Barry.
»Nein«, sage ich. Denn jedes Nein von mir erhöht meinen Preis. Da fängt Barry jedes Mal an zu zucken. Zwei Mr. Zucks an einem Tag – darf ein zickiges Luder so viel Schwein haben?
»Okay, Birdie, letztes Angebot: Wenn dir das Honorar fürs Drehen nicht reicht – ich könnte noch etwas bei den Produktionskosten abzweigen.«
»Nee, echt?«, sage ich. »Und was müsst ich dafür machen?«
»Gar nichts. Im Grunde. Du stehst mit im Abspann. Das heißt mehr Geld. Ohne Arbeit, ohne Stress. Du tauchst einfach auf, hast ’n bisschen Material dabei, das bringt ’ne Stange extra, wir machen das Interview …«
»Ach, Material.«
Barry zwingt seinen Blick von meinem Teller weg direkt mir in die Augen. Meine gucken garantiert sehr sanft und blau. Seine nicht. Ich schenke ihm mein allerliebstes Lächeln. Ihm zuckt der Kiefer.
»Ich hab mit Teddy und Goff geredet, hab ich dir doch erzählt. Und die sagen, den Antigua-Film gibts wirklich.«
»Und die wissen das?«
»Alle Welt behauptet ja, der Antigua-Film ist der größte Mythos der Rock-Geschichte. Aber Teddy und Goff sagen, das ist kein Mythos, den gibts wirklich. Jack hat damals eine Filmcrew dabeigehabt, mit 16-mm-Kameras. Und die haben die ganze Session mitgeschnitten, Bild und Ton. Teddy denkt, du hast den Film eventuell.«
Natürlich schlafe ich deshalb heute im Savoy. Deshalb macht mir ein Mann, der mich hasst, den Hof. Deshalb hat er mich vor Jahren vollgesabbert. Er meint nicht mich, er will Jack. Noch enger drankrabbeln an Jack. Seine Bandmitglieder bezirzen. Kann ja sein, dass sie dir Jack in deine eisigen Pfoten legen, Barry. Kauf ihn. Mach ihn zu deinem Eigentum. Wärm dir die kalten Knochen an ihm. Und wenn das nicht hinhaut, Barry, umschwärm seine Tussi, sein Luder, seine Witwe.
»Hm«, sage ich. »Keine Ahnung. Jack hat mir so viel hinterlassen …«
»Sind die bitter?« Eine Sekunde lang war die kalte Verachtung in ihm aufgeblitzt, aber dann guckt er schnell auf meinen Teller. Ich schiebe ihn weg. Ich brauch ihn nicht mehr. Die Karten liegen auf dem Tisch. Es bedurfte einer einzigen Artischocke, bis Barry so weit war, dass er seine Karten aufdeckt.
Er ist erleichtert. Er winkt den Kellner heran, und der räumt den Artischockenrest ab und bringt endlich den zweiten Gang. Mit einem vollen Teller vor der Nase kriegt Barry wieder Oberwasser. Sanft wie Sahne, zart wie Butter.
»Weißt du, Birdie«, sagt er, »du musst mir das überhaupt mal erzählen. Ihr seid einfach plötzlich auf und davon, nach Antigua, ohne erkennbaren Grund. Und ’n paar Monate später sind Goff, Teddy und ’n paar andere hinterher, ihr habt irgend so ’ne Karibik-Blechhütte gemietet, als Studio, und da habt ihr an allen Ideen und Songs gearbeitet, die später in Hard Candy und Hard Time eingegangen sind. Korrekt?«
»Korrekt. Aber du weißt doch alles, du musst mich doch gar nicht behelligen. Es gibt Hard Candy, es gibt Hard Time, die nimmt dir doch kein Mensch weg.«
»Die waren das Endprodukt. Klassiker, grandios und zukunftsweisend. Das war quasi Jack auf den Begriff gebracht. Sein größtes Werk. Aber das klingt wie aus dem Nichts gekommen.«
»So geht Rock ’n ’Roll-Magie.«
»Nein, die Alben sind nicht die ganze Geschichte.«
Klar, Barry, für dich muss da mehr sein, denn du bist ein Groupie, du bist der Obermotz der Musik-Nerds – scharf auf alles Weggelassene, auf die Gespräche zwischen den Takes, die Streitereien, auf Klatsch und Tratsch. Du warst so geil drauf rauszukriegen, was das eigentlich heißt: Jack sein, dass du unbedingt seine Tussi ficken wolltest, bloß um einmal ein paar Krampfsekunden lang da zu sein, wo Jack gewesen war.
»Jack hatte die Bänder damals der Plattenfirma gegeben, war hauptsächlich unplugged – so ’ne Art akustisches Notizbuch, hab ich rausgekriegt. Als die Platten fertig waren, wussten die damit nichts mehr anzufangen. Ich war da, ich hab tagelang in deren Archiven gewühlt. Die sagen, das ist verloren gegangen, weggeschmissen, was weiß ich. War eben damals so. Da hat doch kein Mensch ’n Schimmer gehabt, was die da für Werte weggeschmissen haben.«
»Das Material war wertlos«, sage ich. »Wie du gesagt hast, eine Art Notizbuch. Jedenfalls nichts von wegen Jack auf den Begriff gebracht.«
»Wie kannst du so was sagen, Birdie?«
»Ich bin eben nicht wie du, Barry. Ich bin zufrieden mit dem, was ein Künstler mir freiwillig schenkt. Ich brauch nicht noch alles, was er machen musste, damit so ein Geschenk überhaupt zustande kommt. Jack wollte nicht, dass irgendwer diese Rohbänder hört.«
»Du hast gut reden. Du warst ja die ganze Zeit dabei. Du kennst die. Du hast die gehört. Aber ich erhoffe mir von dem Filmmaterial von den Antigua-Sessions, dass es eine Lücke schließt. Ein kulturhistorisches Dokument ist es sowieso.«
»Wieso denn?«, frage ich treuherzig. »Wichtig ist doch die Musik. So ’n Film von zufälligen Sessions, das ist doch work in progress, völlig wertlos.«
Er versucht, sich an gabelweise Steak und Kartoffeln aufzurichten. »Entschuldige, Birdie, aber kannst du wirklich beurteilen, was Wert hat und was nicht? Ich hab jahrelang geforscht an Jacks Werk, hab drüber geschrieben, habs, wenn du so willst, quasi im Alleingang am Leben gehalten, während drum rum die Moden gewechselt haben.«
»Das hast du wirklich gut gemacht.«
Er sucht meine Augen nach Sarkasmus ab, stößt aber nur auf blaue Sanftheit. »In der Tat«, sagt er dann und belohnt sich erst mal mit Essen. »Okay, Birdie, direkte Frage: Sind die Sessions gefilmt worden? Ja oder nein.«
»Ja. Das weißt du doch. Das haben dir doch Goff oder Teddy schon erzählt.«
»Und danach? Wo ist das Zeug? Hat da je einer ’n richtigen Film draus gemacht?«
»Irgendwie schon. Obwohl – eigentlich nicht.«
»Was soll das heißen?«
»Ach Barry, das war doch bloß ’n Rudel Filmstudenten aus Berkeley, die hatten wir am Strand kennengelernt. Und ’n paar von denen hatten Eclairs dabei und einer ’ne Nagra. Wir haben einfach zusammen rumgemacht und uns amüsiert.«
»Aber die waren verdammt noch mal bei den Sessions dabei und hatten Filme in den Kameras. Was ist damit passiert?«
»Die haben sie mit zurück in die Staaten genommen und entwickelt und zusammengeschnitten.«
»Wer ist ›die‹, Birdie?«
»Die Namen weiß ich nicht mehr. Das ist Jahre her. Wir waren sowieso die meiste Zeit zugedröhnt – und da sind alle möglichen Leute aus und ein geschwirrt. Wissen Goff und Teddy die nicht mehr?«
»Die wussten nicht mal Berkeley. Aber vielleicht hilft das endlich mal weiter.«
»Wobei?«
»Bei der Suche nach den Spuren.«
»Von was?«
»Mein Gott, hörst du eigentlich zu? Von dem Film, Film, Film.«
Ich lege eine Sekunde Schweigen ein, bevor ich zu meinem chirurgischen Bombenangriff ansetze. »Barry, es gibt keinen Film. Die Typen haben einen Haufen Kohle abgestaubt und Jack um jede Menge Zeit und Material beschissen, und was die dadraus gemacht haben, war Schrott. Jack hatte inzwischen auch kein Interesse mehr. Weil ihn alle bloß dauernd ausplündern wollten.«
Ich lehne mich zurück und beobachte, wie es in Barrys Hirn einschlägt.
»Draus gemacht?« Auf seinem Gesicht hängen Schweißtropfen wie Spuckebläschen auf einem Babymund. »Heißt das, die haben wirklich etwas produziert? Hast du es gesehen? Hat Jack es gesehen?«
»Ja sicher. Er hatte schließlich dafür gelöhnt, nicht?«
»Und was hast du gesehen? Was hat Jack für sein Geld gekriegt?«
»Drei Stunden Mischmasch in drei großen Filmbüchsen.«
»Drei Stunden?« Barry sabbert wieder. Und ich werde fast nostalgisch.
»Und das ganze Rohmaterial, das die nicht verwendet hatten. Das halbe Zimmer voll Büchsen und Kisten. Hätte nie gedacht, dass so was so viel Platz wegnimmt. Wir sind ’n paar Tage drum rum geklettert, dann hat Jack den ganzen Krempel genommen und im Garten verbrannt.«
Jetzt entgleisen Barry sämtliche Gesichtszüge. »Jack hat die alle verbrannt?«, flüstert er.
»Ja sicher. Er hat ja nicht für nichts und wieder nichts gelöhnt – er wollte das Zeug haben, um es vernichten zu können. Damals hat doch schon jeder Idiot irgendwas mitgehen lassen, Souvenirs und so, bloß um erzählen zu können, ich hab was von Jack.«
Barrys entgleiste Gesichtszüge sind rot gesprenkelt. Was er wohl eingepfiffen hat? Ich plaudere weiter: »Er ist fast durchgedreht deswegen. Hatte Träume, wie ihm jemand kleine Stücke rausschneidet und er verblutet. Wollte ja auch zum Psychiater, aber er konnte niemandem mehr trauen. Also hat er sozusagen Beweise vernichtet. So ungefähr – wenn er nichts mehr hat, kann ihm keiner was klauen.«
»Deswegen hat er den Film vernichtet?«
Ich sags ja. Es hat keinen Sinn, Barry irgendwas zu erklären – er kapierts nicht. Ich seufze und zünde meine nächste Bombe. »Ja, das ganze Zeug, das die nicht verwendet hatten.«
In Barrys Augen flackert Hoffnung auf wie ein Notlämpchen. »Und die drei Stunden Film?«, keucht er.
»Ach die, die waren unter seinem Bett«, sage ich wegwerfend. »Komplett paranoid ist er ja erst ’n paar Monate später geworden.«
Ich mache zu gern Chaos in Barrys Kopf. Er wird dann so machtlos, dass ihm die nächste Frage nicht einfällt. Er vergisst sogar das Kauen.
»Mensch, Barry«, sage ich, »ich weiß echt nicht, was du von mir hören willst. Nach Jacks Tod sind die Geier über alles hergefallen. Das meiste, was nicht verbrannt war, ist geklaut worden, sogar die Copyrights für die Musik. Ich hab gerettet, was zu retten war, aber viel war das nicht mehr.«
»Den Film auch?«, keucht er wieder.
»Möglich.«
»Möglich?«
»Ich hab nie nachgeguckt. Gibt Ecken, da guck ich schon seit Jahren nicht mehr rein. Das Leben geht weiter.«
Deins ja, würde Barry gern sagen. Du bist doch mit dem nächstbesten strahlenden Star abgezischt, als hätte es Jack nie gegeben. Seiner Meinung nach bin ich einer von den Geiern. Das würde er gern sagen. Ach, wie gern würde er das sagen. Der arme kleine Köter. Ich lächele ihn an. Mein allerliebstes Lächeln ist ihm inzwischen widerlich.
Aber er reißt sich zusammen. »Du könntest den Film also irgendwo haben?«
»Keine Ahnung. Wär denkbar.«
»Und wo?«
»Och – ich hab überall noch Zeug.«
»Soll ich mal suchen?«
»Um Himmels willen. Ist wahrscheinlich sowieso nicht in England.«
»Nicht in …?«
»Nein. Hör zu, Barry, ich bin müde, ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich bin auch nur die eine Nacht in London, und ich würde gern morgen früh aufstehen und noch ’n paar Leute treffen, bevor ich wieder fahre.«
»Du kannst noch nicht fahren. Wir haben noch gar nichts abgemacht.«
»Dein Problem. Du hast mich breitgeschlagen, herzukommen und mit dir zu reden. Hab ich beides gemacht. Und jetzt will ich wieder nach Hause.«
»Ich weiß ja nicht mal, wo du wohnst. Wie kann ich dich denn erreichen?« Er wimmert fast. »Du hast gar nicht aufgegessen. Du kennst doch mein Angebot noch gar nicht.«
»Doch – du hast was von Produktionskosten als ›letztes Angebot‹ erzählt. Und mein Essen ist kalt.« Ich greife nach der Tasche. Der Griff einer Frau nach ihrer Tasche hat symbolisches Gewicht. Barry macht er Heidenangst.
»Warte doch mal«, sagt er, »ich hab nicht gemeint, dass das mein allerletztes Angebot ist. Birdie, setz dich wieder hin, ja? Bitte.«
Ich lasse mich wieder zurücksinken, aber nur schräg auf die Stuhlkante und so, dass er meine Beine samt »Fuck off!«-Schuhen voll im Blick hat. Lange Beine plus S/M-Trittchen – und die sind auf dem Sprung, entweder raus hier oder auf dich drauf, Barry. Liegt ganz bei dir.
»Mit ›letztes Angebot‹ hatt ich bloß die Senderechte im Kopf, Birdie. Die Fernsehproduktion hat ein begrenztes Budget, Birdie, aber ich doch nicht. Wenn dieser Antigua-Film wirklich existiert, hab ich höchstens den Himmel als Grenze.«
»Junge, Junge, Junge!«, sage ich. »Ich wusste gar nicht …«
»Du könntest Klamotten kaufen ohne Ende, Luxuskreuzfahrten machen von dem, was ich dir bieten kann – wenn der Film existiert.«
»Klingt verlockend. Bloß, das Ding zu finden verschlingt allein schon Kreuzfahrten. Das kann sonst wo sein. Mick Jagger, zum Beispiel, hat mir nach Jacks Tod mal seine Insel geliehen – da hab ich noch Sachen. Dann war ich in Los Angeles – da hab ich auch noch Sachen. Und bei, wie hieß der denn noch? Vergessen. Hatte ’ne Riesenvilla auf Paxos. Oder hieß das Naxos? Ich war doch wer weiß wo. Das weißt du doch.«
Und wie er das weiß. Alle Welt hat das gewusst. Mir waren die Paparazzi überall auf den Fersen – à la mit Birdie um die ganze Welt –, und die haben jedermann jeden Quatsch erzählt.
»Und so ’n Trip mach ich nicht noch mal, bloß weil dir das in den Kram passt, Barry.«
»Der hat dir ’ne Insel geliehen?« Superstars machen Barry immer rat- und fassungslos.
»Glaubst du’s nicht? Ach, Schätzchen, du kennst die alten Kämpen doch alle – ruf einfach Mick an, frag ihn, ob er mal nach deinem Film gucken kann. Vielleicht hat der den Nerv dafür und die Zeit. Ich nicht.«
Das war meine Botschaft, laut und deutlich. Und sie ist angekommen. Barry sitzt da und glotzt mich an. Verlegenheit, Gier und das Gefühl, immer noch sozial den Kürzeren zu ziehen, tropfen ihm von Stirn und Oberlippe. Er grübelt, wie ich nach all den Jahren immer noch so teuer sein kann. Ich müsste doch auf Knien vor ihm liegen: Ich bin doch bloß noch ’ne alte Zicke. Weiß doch jeder, dass so eine nichts mehr wert ist. Er hat doch mit Pralinen gewedelt, mit ein bisschen Medienrummel – eigentlich müsste ich ihm aus der Hand fressen und Männchen machen. Das Alter muss mich doch aufgeweicht haben, gefügig gemacht.
Stattdessen schreite ich shimmymäßig schlendernd aus dem Café d’Arte und hinein in die Nacht. Ich heiße Walker. Ich kann alleine gehen. Mich muss man nicht fahren.
Das heißt, fahren lassen hab ich mich doch ganz gern. Mir taten die Füße weh. Stolz und Adrenalin halten auch nicht mehr so lange wie früher. Ich war müde. Ich hab ein Taxi zurück ins Hotel genommen, mir die Schuhe abgeschüttelt, die Klamotten aufgeknöpft und mich langgelegt. Mit Memphis Slim im Walkman. Dann hab ich mir einen Joint gedreht und bin – leergetrickst und geschafft – ins Bett gefallen. Alle Risiken eingegangen, alle Vorstöße platziert. Jetzt hieß es abwarten, wie viel Selbstachtung Barry aufbrachte. Eine Menge? Ein bisschen? Gar keine?
Teil 1
Intros
When the music starts to play, She slides out on the floor, Dancing without a partner … Wenn dann die Musik losgeht, schlüpft sie auf die Tanzfläche
1 Erste Eindrücke
Bei ihrer ersten Begegnung hatte George das Gefühl, Linnet Walker sei durchs Fenster gesegelt gekommen wie ein exotischer Vogel aus heiterem blauem Himmel. In Wirklichkeit war der Tag grau gewesen und sie durch die Tür gekommen wie alle anderen auch. Ihr Vorname hieß einfach so viel wie Hänfling, und sie hatte sich auch weder singend noch schillerndes Gefieder spreizend auf der Schreibtischkante niedergelassen. Trotzdem verlor George das Bild nicht mehr aus dem Kopf.
Eigentlich war George nicht leicht zu beeindrucken. Aber seine Partnerin Tina Cole war noch sturer.
»Hat sie ’n Lebenslauf dagelassen?«, fragte sie.
»Nicht mal ’ne richtige Bewerbung.« George war immer noch gebannt. Er kniff ein paarmal die Augen zusammen, so als ob er von »Taghell« auf »Dämmerlicht« zurückschalten wollte. »Ich glaub, die hat uns erst mal getestet.«
»Die sucht ’n Job und hält uns nicht für gut genug? Die hat ja Nerven.«
»Wie eine frisch von der Schule, die mit Bewerbungen um sich schmeißt, sieht sie nicht gerade aus«, wollte George erklären, »mehr wie …«
»Mehr wie?«
George gab keine Antwort, sondern putzte seine Brille. Dann fragte er zurück: »Mit wie vielen Leuten haben wir bis jetzt geredet? Und wie viele davon können einen einfachen Brief schreiben? Auch nur halbwegs korrekt buchstabieren? Kontoauszüge lesen? Kundenkarteikarten anlegen? Sich in dem Labyrinth von Computer zurechtfinden? War da ein Wesen dabei, das du auch nur ans Telefon setzen würdest?«
»Das ist hier kein Durchschnittsjob. Wahrscheinlich brauchen die alle etwas Haustraining.«
»Aus welchem Managerhandbuch hast du ’n den Euphemismus?«
George musterte seine Geschäftspartnerin mit einer Mischung aus Ärger und Zuneigung. »Sei so lieb und erklär mir mal, ob zum Haustraining auch gehört, dass wir irgendwelchen Girlies erst mal beibringen müssen, wie man sein Kaugummi los wird und die Zigaretten verschwinden lässt, bevor man der Kundschaft nahelegt, ihren ›Arsch‹ da und da zu ›parken‹.«
Tina schnaubte vor Lachen. »Ach, George – da waren wirklich ’n paar echte Trutschen dabei!«
»Aber nicht eine, die wir in den Empfang setzen würden – geschweige an vertrauliche Unterlagen lassen. Wir arbeiten in der Sicherheitsbranche, verdammt noch mal. Da darf man erwarten, dass wir selber sicher sind. Und vertrauenswürdig. Und taktvoll. Jedenfalls nicht den Spruch ›Abwarten und Tee trinken‹. Wir gehen jetzt seit fünf Wochen so auf dem Zahnfleisch ohne Bürokraft.«
Es war kurz vor acht Uhr abends und der Verkehr draußen ruhig und träge. Alle Läden in der Straße außer dem China-Imbiss und der Kneipe, deren Geschäft jetzt allmählich losging, waren zu. Alles hatte auf Nachtbetrieb und Feierabend geschaltet. Nur eine Firma namens »Cole-Adler Security« hatte jede Menge Arbeit nachzuholen.
Tina stöhnte auf. »Fahr nach Hause, Schatz. Du siehst ja total kaputt aus. Sonst fährt Fay noch mit mir Schlitten. Morgen kriegen wir das gebacken, ganz bestimmt.«
Tina hatte ausnahmsweise die Elternrolle übernommen. Eigentlich war George sonst der mit der breiten Brust, der immer alles gebacken kriegte. Aber heute war der ruhige, systematische George müde und seine gemütliche Leibesfülle fast jenseits seiner Tragkraft.
»Fahr nach Hause«, wiederholte Tina.
»Du aber auch«, antwortete George. »Wir sind heute beide nicht mehr einkommensstark.«
Das stimmte. Sie hatten auch beide die Nase voll davon, dauernd auf der Stelle zu treten und nichts erledigt zu kriegen, weil die meiste Zeit für Anrufebeantworten und Hinter-Geld-Herrennen und Briefmarkenkaufen draufging. Cole-Adler Security brauchte Hilfe. Cole-Adler brauchten ein kompetentes Büromanagement.
Auf dem Nachhauseweg im ruckeligen blinden Wurm, den alle seine Kenner nur Misery Line nennen, dachte George Adler über Linnet Walker nach. Sie war nicht gerade der Typ Frau, von der man gesehen werden will, wenn man gerade sein Saure-Gurken-Käse-Sandwich in den Laserprinter fallen lässt. Er wusste genau, wie ein Mann in seinem Alter und von seinem Umfang von hinten aussah. Er wusste auch, dass so ein Anblick nicht schöner wurde, indem man sich vornüberbeugte, reifen Cheddar aus dem empfindlichen elektronischen Equipment zu fingern versuchte und dazu ständig leise Flüche ausstieß. Genau das aber, dachte er traurig, hatte Linnet beim Hereinkommen sehen müssen.
George hatte alles Mögliche erwartet – einen Jobbewerber, eine Frau, die eine Alarmanlage gegen Einbruch brauchte, sogar den Buchprüfer wegen der Jahresbilanz. Er hatte sich tatsächlich mal wieder drei Termine gleichzeitig gemacht und die nicht mehr weggekriegt. Und dann hatte er alles noch schlimmer gemacht, weil er unbedingt die Seiten mit den Einnahmen und Ausgaben ausdrucken wollte, weil der Buchprüfer die bestimmt brauchte.
Computer waren nicht Georges Welt. Elektronischer Schnickschnack war ihm ein Rätsel, und als Kind ging er auch schon seit ewig nicht mehr durch. Seine Technologie hieß Tinte und Feder. Wenn so jemand für den digitalen Terminkalender zuständig ist, dann blickt er nicht mehr durch, dann macht er sich drei Termine auf einmal und dann verfüttert er sein Mittagessen an den Laserdrucker.
Er hatte Linnet hereinkommen gehört und, ohne sich umzudrehen oder auch nur hochzusehen, gesagt: »Moment bitte. Entschuldigung. Scheiße. Sind Sie der Job, die Alarmanlage oder die Finanzen?«
Eine sanfte Stimme hatte belustigt geantwortet: »Als was hätten Sie mich denn gern?«
»Als Hirnchirurg. Ich glaub, das ist hier ’ne Frontallobotomie am lebenden Drucker, und ich hab keine Ahnung, wo frontal bei dem Ding ist.«
»Frontal ist meine Spezialität. Lassen Sie mich mal ran. Ich hab auch kleinere Hände.«
Genau da war George die Lesebrille von der Nase geschliddert und hatte sich zum Saure-Gurken-Käse-Sandwich gesellt. Er hatte sich verzweifelt aufgerichtet und diesem Engel erlaubt, ihn zu erlösen.
Als er Fay später zu Hause den Vorfall zu beschreiben versuchte, fiel ihm nur ein: »O Gott, hoffentlich nimmt die den Job. Das wär wie ein erhörtes Gebet.«
»O ja, hoffentlich.« Fay machte sich bettfertig und klopfte sich Feuchtigkeitscreme ins Gesicht. »Du bist fix und fertig. Du darfst so nicht arbeiten. Nicht mehr. Wie ist sie denn sonst so?«
Aber der zu Recht für seine polizeitrainierte Gründlichkeit und Präzision berühmte George hatte das offenbar vergessen. »Gut mit Technikzeug«, sagte er nur. »Die hat den Drucker wieder sauber gekriegt und kapiert den Scheißcomputer.«
»Das ist ja ’n Wochenlohn wert. So wie du das Ding beschreibst, hält das jeder für ’ne Landmine. Und wie geht sie mit Leuten um?«
»Noch besser.« Jetzt fiel es ihm wieder ein. Als der Buchprüfer aufgetaucht war, hatte er immer noch keinen Durchblick, aber Angst gehabt, die Klientin zu verpassen.
»Ich warte auf sie«, hatte Linnet gesagt. »Keine Sorge.«
Zehn Minuten später hatte sich der Buchprüfer an die Arbeit gemacht und George war wieder aus seinem Büro gekommen, um festzustellen, dass nicht nur die Klientin glücklich in Broschüren blätterte, sondern dass auch alle für den Buchprüfer wichtigen Informationen ausgedruckt waren und mitnahmebereit dalagen. Und da hatte ihn plötzlich das Gefühl überkommen, die Gemütsruhe, mit der er normalerweise durchs Leben ging, könnte eines Tages wieder einkehren.
»Die kommt bestimmt nie wieder«, murmelte George und legte sich betrübt ins Bett. »Die hat sich bestimmt das Chaos angeguckt, das ich mit dem Drucker veranstaltet hab, und beschlossen, doch lieber Klos zu schrubben.«
Aber Linnet kam zwei Tage später zum Termin bei Tina.
»Meine Fresse«, befand Tina anschließend, »ich konnt mich gerade noch bremsen. Am liebsten hätte ich sie am Tisch festgekettet, damit sie nicht abhaut. Hat die den schwarzen Gürtel in Charme oder was?«
»Siehste?« George war selig, dass die sture Tina genauso empfänglich für den Charme dieser Frau war wie er.
»Lebenslauf hat sie keinen. Und bloß zwei Referenzen. Andererseits, was erwartet man von einer, die sich die letzten zehn Jahre um ihre Mutter gekümmert hat?«
»Die überprüf ich«, versprach George.
»Du nicht«, widersprach Tina. »Das mach ich selbst. Ich trau keinem Mann, der so verzweifelt ist wie du.«
Bei der ersten der beiden Adressen hatte Tina einen französischen Restaurantbesitzer am Telefon.
»Linnet?« fragte er. »Ah, Sie mein’ Chouette. Ich sage immer Chouette zu sie. Ist mein Schatz von alle Schätze.«
»Äh – ja«, fragte Tina weiter. »Aber sagen Sie mir auch, als was sie genau eingestellt und wie zuverlässig sie war?«
»Sie ’at meine Leben gerettet«, schwärmte die extravagante Stimme. »Ohne Chouette ich würde immer noch Kartoffel schälen. Ich würde sein bankrott. Meine Freunde würde weinen an meine Grab …«
Als Tina aufgelegt und Tatsachen und Übertreibungen auseinandersortiert hatte, schloss sie, dass Linnet Geschäftsführerin gewesen sein musste. Sie war offenbar in dieses Restaurant hineinspaziert, das außer einem begabten, aufgekratzten und hoffnungslos chaotischen Meisterkoch nichts aufzuweisen hatte, und hatte derart System in den Laden gebracht, dass er brummte. Es gab sogar einen Pudding, der ihr zu Ehren Bombe Chouette hieß.
»Ich hab ihn gefragt, warum sie da weggegangen ist«, erzählte sie George, der von einem Ohr zum anderen grinste. »Und der sagt, ich zitiere: ›Ah, was sie ’ ätte noch machen können? Der Siestem ist narrensiecher. Sie ’at gemüsst weiterflattern.«
Georges Lächeln gab schließlich den Ausschlag für Tinas Entscheidung. Sie hatte es seit Monaten nicht mehr gesehen, fiel ihr auf, und sie fühlte sich verantwortlich.
»Tina, um Himmels willen«, sagte George, »Linnet soll bloß hierherkommen und so ’n narrensiecheres Siestem auch für uns auf die Beine stellen. Ich hab die Schnauze so voll von dieser ewigen Panik.«
»Und wir hoffen solange, dass sie niecht weiterflattert mietsamt die Kleinegöld?«, fragte Tina. »Ich ruf lieber erst noch die andere Nummer an, wenn du nichts dagegen hast.«
Diesmal hatte sie einen freischaffenden Fotografen dran, der ebenso voll des Lobes für Linnet war.
»Sie hat ihn ins Geschäft gebracht«, berichtete sie hinterher. »Klang, als ob sie extrem gut Aufträge beschaffen konnte. Ach, und wusstest du schon? Sie ist ›ausgesprochen fotogen‹.«
»Und sonst? Ist sie mit dem Kleingeld weggeflattert?«
»Nein«, gab Tina zu. »Okay, okay, sie ist eine Heilige und ein Genie. Ich wüsste bloß partout nicht, warum eine Heilige oder ein Genie bei uns arbeiten wollen sollte.«
»Du wüsstest aber auch partout nicht, warum wir sie nicht darum bitten sollten, oder?«
»Ich bezahle nur ungern jemanden, der fotogener ist als ich«, schlug Tina vor. »Also gut, George, schlepp sie her. Ich weiß ja, du bist scharf drauf.«
Und so kam Linnet Walker zu einem Job bei Cole-Adler Security und George endlich wieder zu guter Laune. Bald war er wieder George, der nette, systematische Gemütsmensch, auf den Tina sich verlassen konnte. Er wirkte sogar jünger. Allein wegen dieser Veränderung hätte Tina mit Freuden Linnets Lohn gezahlt. Aber dass George sich so änderte, lag an den Veränderungen im Büro.
Als Erstes hatte Linnet den Computer bezirzt, sich gegenüber seinen Besitzern verständlicher und menschlicher aufzuführen. Obendrein notierte sie alle Anrufe und Termine von Hand in einen Kalender, der auf ihrem Tisch lag. Er war vor allem für George gedacht, aber Tina fand auch bald Geschmack daran.
Zweitens organisierte sie die Tagesabläufe so, dass beide zwischendurch noch Zeit zum Reden hatten. In Zeitplänen war sie geschickt, und sie hatte einen Instinkt dafür, wer von beiden am besten zu welchen Klienten passte und umgekehrt. Und die Kundschaft reagierte auf wundersame Weise – zahlte noch vor der ersten Mahnung und schien regelrecht dankbar ob des Privilegs.
Umgekehrt schienen Lieferanten plötzlich unerhört kulant in Sachen offene Rechnungen zu sein. Die Firma Cole-Adler musste Büromaterial jetzt weder vorab überweisen noch bei Lieferung bar bezahlen. Die Rechnungen kamen auch sozusagen im gemütlichen Schlendergang, und schließlich kam der Krieg zwischen Einnahmen und Ausgaben immerhin zum Stillstand.
»Ich begreif das nicht«, sagte Tina, »letzten Monat haben die Säcke uns fast bombardiert mit Zahlungsaufforderungen. Jetzt überschütten sie uns mit Gratismustern und umgurren uns.«
»Dann lass es doch«, sagte George, »genieß es einfach und schweig.«
»Sie hat so was Vertrauenerweckendes. Hast du mal gehört, wie sie telefoniert? Du glaubst, sie charmiert irgendeinen Konzernboss – und du weißt genau, das ist bloß irgendein Lagerdisponent, aber wir haben die zwölf Dutzend Fenstersicherungen tatsächlich morgen und nicht erst nächste Woche. Sie kann offenbar mit jedem, von Prinz bis Prolo. Als wär sie zu Hause in jedem Schlamassel. Wie alt ist die eigentlich?«
»Steht das nicht im Lebenslauf?«
»Sie hatte doch keinen, vergessen? O Mann, vielleicht frag ich sie mal.«
Tina fragte nie, und Linnets Alter blieb schließlich ein Geheimnis. Sie war eindeutig eine reife Frau, bewegte sich aber schnell und anmutig wie ein junges Mädchen. An ihr sah noch das billigste, schlichteste Kleid exotisch aus. Sie redete schnodderig und sehr heutig, aber ihre Briefe waren ein Muster an diskreter, gebildeter Wortwahl.
Alles sehr widersprüchlich, fand Tina, aber sie war zu beschäftigt, um lange zu grübeln. Nach Linnets erster Woche wurde Tina ruhiger und beschloss, dass Linnet mit allem und jedem zurechtkam. Man brauchte weder ein Auge auf sie zu haben noch hinter ihr herzukontrollieren, also nahm Tina den Rat von George an: Sie schwieg und genoss es.
2 Die Schwester
Meine Schwester war oben unterm Dach und machte irgendetwas aus bunten Seidenvierecken. Robin macht immer irgendwas. Sie lässt auch immer die Hintertür offen. Sie traut den Menschen, die Verrückte. Sie ist oft genug übern Tisch gezogen worden, aber sie glaubt an die Vervollkommnung der Menschheit und an die Grundgüte ihrer Nächsten. So muss es sein, oder ihr Gedächtnis ist ein Kondom mit Lochmuster. Sie traut sogar mir.