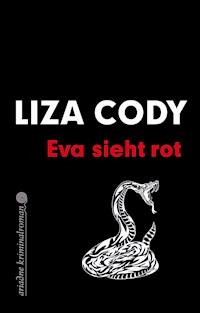15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Seema Dahami ist Stadtgärtnerin: Sie gestaltet Londoner Dachgärten, Balkons, Erker und andere grüne Nischen der Großstadt – auch Verkehrsinseln. Sie plant, pflanzt und jätet, pflegt und bringt zum Blühen. Dann lernt sie eines Abends Lazaro kennen – deutlich älter, hochgebildet, aristokratisch und sehr aufmerksam. Und alles wird anders. Bis Blut fließt. »Mit Witz und Empathie, höchst lebendig ... Wer nach Geschichten sucht, die das Genre transzendieren, wird von Liza Cody begeistert sein.« LiteraturSpiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2021
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Titel der englischen Originalausgabe: Gift or Theft
© 2020 by Liza Cody
Printausgabe: © Argument Verlag 2021
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: Oktober 2021
ISBN 978-3-95988-209-5
Über das Buch
Verschmitzt und spannend, dann zunehmend unheimlich schildert Liza Cody eine Woche im Leben von Seema, die wie aus dem Nichts unter den Einfluss eines mysteriösen älteren Mannes gerät. Er gleicht keinem Menschen, den sie je kennengelernt hat. Aber was genau geht hier vor? Wer ist Lazaro wirklich, und was will er eigentlich von ihr?
Über die Autorin
Liza Cody
Milch oder Blut
Deutsch von Martin Grundmann
Vorbemerkung von Else Laudan
Liza Codys Kriminalromane sind gerne Reisen mit extrem ungewisser Route, Ausflüge in Parallelwirklichkeiten, deren warmer und lebhafter Realismus dabei hilft, dieser begnadeten, aber hypereigenwilligen Erzählerin bei ihren Sprüngen und Gedankenspielen zu folgen.
Auch Milch oder Blut beginnt ganz bodenständig im Hier und Jetzt des heutigen Brexit-Englands. Seema, siebenundzwanzig, selbständig, Ich-Erzählerin dieser Geschichte, rutscht in ein seltsames Abenteuer hinein, verstrickt sich in tagtraumartige Eskapaden und gerät in ein undurchdringliches Dickicht aus unvereinbaren Welt- und Lebensanschauungen. Wie eine schwere Krankheit befällt Seema ein Symptom unserer Gegenwart: Von allen Seiten drängen sich ihr sogenannte Wahrheiten auf, Deutungen und Maßgaben. Sie bauen auf ihre Sehnsüchte und Träume, auf Tradition, auf Gruppenzwang und unüberschaubare Regelwerke. Und da Seema ständig mit dem Bedürfnis ringt, endlich irgendwo dazuzugehören und anerkannt zu werden, streitet Vernunft mit Gefühl, Wissen mit Wünschen, Ratio mit Hoffnung. Denn was sie erlebt, ist bizarr.
Milch oder Blut: eine Burleske, ein wilder Ritt durch Genres und Szenarien, eine urwüchsige Erzählung über Prinzipien, Glaube und Aberglaube. Und ein Krimi über Glücksversprechen. Denn Menschen machen ihre Geschichte selbst, wenn auch nicht aus freien Stücken. Hals über Kopf. Oder?
1
Meine Mitbewohnerin Amy verließ das Italian Bar & Grill noch vor Mitternacht. Hastig raunte sie mir zu, dass sie einen Cousin ihres angeheirateten Cousins an der Leine hatte. Das war selbst für Amy rasant: Erst vor zehn Minuten war sie nur mal kurz aufs Klo verschwunden.
»Es wird immer aussichtsloser, Seema«, flüsterte sie und raffte Mantel und Tasche zusammen. »Jetzt bin ich so tief gesunken, dass ich mich auf entfernte Verwandte einlasse, weil mir nur noch auf den Beerdigungen, zu denen mich Mutter mitschleift, passable Kerle begegnen. Tut mir leid, dass ich dich hängen lasse, aber du weißt ja, wie das ist – Noah wartet.«
Ich suchte nach einem Noah, konnte aber im Menschengewühl vor der Bar keinen entdecken. Ich rechnete mit dem Üblichen: dunkles schütteres Haar, notgeiler Blick, Mittelmaß. Vor zehn Jahren hätte Amy ihn nicht mal bemerkt. Vor zehn Jahren hatte sie den großen blonden Sänger einer Goi-Band angebaggert.
Und deshalb saß ich um Mitternacht allein im Italian Bar & Grill, um die Ecke vom Golders Green-Friedhof in der Hoop Lane, und sah aus wie Freiwild für den älteren Fremden, der neben mir auftauchte und mich zu einem weiteren Wodka und einem Tütchen Speckkrusten einlud.
Auf den Wodka ließ ich mich ein – angetrunken genug, um meine Vorsichtsschwelle zu senken. Aber die Speckkrusten lehnte ich ab.
Er setzte sich und sagte: »Verzeihen Sie. Die alten Speisegebote untersagen den Genuss von Schweinefleisch, richtig?«
Ich lächelte unbestimmt. Ich hatte nicht vor, meine Haltung zu religiösen Praxen mit einem Fremden zu besprechen, egal wie gut er angezogen war. Dann sah ich im Schummerlicht näher hin und revidierte meine Meinung. Er sah aus, wie ich mir mediterrane Aristokraten vorstellte – silbernes Haar, fantastischer Anzug, perfektes Schuhwerk. Guter Geschmack umwehte ihn wie der feinste Hauch eines kostspieligen Rasierwassers. Und vermutlich hatte er sich einem höchst raffinierten Schönheitschirurgen anvertraut – seine sonnengebräunte Haut war praktisch faltenfrei und kontrastierte bezaubernd mit dem leuchtend weißen Haar.
Ich war geblendet. Gleichzeitig dachte ich, der führt doch nichts Gutes im Schilde. Sein angestammtes Jagdrevier sollte Mayfair, Paris oder Monte Carlo sein – ganz bestimmt nicht Golders Green. Und müsste sein Beuteschema nicht eine biegsame blonde Achtzehnjährige mit Stammbaum erfordern? Was ich absolut nicht war.
Als der Wodka seine magische Wirkung entfaltete, sagte ich: »Sie, mein Freund, wirken hier wie ein reinrassiges Rennpferd zwischen abgehalfterten Ponys.«
Seine beim Lachen entblößten Zähne waren so perfekt wie der Rest von ihm. »Und Sie, meine Freundin, wirken hier wie ein Engel inmitten der Verdammten.« Eine Ansage, die ich ziemlich schräg fand.
Seltsamerweise blieben wir bei den Verdammten und plauderten über Hieronymus Bosch. Er wollte wissen, ob ich Kunst studierte – was mir schmeichelte –, und ich fragte, ob er Kunsthistoriker war, da er so viel mehr über den Garten der Lüste wusste als ich.
»Ich bin Restaurator«, sagte er.
Und ich bin eine Art Gärtnerin. Spezialistin für Balkonkästen, Veranden und Londoner Kleinstgärtchen. Als Nächstes plauderten wir über Gärten.
»Eine Miniaturistin?« Er hatte einen leichten melodischen Akzent, den ich nicht zuzuordnen wusste.
»Sehr nett ausgedrückt. Meine Mutter nennt es faul. Aber die Vielfalt dabei ist wundervoll: Ich hab schon japanische Moosgärten angelegt und Wüstengärtchen mit Kakteen. Ich hab sogar mal einen Jurassic Park im Blumenkasten gemacht, bevölkert mit Plastikdinos, und ein Gemüsebeet auf einer Veranda.« Angeberin. Nicht viele Leute bekunden echtes Interesse an meiner Arbeit, und wenn es dazu kommt, reagiere ich allzu redselig.
Im Gegenzug erzählte er mir dann von seinem Mondscheingarten in – jawohl – Italien. Offenbar komplett mit Springbrunnen und Statuen. Dazu Beete voller duftender weißer Blumen mit silbrigem Laub. Ein Reflexionsbecken spiegelte Ewigkeit, es gab einen weißen Wasserfall und einen schwarzen Teich, eingerahmt von weißen Narzissen. Der Wildnisbereich bot Lebensraum für Nachtigallen, Eulen, Fledermäuse, Silberfüchse und Glühwürmchen.
»Ich wünschte, ich könnte es mir ansehen«, sagte ich träumerisch, auch wenn ich halb annahm, dass er das alles beim Reden frei erfand. Er klang wie eine Figur aus einem alten Fellini-Film.
»Ich wünschte, ich könnte Sie dort ansehen«, antwortete er. »Alle Frauen sind am allerschönsten im Mondschein.«
Dann rief der Barmann Schluss für heute und ich kämpfte mich aus dem Traum und in meinen Wintermantel. Erst da dachte ich daran, mich vorzustellen.
»Seema Dahami«, erklärte ich und suchte nach meinen Handschuhen. Er sah nicht aus wie der Typ, der einen zünftigen Handschlag austeilt.
Seine Antwort bestand nur aus einem Wort: »Lazaro.« Das kam mir damals nicht sonderbar vor.
Wir waren die Letzten, die gingen, und als wir auf die verlassene Straße traten, erloschen sämtliche Lichter, und der Türsteher verbeugte sich und küsste ihm die Hand. Das allerdings kam mir sonderbar vor: Handküssen ist in Golders Green höchst unüblich. Ich fragte mich mit leichtem Schreck, ob mein Begleiter am Ende gar kein romantischer Märchenerzähler war, sondern ein Mafiapate.
Dann geschah zweierlei: Es begann heftig zu schneien – ungewöhnlich für März –, und eine riesige schwarze Limousine rollte vor uns an die Bordsteinkante. Der Fahrer, ein junger Mann von atemberaubender Schönheit, öffnete die Tür, und ich erspähte eine vollendete Luxus-Innenausstattung. Schwarze Seidenkissen, schwarze Zobelüberwürfe und weiße Hermelinbezüge. Wäre Lazaro nicht so dicht hinter mir gewesen, ich hätte schleunigst Reißaus genommen: Diese Limousine hatte nicht einen einzigen Berührungspunkt mit meiner Messlatte fürs Normale. Aber er sagte: »Ich bringe Sie, wohin Sie wollen.« Also nannte ich meine Adresse und ließ mich in Kissen gleiten, die mich umfingen wie liebende Arme. Ich war müde und hatte zu viel getrunken, aber ich befand mich in Begleitung einen Mannes mit perfekten Manieren. Was sollte da schon schiefgehen?
Ehe er einstieg, reichte der Chauffeur Lazaro eine langstielige Elfenbeinpfeife, in die er eine kleine schwarze Kugel aus einer lakritzartigen Substanz tat. Er gab ihm mit einem Fidibus Feuer, bevor er den Wagenschlag schloss und durch das Schneetreiben zur Fahrertür schritt.
Lazaro inhalierte, und ein seltsamer, leicht würziger Duft erfüllte die Luft. Er lehnte sich zurück und inhalierte erneut.
»Opium«, sagte er sanft und gab mir die Pfeife.
Ich versuch mal zu erklären, warum ich sie nahm. Hätte er gesagt: ›Heroin – benutz ruhig meine Spritze‹, dann wäre ich selbstredend aus dem Wagen gesprungen und heimgerannt. Aber er reichte mir etwas Exotisches in einem hinreißend geschnitzten Artefakt. Wie könnte in einem solchen Prachtstück etwas ernstlich Gefährliches stecken?
Was er mir da anbot, das war die Romantik: Coleridge, Shelley, Byron, Keats und die Träume des Endymion, vielleicht gar Mary Shelley und der Alptraum von Frankenstein.
Und was er mir da anbot, war meine eigene Familiengeschichte. Mein Ururgroßvater, seine Söhne, seine Brüder und Cousins erwarben und verloren etliche Vermögen beim Opiumhandel – das schwarze Gold, das sie in Indien kauften und in China absetzten. Ja, Handel trieben sie auf Arabisch, Hindi und Chinesisch, aber sie beteten auf Hebräisch. Derweil ihre Gemahlinnen den Ladys des britischen Empires nacheiferten und englische Literatur lasen, einschließlich Keats, Coleridge, Byron und Shelley. Vielleicht erbebten sie in wohligem Schauer bei Mary Shelleys Frankenstein. Auch wenn es nichts ist, worauf man stolz sein sollte, stellen meine Cousins die Opiumwaagen unserer Vorfahren als Familienerbstücke zur Schau.
Hätte Lazaro mir etwas Verführerischeres anbieten können?
Ich nahm die Pfeife, setzte meine Lippen dorthin, wo seine gewesen waren, und schmeckte Ewigkeit.
Seine kühle trockene Hand schob sich unter meine Haare und strich mir langsam über den Nacken. Seine Berührung löste ein Zittern aus, das mir den ganzen Rücken runterlief.
»Woher wussten Sie das?«, fragte ich.
1
Steh auf, du faule Sau«, kreischte Amy. »Es ist nach neun. Ich hab den Bus verpasst, du musst mich zur Arbeit fahren.«
»Lass mich um Gottes willen in Ruhe«, stöhnte ich.
»Gott nützt dir auch nichts, wenn ich gefeuert werde und die Miete nicht zusammenkriege und du dir eine andere Blöde suchen musst, die es mit dir aushält.« Sie zog mir die Decke weg und warf mir Jeans und Pulli zu. »Los jetzt!« Dann: »Ist das ein Knutschfleck? Seema, du kleine Schlampe – was soll Jake dazu sagen? Wo wir angeblich einen unschuldigen Mädelsabend hatten.«
Ich fasste mir an den Hals und ertastete eine empfindliche Stelle.
»Erzähl’s mir im Auto«, schrie sie. »Beeilung jetzt!«
Beeilung? Ich schaffte es kaum, mich aus dem tiefsten Schlaf seit Monaten zu kämpfen. Aber Amy flößte mir den Bodensatz ihres Frühstückskaffees ein, und ich fuhr sie quer durch die Stadt ins Büro, wo sie irgendeinem lendenschwachen Fuzzi als Assistentin dient. Auf der Arbeit ist sie eine völlig andere Frau: gepflegt, parkettsicher, effizient, ein richtiger Dynamo.
»Wie lief es mit Noah?«, erkundigte ich mich, um Fragen aus dem Weg zu gehen.
»Solider Gutverdiener, importiert Schuhe. Spart auf ein Haus, eine Wohnung, Garage oder was weiß ich. Einstweilen lebt er bei Muttern.« Wir sahen uns an. Sie sagte: »Oy veh.« Und ich sagte: »Immer dasselbe.« Wir lachten beide.
»Siehst du ihn wieder?«
»Oh jaa«, sagte sie, womit dieser Teil der Unterhaltung beendet war.
»Hat euch auch der Schnee überrascht?«, fragte ich – noch ein Ablenkungsmanöver.
»Welcher Schnee?« Am Ende war Noah doch nicht so langweilig gewesen, wie sie tat.
Sie schäumte, weil wir kaum vorankamen. Im Londoner Verkehr gibt es kein Entrinnen. Und bei Amys Neugier ebenso wenig. »Der Knutschfleck«, sagte sie. »Spuck’s aus.«
»Mückenstich.«
»Schwachsinn.«
»Dann eben Hundebiss. Ich weiß es nicht, Amy, beim Aufwachen war es einfach da.«
»Nein, nein, nein. Raus mit der Wahrheit. Mit wem hast du rumgemacht, nachdem ich weg bin?«
»Nichts dergleichen. Ein älterer Typ hat mich heimgefahren. Ich war ein bisschen wodka-knülle.«
»Stockbesoffen meinst du. Wie alt?«
»Weiß nicht. Mindestens sechzig.«
»Reich?«
»Scheiße noch mal, Amy, ich weiß es nicht.«
»Na, was war es denn für ein Auto?«
»Du klingst schon wie meine Mutter«, sagte ich, weil sie das normalerweise zum Schweigen bringt. Ich hatte die Limousine wieder vor Augen, und die hätte mehr Fragen als Antworten geliefert. Angriff ist die beste Verteidigung: »Du hast mich doch sitzenlassen. Du bist es, die rumgemacht hat. Was für ein Auto fährt denn Noah?«
»Die Stelle an deinem Hals ist so eindeutig ein Knutschfleck.«
»Von wegen.«
»Jakey wird das auffallen.«
»Jacob Silver kann mir den rosigen runden Arsch küssen.«
Aber ich hab lange Haare, und ich trug ein Halstuch, und Jake merkte absolut gar nichts. Er beschwerte sich über die Gartenerde unter meinen Fingernägeln, er beschwerte sich über seinen Chef, er beschwerte sich, weil Amy nicht wegging und wir also nicht allein waren, aber er beschwerte sich über keinen Knutschfleck.
Ich machte uns Rührei mit Avocados. Ich war den ganzen Tag nicht hungrig gewesen und schaffte meins nicht. Er leerte meinen Teller auf seinen, und auch darüber beschwerte er sich nicht.
»Noch verkatert?«, fragte Amy unschuldig.
»Dein schlechter Einfluss«, sagte er. Beide lachten. Er mochte Amy, weil sie dusslig genug war, um über so was zu lachen, aber nicht so dusslig, dass es nervte.
Wir schauten uns Misfits – Nicht gesellschaftsfähig an, denn Jake mochte Marilyn Monroe, Amy mochte Clark Gable und ich mochte alte Streifen. Nach einer Stunde war ich so müde, dass ich ins Bett ging und die beiden allein ließ.
Was immer letzte Nacht vorgefallen war, war ein Traum aus alter Zeit, kaum sichtbar in einem Schneesturm.
Ich wollte, dass er sich wiederholte.
***
Ich hatte am nächsten Tag mehrere Termine. Mrs. Seinfeld, sehr aufgebracht, wollte einen Ersatz für ihren schönen weißen Kamelienbusch, der mitsamt seinem pseudogriechischen Übertopf vor ihrer Haustür entwendet worden war. Ein Rentnerpaar in Finchley wünschte, dass ich vor ihrem Haus vier Pflanzkästen im Stil englischer Landgärten anlegte, die zur Hochzeit ihrer Enkelin Ende Juli in voller Blütenpracht stehen sollten. Und dann noch drei reguläre Pflegeservicetermine.
Als Letztes fuhr ich zu Hannah David, die siebenundachtzig ist, allein lebt und einst meine allererste Kundin war. Sie kann immer noch prima jäten und das Moos aus der zügellosen Pracht ihrer scharlachroten und goldgelben Tulpen zupfen, aber sie hat nicht mehr die Kraft, die alten Schiebefenster zu öffnen. Nachdem sie einen der Kästen versorgt hatte und ich die anderen, machte ich die Fenster wieder zu. Sie drehte die Heizung hoch und holte das Tablett mit der Karaffe Dry Sherry, zwei Gläsern und einem Teller voller Madeleines. Deshalb sorge ich immer dafür, dass Hannah mein letzter Termin ist.
»Du siehst müde aus, Liebes«, sagte sie und überließ es mir, den Sherry einzugießen. »Zu viele lange Nächte mit deinem jungen Mann? Deine Mutter findet ja, du könntest Besseres bewerkstelligen. Aber das ist das alte Lied, das singt sie schon, seit du drei Jahre alt warst. Unbelehrbare Närrin.«
Ich grinste sie liebevoll an. Hannah sagt, sie ist zu alt, um ihre Zeit mit Takt zu verschwenden. Sie fuhr fort: »Ich weiß noch, du hast mal gesagt, du und Jacob, ihr ›kommt klar‹. Das ist nicht die große Leidenschaft, aber in diesen unbeständigen Zeiten auch nicht zu verachten. Es ist besser als Einsamkeit. Oh bitte, sieh mich nicht so an – ich bin nicht einsam, und ich wünschte, ich könnte mir die Zeit gutschreiben lassen, die ich an falsche Freunde und Liebste verschwendet habe. Eins kann ich dir sagen, deine Arbeit lässt dich nie im Stich – im Gegensatz zu Liebe, Freundschaft und Familie. Heb dir deine Leidenschaft für die Arbeit auf.«
Ich liebte Hannah, wenn sie so redete. Sie widersprach allem, was alle anderen sagten, und klang dabei viel vernünftiger. Ich begann ein wenig von meiner schrägen Begegnung im Italian Bar & Grill zu erzählen.
Sie unterbrach. »Lazaro? Nicht Lazarus, der angeblich von den Toten auferstand? Sehr eigentümlich.« Sie dachte kurz nach. Dann sagte sie: »Ich würde auf keinen Mann bauen, der mehr Wert auf sein Erscheinungsbild legt als du. Das ist schlecht fürs Gleichgewicht.«
»Was für ein Gleichgewicht?«
»Dieser Hang zur jugendlichen Fassade bei einem alten Mann bedeutet, er interessiert sich immer mehr für sich als für irgendwen sonst. Das ist zwar bis zu einem gewissen Grad bei allen so. Aber im Extremfall bedeutet es, dass du für ihn immer unsichtbar bist oder gar nicht existierst, außer wenn er gerade Verwendung für dich hat. Du bist sehr ungekünstelt, Liebes.« Ihr Nicken umfasste meinen Pferdeschwanz, meinen schmuddeligen Pulli, die abgetragenen Jeans und Arbeitsstiefel.
»Auch da sollte ich laut Mutter Besseres bewerkstelligen.«
»Na klar – zieh dich schick an, Seidenstrümpfe und hohe Absätze, geh zur Maniküre, schneid dir die Mähne ab und du angelst dir mit Sicherheit einen Zahnarzt.«
Ich lachte. Ihr Sarkasmus gab mir Rückhalt. Ich erzählte meine Geschichte zu Ende.
Als ich fertig war, starrte sie mich so lange so ernst an, dass mich das unbehagliche Gefühl beschlich, sie falsch eingeschätzt zu haben – vielleicht war es mit ihrer Rückendeckung und Toleranz ja doch nicht so weit her. Gleich würde sie mir eine Predigt über Drogen und Leichtfertigkeit halten wie jede x-beliebige ältere Lady.
Stattdessen sagte sie: »Donnerstagnacht hat es um Mitternacht nicht geschneit. Ich glaube, diesen Lazaro muss ich mal googeln.«
Beim Gedanken an die googelnde Hannah schmunzelte ich. Ihre Ausflüge ins Internet führten sie oft auf nicht für siebenundachtzigjährige Frauen gedachtes Terrain.
Sie funkelte mich durch ihre Bifokalbrille an. Bis vor Kurzem hatte sie als Fachärztin für Psychologie an einer bedeutenden Universitätsklinik gearbeitet. Sie betreute privat immer noch ein paar Patientinnen, fast so alt wie sie, die sich nicht mit ihrer Pensionierung abfinden konnten. Ihr fachliches Können widerlegte die Vorurteile über alte Frauen, von denen selbst ich nicht frei war.
»Ich treffe mich nicht mehr mit ihm«, beteuerte ich. »Um so was ging es gar nicht.« Und so schieden wir als Freundinnen.
Aber eine Stunde später rief sie mich zu Hause an und sagte: »Laut Slang-Lexikon ist ein Lazaro ein übler mexikanischer oder kubanischer Macho mit riesigem Gehänge, mit dem du besser nicht anbandelst, weil er dir garantiert den Arsch aufreißt.«
»Das wusste ich gar nicht«, sagte ich und weinte fast vor Anstrengung, nicht laut loszuprusten. Sie muss es mir wohl trotzdem angehört haben, denn sie beendete den Anruf fast beleidigt.
Ich war müde, konnte aber nicht schlafen. Amy war weg, und als ich Jake anrief, landete ich direkt bei der Voicemail. Das war schade, ich hatte gehofft, er würde mit zu unserer Oase kommen. Tagsüber ist er Bürohengst bei einem Energieunternehmen, aber er hat ein grünes Bewusstsein, und kennengelernt haben wir uns in einer Guerilla-Gärtnergruppe. Er war hochmotiviert, aber eher unbedarft, also taten wir uns zusammen. Unsere private Oase lag auf einer Verkehrsinsel mitten auf einer Hauptstraße, fast genau auf halber Strecke zwischen unseren Wohnungen. Dort pflanzten wir übriggebliebene Setzlinge, Blumenzwiebeln und Zwergsträucher aus den Blumenkästen meiner zahlenden Kundschaft ein. Das erregte durchaus einiges Aufsehen, und letzten Frühling schickte das hiesige Onlinemagazin sogar eine Fotografin hin. Die Oase sah bezaubernd aus.
Ich stellte mein Telefon aus und versuchte zu schlafen, ich gab mir wirklich Mühe. Ich nahm sogar zwei von Amys Antihistaminpillen zu Hilfe. Aber am Ende zog ich mich trotz der Kälte an, ging raus und fuhr zur Verkehrsinsel. Mein Gartenschuppen ist hinten in meinem Van, so hab ich all meine Gerätschaften jederzeit zur Hand.
3
Es war eine sternenklare Nacht, und der Halbmond lugte über die Dächer. Mein Atem ging in weißen Schwaden, als ich die Schneeglöckchen und Krokusse betrachtete, die zwischen den Narzissen- und Tulpensprösslingen blühten. Dann, beim Entsorgen des über die Woche angefallenen Großstadtmülls in einen Plastiksack, stieß ich auf ein ungeöffnetes Samentütchen mit Papaver somniferum. Zufällig weiß ich, was P. somniferum ist, denn während Hannah Lazaro googelte, hatte ich zum Schlafmohn recherchiert.
Erstaunt hob ich das Tütchen auf. Es kommt doch nur in Träumen vor, dass genau das, woran du gerade denkst, vor dir auftaucht. Ich steckte es in die Tasche und entfernte den restlichen Müll. Anschließend lockerte ich die Erde zwischen den Goldlauch-Sprösslingen auf und mischte ein wenig Kompost darunter.
»Ich habe das nicht ernsthaft vor«, sagte ich laut. »Es ist ziemlich sicher illegal.« Aber das gilt auch für das unbefugte Aneignen kleiner Flecken Boden, um Blumen und Gemüse darauf zu ziehen.
Ich schaute runter auf die unschuldigen Schneeglöckchen. Ich schaute rauf zum frostigen Mond. Ich schaute nach, ob es auf der Rückseite des Tütchens eine Pflanzanleitung gab. Da stand etwas, aber in einer Schrift, die ich für Griechisch hielt. Trotz der Straßenbeleuchtung war es eigentlich zu dunkel, um etwas zu erkennen.
»Ach, zum Teufel«, sagte ich und schlitzte das Tütchen mit dem Daumennagel auf.
Just als ich die Samen zudeckte und sachte die Erde festdrückte, hielt ein Motorrad neben mir. Der Fahrer blieb rittlings auf seiner Maschine sitzen, nahm den Helm ab, und zum Vorschein kam Lazaros schöner Chauffeur. Er sagte: »Mr. Lazaro schickt mich, um Sie abzuholen.«
Ich sah auf meine Armbanduhr. Es war zwanzig nach zwei. Ich sagte: »Wohin denn? Es ist sehr spät«, wie jede vernünftige Frau. Doch auf einmal war es keine vernünftige Situation. »Wie haben Sie mich gefunden?«
»Ich habe Sie gesucht«, sagte er einfach. »Und da sind Sie.« Begleitet von einem umwerfenden Lächeln, charmant und etwas skurril durch zwei leicht übereinanderstehende Schneidezähne. Ich konnte nicht anders, ich musste zurücklächeln.
»Mr. Lazaro möchte Sie geschäftlich sprechen. Er schickt Ihnen dies als Geste des guten Willens.« Er griff in seine Lederjacke und reichte mir einen Umschlag, warm von seinem Körper.
Als ich ihn öffnete, bemerkte ich den schwarzen Halbmond aus Erde unter meinem Daumennagel, und eine Schliere aus feuchtem Matsch verschmutzte den weißen Umschlag. Darin steckte ein Scheck. Lazaro zahlte mir zweitausend Pfund für einen noch ungenannten geschäftlichen Auftrag.
»Zweitausend Pfund?« Ich starrte den Betrag an, dann den Fahrer.
»Springen Sie auf.« Er zeigte auf den Sitz hinter sich.
»Geht nicht«, sagte ich. »Das ist eine Hauptstraße, ich stehe im Parkverbot. Selbst wenn der hier echt ist …«, ich wedelte mit dem Scheck, »kann ich es mir nicht leisten, dass mein Van abgeschleppt wird.«
Einen Moment lang wirkte er verblüfft. Dann: »Ich fahre Ihnen nach bis zu Ihrer Wohnung. Wir starten von da.«
Ich warf den Müllsack in die Tonne vor dem Damen-Frisiersalon und ging zu meinem Van. Jetzt, wo der schöne junge Mann außer Sicht war und mich nicht mehr mit seinen traumhaften Augen fixierte, hörte ich mich laut sagen: »Bist du denn völlig verrückt, Seema?« Dann fuhr ich heim und parkte in derselben Lücke, die ich vor gut einer Stunde verlassen hatte.
Diesmal hob er nur kurz das Visier und klopfte auf den Sattel hinter sich.
»Ich muss duschen und mich umziehen«, sagte ich und zog meinen Hausschlüssel aus der Tasche.
Er pflückte ihn mir aus der Hand. »Es ist taktisch unklug, einen Auftraggeber warten zu lassen – glauben Sie mir. Wenn Sie frische Kleidung benötigen, erhalten Sie sie vor Ort.«
Genau da hätte mein wahres Ich losbrüllen müssen: »Verpiss dich mitsamt deinem Reithobel.« Um ihn dann mit meinem treuen Spaten von seiner Karre zu fegen und entrüstet davonzustapfen.
Stattdessen überfielen mich jäh Angst und Sehnsucht – Sehnsucht nach etwas anderem, etwas abseits meines stinknormalen Alltags, in dem die ›große Leidenschaft‹ fehlte. Tag um Tag verbringe ich Stunden mit der Suche nach einem Parkplatz für meinen Van, der mir kein Strafmandat einhandelt und von dem aus ich meine Kompostsäcke nicht meilenweit schleppen muss. Ich streite mich mit Amy über die Töpfe mit Setzlingen in der Küche. Ich hab solche Angst vorm Alleinsein, dass ich Jake nie gestanden habe, wie sehr Fußball mich anödet. Es deprimiert mich, für meine Mutter solch eine ständige Enttäuschung zu sein. Meine Fingernägel sind immer verdreckt, und meine Träume gehen nie in Erfüllung.
Jetzt bekam ich Angst, dass meine Träume niemals in Erfüllung gehen würden und dass, wenn mir etwas Rätselhaftes widerfuhr und ein schöner Mann wollte, dass ich hinter ihm aufsaß, ich die Gelegenheit feige verpasste. Ich würde meine einzige Chance auf Schönheit und heimliche Abenteuer vergeigen, weil ich zu vernünftig war, um sie beim Schopf zu packen.
Ich wurde von diesem Motorrad angezogen wie ein Kind von Schokolade.
Tiefhängende Wolken verdeckten den Halbmond, und wieder schneite es, als wir vor einem schmiedeeisernen Tor eintrafen, das eine Mews, ein ehemaliges Stallgebäude, im Stadtteil Belgravia vom Rest der Welt abschottete. Zwei zwinkernde, blinkende Überwachungskameras hüteten das Tor. Mein Biker tippte einen fünfstelligen Code in eine Tastatur, und die Torflügel glitten auf.
Was ich für eine einzige Mews gehalten hatte, entpuppte sich als ein ganzer Irrgarten aus Stallungen. Wir fuhren rechts und noch mal rechts, dann links. Und ganz gleich in welche Richtung wir fuhren, der Schnee trieb mir immer direkt ins Gesicht, folglich musste ich die Augen zukneifen und hinter dem Rücken des Fahrers Schutz suchen, so gut es ging. Er hatte mir keinen Helm zur Verfügung gestellt, also war ich blind und tropfnass.
Wir hielten. »Steigen Sie ab«, sagte er. »Läuten Sie. Es kommt jemand.«
»Kommen Sie denn nicht mit rein?«, setzte ich an, wurde aber abgewürgt, als der Bock aufröhrte und davonfuhr.
Die Tür öffnete ein Rotschopf mit Filmstar-Optik.
Das war kein übliches Mews-Häuschen. Die hübsch auf Country gemachte Tür führte in eine prachtvolle Halle. Es wirkte, als hätte man hinter dem rustikalen Äußeren mindestens sechs Häuser zu einer Art innerstädtischem Herrenhaus zusammengelegt.
»Kommen Sie mit«, sagte die Rothaarige und bog in einen Gang, der von der Halle abzweigte.
Es wurde Zeit, die Krallen auszufahren. Ich blieb stehen und sagte: »Moment – wer sind Sie?«
»Gemma.« Sie warf mir über die Schulter einen Blick zu. Musterte meine durchnässten Haare und Klamotten. Fast lächelte sie. »Ich bin heute Abend Ihre Hostess. Ich versorge Sie mit allem, was Sie für Ihr Wohlergehen benötigen. Hier entlang.«
»Halt, Gemma«, sagte ich. »Wozu brauche ich eine Hostess? Wer mich bei der Arbeit unterbricht, sollte mit Arbeitskleidung rechnen.«
Sie lächelte süß. »Wenn Sie seine Einladung annehmen, müssen Sie Ihrem Gastgeber auch erlauben, sich für Ihr Behagen zuständig zu fühlen. Bitte erzählen Sie mir nicht, Sie fühlen sich wohl – durchnässt, wie Sie sind. Und Sie möchten bestimmt nicht Schnee und Dreck in Mr. Lazaros Haus verteilen.«
Darauf gab es wohl nur eine zivilisierte Antwort. Ich folgte Gemma den Gang entlang zu einem Zimmer, so tief im Inneren des Hauses gelegen, dass ich an meiner Einschätzung der Größe der gesamten Anlage zweifelte.
Der Raum, in den sie mich brachte, war ausgestattet wie ein gehobenes Hotelzimmer. Weißtöne bestimmten das Farbschema. Überm Bett hing ein Druck mit einer von Georgia O’Keefes riesigen Calla-Lilien – in einem weiß-weißen Zimmer natürlich ein Klischee, aber O’Keefe-Blumen fühlen sich für mich immer bedrohlich an. Als wäre die Botschaft: Eines Tages wird abgerechnet, Freundchen, dann schneiden wir dir den Kopf ab und stecken ihn in eine Vase – dann siehst du, wie das ist.
Das Bad war ebenfalls weiß und einschüchternd. Gemma musste mir zeigen, wie die Hightech-Dusche zu bedienen war.
Zuletzt öffnete sie einen begehbaren Schrank und deutete auf eine Stange voller Kleidung, selbstredend alles in Weiß.
»Sie hätten mir vielleicht das blaue Zimmer geben sollen«, sagte ich.
Aber Sarkasmus wirkte bei Gemma nicht. Sie lächelte ihr perfektes Lächeln und sagte: »Wenn Sie so weit sind, läuten Sie bitte dort.« Sie zeigte auf einen Knopf neben der Tür. »Dann komme ich Sie abholen. Bitte versuchen Sie nicht, den Weg auf eigene Faust zu finden – das ist aussichtslos, und außerdem laufen die Hunde frei herum.« Sie schwebte davon und ließ mich mit offenem Mund und einem unbehaglichen Gefühl in der Magengrube zurück.
Aber ich riss mich am Riemen und durchsuchte das Zimmer nach versteckten Kameras. Hinter den weißen Satinvorhängen gab es zu meiner Bestürzung nur eine weiße Wand, kein Fenster. Erst zu diesem Zeitpunkt beschloss ich, dieses schräge Haus auf der Stelle zu verlassen und notfalls zu Fuß durch den Schnee nach Hause zu gehen. Vor Hunden hatte ich keine Angst. Die mag ich, und sie mögen mich.
Aber ich bekam die Tür nicht auf. Ich überprüfte mein Telefon. Kein Empfang.
»Gemma«, brüllte ich mit wachsender Wut, »Sie arrogante Schickse haben mich eingesperrt! Lassen Sie mich raus!« Wieder und wieder drückte ich den Klingelknopf. Niemand kam.
Plötzlich war mir eiskalt. Offenbar befand sich der einzige Heizkörper im Bad. Und dann, nachdem ich noch ein paar Minuten die Klingel malträtiert hatte, flackerte das Zimmerlicht und verlosch.
Ich setzte mich aufs Bett, hockte stur und zitternd im Dunkeln. Der ganze Raum war eine Nötigung.
Im Bad hingegen gab es helles Licht, Fußbodenheizung und Spiegel, die mich schlanker machten. Wer könnte da widerstehen? Ich duschte, wusch mir die strähnigen Haare und trocknete mich mit flauschigen weißen Handtüchern ab. Alles zur Bändigung problematischer Haare stand bereit: Conditioner, Haarspray, Lockenstab und 4-Stufen-Fön.
Ich gab mich mit nichts davon ab. Meine Haare hatten ihren eigenen Kopf. Sie zu zähmen erwies sich seit jeher als ausgeschlossen. Natürlich hatte ich als Teenager viele fruchtlose Stunden damit vergeudet, zutiefst frustriert, weil ich aussehen wollte wie eine silberblonde Schauspielerin mit Haar wie gebügelte Seide. Ich konnte nicht glauben, dass meine ethnische Ausstattung sich komplett meiner Einflussnahme entzog, und saß heulend vor dem Spiegel.
»Oh, vergiss es«, sagte Teenager Amy damals. »Ich hab alles versucht. Nicht mal ich krieg diese Mähne in den Griff. Rasier sie ab. Kauf dir ’ne Perücke. Ich kann nichts mehr tun.« Theatralisch warf sie den Lockenstab aufs Bett, fuhr sich mit den Fingern durch die eigenen goldenen Strähnchen und fügte hinzu: »Gott, bin ich froh, dass ich keine Mizrachi bin.« Nur dank echter Zuneigung hat unsere Freundschaft die Teenagerzeit überlebt.
Zurück im Zimmer stellte ich fest, dass Licht und Heizung wieder gingen, aber meine Klamotten und Schuhe verschwunden waren.
»Ihr Faschisten!«, schrie ich. »Behagen? Dass ich nicht lache. Was zur Hölle wollt ihr von mir?« Ich war sauer und alarmiert. Ich stehe nicht auf Nötigung.
Das Licht flackerte. Ich wurde erneut bedroht. Und hatte nur ein Handtuch als Schutz.
Ich ging zum Schrank. Der Raum war einverstanden, das Licht blieb an.
Ich sah die Kleidung durch, die an der Stange hing. Gärtnerinnen tragen aus nachvollziehbaren Gründen kein Weiß, und ich trage keine Kleider. Ich bin keine Frau fürs Kleid. Vergeblich suchte ich nach weißen Hosen und einem schlichten weißen Hemd.
Schließlich fand ich etwas, das in Dreißigerjahrefilmen als Hausanzug bezeichnet worden wäre: weite Flatterhosen mit einer langen, eng geschnittenen Tunika. Es war aus Seide mit Paspeln und Biesen aus Satin, und es saß so vorteilhaft und fühlte sich so leicht und weich an, dass ich mich fragte, ob ich es je wieder ausziehen mochte. Der Anzug hatte zudem den Vorteil, keine nackte Haut freizulassen. Meine Amazonenarme und -schultern blieben mein Geheimnis. Die Hose war nicht vom Knöchel bis zur Hüfte geschlitzt, es gab weder sexy Trägerchen noch ein tiefes Dekolleté. Und doch fand ich beim Blick in den Ganzkörperspiegel, ich hatte noch nie so hinreißend ausgesehen.
Ich nahm ein Paar praktische flache Schuhe im Ballerina-Stil, warf einen letzten Blick in den herrlich unehrlichen Spiegel und drückte die Klingel, um Gemma zu rufen.
Sie kam unverzüglich, musterte mich und nickte. Sie wollte einen Kommentar abgeben, aber ich kam ihr zuvor.
»Wo sind meine Sachen? Sie hatten kein Recht …«
»Gewaschen und im Trockner«, erklärte sie fröhlich. »Kommen Sie.« Sie drehte sich um und ging so schnell davon, dass ich laufen musste, um sie einzuholen.
Als wir die Halle erreichten, ging sie schnurstracks zu der Treppe auf der anderen Seite, ich hingegen wandte mich nach rechts und trabte zur Ausgangstür.
Und dort traf ich zwei gigantische Wolfshunde.
Sie tauchten aus dem Nichts auf und fingen mich ab, standen zwischen mir und meinem Ziel. Ich ging weiter, bis sie knurrten und lange, scharfe, weiße Fangzähne bleckten. Dann blieb ich stehen und hielt jedem eine Hand hin. Sie duckten sich leicht und reckten die Hälse, um an mir zu schnuppern. Ihr Nackenfell war gesträubt. Ich ging in die Hocke und hielt vollkommen still.
»Seema«, rief Gemma in strengem Ton, »bleiben Sie bei mir. Sie begeben sich in Gefahr.« Mir fiel auf, dass sie kein Stück näher kam.
»Schnauze«, entgegnete ich mit leiser, freundlicher Stimme.
Ich mag Hunde wirklich, und diese beiden hier, wiewohl schwer zu meistern, waren denkwürdige Exemplare ihrer Art. Sie waren extrem groß und kräftig, wohlproportioniert mit dickem, zottigem Pelz. Wir sahen uns an. Schließlich kamen sie näher, die Köpfe noch geduckt, das Nackenfell aufgestellt, aber ohne Zähneblecken. Ich setzte mich auf die Fersen und wartete ab, bis einer von ihnen seine Nase unter mein Kinn schob. Er hätte mir die Gurgel durchbeißen können. Stattdessen leckte er mir den Hals.
»Hallo, schöne Jungs«, sagte ich. Ich fühlte mich geehrt und ergriffen wie so oft im Angesicht kreatürlicher Vollkommenheit.
Beide standen jetzt über mir, schwanzwedelnd, die Ohren aufgestellt, gierig nach Zuwendung.
Hunde sind nicht wie Menschen. Bei Hunden weißt du, woran du bist. Ich schenkte ihnen alle Zuwendung, die sie wollten, und vertraute absolut darauf, dass sie meine Liebe nicht ausnutzten.
Dennoch erhob ich mich langsam. Die beiden waren Jagdhunde – plötzliche Bewegungen regen sie auf. Sie kamen mit mir mit zur Haustür. Ich machte sie auf, und sie stürmten selig hinaus in den Schnee. Doch Lazaros Fahrer stellte sich mir in den Weg.
»Gehen Sie wieder rein«, sagte er. »Sie ruinieren sich die Schuhe.«
»Bringen Sie mich nach Hause. Diese Nummer hier stinkt.«
»Es tut mir leid, dass Sie so denken«, sagte jemand hinter mir.
Ich drehte mich um und sah Lazaro. Er streckte die Hand aus.
»Ich habe das Gefühl, entführt worden zu sein«, sagte ich. »Ich mag das nicht.« Aber aus irgendeinem Grund hatte ich den Drang, seine Hand zu ergreifen. »Sie sollten einer Person nicht die Kleidung wegnehmen und sie nötigen, anzuziehen, was Sie wollen.«
»Sie sehen entzückend aus«, sagte er und zog mich an sich. »Aber ich bestehe darauf, dass Sie mir verraten, was Sie mit meinen Wachhunden angestellt haben. Niemand außer ihrem Hundewart rührt sie an.«
Die Hunde tollten in einer gewaltigen Schneewehe herum, als wäre es Wasser. Nichts macht so glücklich, wie Hunden beim Spielen zuzusehen. Selbst überdimensionierte Hunde haben gern Spaß. »Wo ist denn der Hundewart?«, fragte ich.
»Gemma!«, rief er, und sie tauchte aus ihrem Versteck hinter der Tür auf. »Wo ist Grigori?«
»Ich weiß es nicht, Sir.« Gemma sah unzufrieden mit mir aus. »Jetzt sind die Biester ganz nass und dreckig.«
»Gehen Sie ihn suchen.«
»Und bringen Sie mir ein paar Handtücher mit«, sagte ich zu ihrem sich entfernenden Rücken. »Zwei für die Hunde und eins für meine Füße. Und sehen Sie nach, ob meine Arbeitskleidung trocken ist. Ich möchte gehen.« Lazaro hielt noch immer meine Hand fest, doch trotz der Kälte widerstrebte es mir, von der offenen Tür wegzugehen. Er wirkte zufrieden damit, neben mir zu stehen und den Hunden zuzuschauen.
Gemma kam mit den Handtüchern. »Ich kann Grigori nirgends finden.«
»Dann piepsen Sie ihn an«, sagte Lazaro ungeduldig. Sie warf mir einen vernichtenden Blick zu, holte aber ihr Telefon raus.
»Wie heißen die Hunde?«, fragte ich.
»Ich habe nicht die geringste Ahnung«, sagte er. »Geben Sie ihnen doch Namen.«
»Sie kennen die Namen Ihrer Hunde nicht?«
»Sie haben sie mir ja noch nicht genannt.« Er lächelte schelmisch. Der Kerl war mir ein Rätsel.
Aber ich pfiff kurz, und als sie zu mir schauten, rief ich: »Hierher, Jungs.« Im Galopp kamen sie vom anderen Ende der Mews herbei und schüttelten sich den Schnee aus dem Zottelfell. Lazaro ließ meine Hand los und trat ein gutes Stück zurück.
»Sitz«, befahl ich, als sie die Fußmatte erreichten. Und sie setzten sich prompt und grinsten mit raushängenden roten Zungen.
»Ihr heißt alle beide Beau«, sagte ich, laut genug für Lazaros Ohren. Dann rubbelte ich sie trocken, und sie genossen es, rollten sich sogar auf den Rücken und ließen mich ihre Bäuche und Pfoten abreiben. Ich kämmte mit den Fingern durch ihr Fell. Schon klar, nichts macht Wolfshunde glatt und glänzend, aber ich fasste sie gern an.
Als ich nicht mehr länger herumtrödeln konnte, stand ich auf. Ich war darauf gefasst, mit Hundehaaren und dreckigem Schneematsch besudelt zu sein, doch zu meiner Verblüffung war der seidene Hausanzug noch genauso rein und weiß, wie ich ihn angezogen hatte. Ein Wunder, dem nachzusinnen mir keine Zeit blieb, denn Lazaro bedeutete mir, ihm zu folgen. Das tat ich, und die beiden Beaus kamen mit. Lazaro und Gemma schien das zu missfallen, aber sie schritten nicht ein.
Der Empfangsraum befand sich am oberen Ende der großen Freitreppe. Er war riesig. Wieder waren sämtliche Möbel in Weiß gehalten, aber durch die Gemälde und Skulpturen kam ich mir vor wie in einer Galerie. Ich ging die Wände ab, die Beaus im Schlepptau. Lazaro hatte mir bei unserer ersten Begegnung gesagt, er sei Restaurator, und die Kunst an den Wänden schien mir durchaus Museumsqualität zu haben.
Ich war bloß ein paar Semester auf der Kunsthochschule und weiß eine gute Kopie nicht unbedingt vom Original zu unterscheiden; ich kann nur sagen, alles hier sah echt aus, von den etruskischen Votiv-Terrakotten über die Degas-Pastelle bis zu den Drucken von Paula Rego. Kleine Figuren von Rodin und Brancusi standen verteilt auf Tischen und Kaminsimsen, sogar eine Reiterbronze von Marino Marini, vis-à-vis einem behelmten Kopf von Liz Frink. Und drei Pferde aus der Tang-Dynastie. Unter Glas, auf einem kleinen Sockel zwischen zwei Fenstern, stand ein Trio Kykladenidole, Frauenfiguren aus weißem Marmor. Sie waren kaum dreißig Zentimeter groß. Aber so, wie sie dastanden, hatten sie etwas Ursprüngliches und Mächtiges, die Arme verschränkt, die Gesichter gen Himmel gereckt. Was starrten sie an – den Mond?
»Meine drei Grazien rauben Ihnen den Atem?«, fragte Lazaro.
»Keine Grazien«, murmelte ich in mich hinein. »Göttinnen. Oder wenigstens Priesterinnen von Göttinnen.«
Er lachte.
Ich drehte mich um und sah, dass mich drei Leute anblickten: Lazaro, Gemma und ein großer Kerl, gekleidet wie ein Landedelmann der Kategorie Jagen-Schießen-Angeln. Er wirkte hier so fehl am Platz, als hätte man zwischen den Gemälden in der National Gallery ein Hirschgeweih aufgehängt.
»Das ist Garth Harding«, bemerkte Lazaro. Ich hätte ihm ja die Hand gegeben, aber auch er – seltsam für einen Mann, der wie ein Jäger auftrat – schien zu den Hunden lieber Abstand zu halten.
Die Beaus standen dicht bei mir, stupsten meine Hände an und wollten, dass ich ihre Ohren kraulte. Sie gaben mir Selbstvertrauen.
Lazaro bedeutete Gemma, eine Flasche Champagner zu öffnen. Dann wandte er sich an mich. »Also, Seema, bitte verraten Sie mir, was Sie mit meinen Hunden angestellt haben.«
»Nichts«, sagte ich. »Warum haben Sie mich hergeholt?«
»Das sind auf Angriff trainierte Wachhunde. Sie sehen ja selbst, dass es hier einiges zu schützen gibt. Ich brauche sie, um Fremde abzuschrecken.«
»Und um Leute, die gehen wollen, am Gehen zu hindern?«
»Das kommt gelegentlich vor, ja.«
»Tja, ich mag Hunde und habe keine Angst vor ihnen. Außerdem sind Hunde von Natur aus gesellig. Sie haben sich entwickelt, um mit Menschen in Gemeinschaft zu leben. Ihnen aggressives Verhalten anzutrainieren beleidigt ihr freundliches Naturell.«
»Wolfshunde wurden ursprünglich als Kampfhunde gezüchtet.«
»Vor Urzeiten vielleicht. Und sie wurden auch gezüchtet, um Menschen vor Raubtieren zu schützen. Ich bin kein Raubtier. Diese Hunde wissen das. Also finden sie zu ihrem wahren Naturell zurück. Und sie genießen es. Sehen Sie das nicht?«
Er starrte die Hunde voller Abneigung an. Plötzlich hatte ich Angst vor ihm. Unterkühlt sagte er: »Sie kommen ihrer Aufgabe nicht nach. Das sehe ich.«
»Wie’s aussieht, beschützen die eher Sie als dich«, sagte Garth Harding. Das schien ihm boshafte Befriedigung zu bereiten. Vielleicht war er, obwohl er Lazaros Champagner trank, nicht sein Freund.
»Wieso sollten Sie auch Schutz vor mir brauchen?«, fragte ich. Dann stutzte ich und legte den Beaus meine Hände auf den Kopf. »Falsche Frage – wieso brauche ich Schutz vor Ihnen?«
Gemmas Telefon surrte. »Was?«, sagte sie und drehte sich weg.
Lazaro deutete auf das gefüllte Champagnerglas, das auf einem Beistelltisch auf mich wartete. »Sie sind hier absolut sicher, meine Liebe. Verzeihen Sie einem alten Mann seine Paranoia. Ich habe schon mehrere Kriege erlebt und mir teure Menschen und Besitztümer verloren.«
Deswegen willigte ich ein, seinen Champagner zu trinken. Ich hätte sagen können: »Na und?« oder »Das gibt Ihnen nicht das Recht, mich zu kidnappen« oder »Sie sehen nicht aus, als hätten Sie viel gelitten.« Aber wenn mich meine Familiengeschichte etwas gelehrt hatte, dann dass Überlebende sich manchmal höchst eigenartig verhalten.
Mein Vater erzählte mir, als er noch lebte, von zwei sehr reichen, sehr alten Frauen, seinen Großtanten. Sie waren im Zweiten Weltkrieg von den Japanern interniert worden. Sogar noch unter Gefangenen wurden sie innerhalb des Lagers in ein winziges Ghetto ausgesondert. Sie waren nicht weiß genug oder europäisch genug, um von den anderen Insassen akzeptiert zu werden.
Anfangs gaben sie sich extrem viel Mühe, weiter koscher zu leben, aber bei den Hungerrationen war das unmöglich. Als sie bei Kriegsende vom amerikanischen Roten Kreuz gerettet wurden, sahen sie aus wie die Skelette von zwei winzigen Vögelchen.
Aber selbst hungernd, elend und zerlumpt waren sie sehr reich geblieben, und deshalb zogen sie nach Europa, als sie Hongkong verließen. Schon um es allen zu zeigen, glaubte mein Vater. Sie verbrachten jedes Jahr neun Monate im Hotel Georges V in Paris und drei Monate im Grosvenor House Hotel an der Park Lane in London.
Mein Vater erzählte mir, dass er sie als Kind immer besuchen musste, wenn sie nach England kamen. Sie waren nach wie vor winzig und dürr mit Händen wie Klauen toter Vögel. Ihre Haut erinnerte an abgefallene Rosenblütenblätter, doch sie rochen nach Veilchen. Sie trugen immer Schwarz. Sie hießen Ramah und Moselle, und sie sagten meinem kleinen Vater, dass sie um der Toten willen dauerhaft in Trauer gingen. Seine Mutter versuchte ihm den Mund zu verbieten, aber bei einem seiner letzten Besuche fragte er doch nach dem Lager. Eine direkte, ungehobelte Frage, die in seiner Familie niemand jemals stellte. Doch Ramah und Moselle waren durchaus willens, mit ihm darüber zu sprechen. Zuletzt sagte Ramah: »Möchtest du ein Geheimnis wissen? Komm mal mit.« Die zwei Schwestern führten ihn ins gemeinsame Schlafzimmer und zeigten ihm einen großen Kühlschrank, der in einer riesigen Schrankwand versteckt war.
»Egal wo wir sind, wir haben immer einen Kühlschrank voller Essen. Schau hin, schau.«
Er schaute hin und sah, dass er gerammelt voll war mit einer Palette von Reisgerichten, einem Brathähnchen, Lammfilet in Scheiben, Bergen von gewürztem Couscous, allerlei Brotsorten, Schokoladenmousse, einer Vielfalt von Kuchen – mehr, als er fassen konnte.
»Wir gehen gern hungrig zu Bett«, flüsterte Moselle.
»Wir wachen gern tief in der Nacht mit Heißhunger auf«, raunte Ramah ihm ins Ohr. »Dann stehen wir auf und öffnen den Kühlschrank, um all diese Speisen anzuschauen.«
»Manchmal«, sagte Moselle, »laden wir uns die Teller voll und essen. Aber manchmal, mein Kleiner, füllt uns schon der Anblick all der Speisen, die wir essen könnten, den Bauch, und wir gehen wieder ins Bett und schlafen friedlich.«
»Das ist eine Kriegsgeschichte«, erklärte mein Vater mir viele Jahre später. »Eine Überlebendengeschichte. Es gibt viele seltsame Geschichten.«
Ich nahm das Glas, das Lazaro mir hinhielt, und fand es ganz selbstverständlich, dass ein Mann, der Kriege und Verlust erlebt hatte, zum Sammler wurde und den unwiderstehlichen Drang empfand, seine Habe zu beschützen.
Gemma blickte vom Telefon auf und sagte: »Das Abendessen ist fertig.« Erstaunt sah ich auf die Uhr. Oder vielmehr auf mein Handgelenk, wo meine Uhr sein sollte. Richtig, ich hatte sie zum Duschen abgenommen. Jetzt waren sie und mein Telefon verschwunden.
Garth Harding rieb sich erwartungsvoll die Hände.
Gemma sagte: »Ich fürchte, die Hunde dürfen nicht in den Speisesaal.«
Ich sagte: »Ich hab keinen Hunger. Es ist viel zu spät fürs Abendessen und erheblich zu früh fürs Frühstück. Bitte geben Sie mir meine Uhr, mein Telefon, meine Klamotten und meine Schuhe. Ich möchte nach Hause.«
»Sie haben Mr. Lazaros Scheck angenommen«, sagte sie.
»Und Sie haben ihn einkassiert, mitsamt allem anderen, was ich bei mir hatte. Ich bin nicht verpflichtet zu bleiben.«
»Bitte, meine Liebe«, sagte Lazaro, »beachten Sie Gemma gar nicht. Sie bekommen alles zurück. Gemma, holen Sie Seemas Sachen. Ich weiß, es war nicht Ihre Absicht, dass unser Gast sich unwohl fühlt.«
Ich wollte sagen: ›Ich bin nicht euer Gast.‹ Aber irgendwie blieben die Worte zu meiner Bestürzung hinter meiner Zunge stecken.
Diesmal ignorierte er die Hunde, nahm wieder meine Hand und zog mich in einen Speisesaal. Er war mit Kerzen beleuchtet und die Wände hingen voller Gemälde von Obst und Blumen – brillanter Hyperrealismus. Ich musste an Jan Brueghel den Älteren denken, denn in jedem Bild gab es irgendwo eine welke Blüte oder eine faulige Frucht: die Erinnerung an Tod und Verwesung, die wie Zeitbomben in allem Natürlichen lauern.
Der Saal wirkte düster und bedrückend, sehr anders als das Weiß des Wohnzimmers. Ein ovaler Mahagonitisch mit dunkelroter Tischdecke, die das Kerzenlicht zu verzehren schien und das in Massen aufgetischte Essen fast unsichtbar machte. Die Hunde folgten mir bei Fuß, die Köpfe gesenkt, die Ohren angelegt.
»Ah, Pasqual«, sagte Lazaro, als der bleiche Fahrer eintrat. »Getränke für unsere Gäste.«
Garth Harding war schon dabei, sich ein großes Glas Rotwein einzuschenken.
Pasqual blieb wie angewurzelt in der Tür stehen. »Wieso sind hier Hunde?« Er trug jetzt Abendgarderobe, schwarzer Anzug mit schneeweißem halsoffenem Hemd. Er sah aus, als hätte er in seinem ganzen Leben noch nie ein Motorrad gesehen.
»Unglücklicherweise«, sagte Garth Harding, setzte sich zu Tisch und kippte sich einen großen Schluck Wein in den Schlund, »sind die verfluchten Hunde und unsere kleine Freundin hier ganz verrückt nacheinander.«
»Sind Sie alle allergisch gegen Hunde?«, fragte ich. »Oder ist es andersrum?« Seine Wortwahl beschloss ich zu übergehen: Nur jemand von Garths Körpergröße würde mich klein nennen.
Lazaro rückte einen Stuhl für mich zurecht. »Könnten Sie Ihre Beaus anweisen, ruhig und außer Sicht unter dem Tisch zu bleiben?«, fragte er. »Andernfalls zieht sich Pasqual in die Bibliothek zurück, und niemand wird beköstigt.«
Ohne zu fragen, griff ich mir eine Gabel, nahm von einer goldenen Servierplatte zwei dicke Scheiben kaltes rosa Roastbeef und fütterte die Beaus damit, bevor ich sie außer Sicht zu meinen Füßen Platz machen ließ. An sich würde ich nie sagen, dass Liebe einer Person Besitzrecht gibt, aber da alle außer mir die Hunde hassten, gehörten sie jetzt zu mir. Ihr warmer feuchter Atem auf meinen albernen weißen Schühchen fühlte sich vertraut und wohlig an.
Gemma tauchte neben meinem Stuhl auf und brachte eine prallgefüllte Yves-Saint-Laurent-Tragetasche. Sie schob sie unter meinen Stuhl, aber ich kam nicht dazu, den Inhalt zu prüfen, weil Lazaro anrückte und sich neben mich setzte.
Gleichzeitig kamen mehrere andere Leute herein. Zwei davon, ein Mann und eine Frau in teurer, aber ländlich anmutender Kleidung, setzten sich links und rechts neben Garth Harding. Seine Kinder? Seine Entourage? Ich wurde immer desorientierter.
Als wäre sie extra entworfen, um maximale Verwirrung zu stiften, stiefelte eine riesengroße Frau im Abendanzug samt Fliege zum anderen Ende des Tischs, flankiert von zwei jungen Männern, beide mit Buchhalterbrille und grauem Anzug.
Der Champagner half auch nicht gerade. Mühsam unterdrückte ich ein Kichern.
»Sie amüsieren sich?«, fragte Lazaro lächelnd.
»Hier sind alle irgendwie kostümiert.« Ich musterte erst Garth Harding, dann die neue Frau. »Der Landedelmann, die Drahtzieherin und Sie, der Ästhet – lauter wandelnde Archetypen.«
»Du meine Güte«, sagte Lazaro. »Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber wie unhöflich von mir: Darf ich vorstellen, Lesley Sharpe und ihre beiden Assistenten Julian und Duncan.«
Als sie ihre Namen hörten, sahen alle drei mich an und nickten. Ich nickte zurück. Gemma nahm neben Lazaro Platz, Pasqual setzte sich neben mich. Zehn an einem Tisch, aber es schien nicht vorgesehen, dass die Gruppen sich vermischten. Ich hatte kaum Zeit, mich zu fragen, was eine Gärtnerin in dieser Runde zu suchen hatte, da kamen schon Bedienstete mit Platten voll dampfendem Fleisch.
Es gab blutige Steaks, rosa Rinderbrust, Krustenbraten vom Schwein, Lamm mit Rosmarin, Brathähnchen, Kassler und Wildbret. Ich wies alles zurück. Ich war baff: Die kalten Platten auf dem Tisch waren bisher nicht abgeräumt worden, und die Unmengen von Fleisch waren schier überwältigend.
Gerade wollte ich Lazaro fragen, für welche Armee er kochen ließ, da wandte er sich mir zu und sagte: »Ist das eine Frage der Speisegebote, oder mögen Sie grundsätzlich kein Fleisch?«
Ich starrte ihn an. Der Speisesaal verstummte, und ich fühlte neun Paar neugierige Augen auf mich gerichtet. Errötend sagte ich: »Ich sag doch, ich habe keinen Hunger. Aber Sie kommen mir jetzt schon zum zweiten Mal mit koscherer Kultur, also antworte ich nach bestem Wissen und Gewissen: Mich persönlich überzeugt von den Speisegeboten die Regel, die das Mischen von Milch und Blut verbietet. Milch ist Geschenk, Blut ist Gewalt. Das ist das, was für mich in der heutigen Welt Sinn ergibt. Und ich für mein Teil will nichts mit Gewalt nehmen. Mit anderen Worten: Richtig, ich esse kein Fleisch.«
»Aus religiöser Überzeugung?«
»Aus persönlicher Überzeugung. Der Kontext meiner Antwort ergab sich einzig aus der Art, wie Sie gefragt haben.«
»Nämlich in der Terminologie religiösen Glaubens und nicht im Sinne weltlicher Überzeugung. Verstehe. Unsere erste Begegnung fand ja auch in einem ganz und gar nicht koscheren Rahmen statt. Die Speckkrusten haben Sie jedoch abgelehnt.«
»Wer würde das nicht?«, bemerkte Lesley Sharpe von oben herab. »Aber Sie sind wirklich Jüdin?«
»Eine sehr schlechte Jüdin, wenn es nach meiner Mutter und ihrem Rabbi geht.«
»Und doch«, sagte Lazaro und warf Lesley einen missbilligenden Blick zu, »befolgen Sie die Vorschriften zu Milch und Fleisch, wie sie im Exodus und im Deuteronomium stehen? Und ich nehme an, Ihre Mutter hält koschere Küche.«
»Meine Mutter muss weder in der wirklichen Welt ihren Lebensunterhalt verdienen noch einen Bekanntenkreis pflegen, der mehr als eine Handvoll Familien umfasst – falls Sie das überhaupt etwas angeht.«
»Vielleicht sind Sie ja bloß Vegetarierin«, sagte Garth Harding. »Und kein bisschen religiös.« Das Wort Vegetarierin klang bei ihm nach etwas Unzüchtigem. Er wedelte mit einer Gabel voll blutigem Steak in meine Richtung. »Aber diese verdammten Hunde haben Sie mit Fleisch gefüttert.«
»Die Hunde sind Fleischfresser – sie haben keine Wahl.« Ich wandte mich an Lazaro. »Wozu haben Sie mich hergeholt? Was gehen Sie meine sogenannten Überzeugungen an – Sie alle? Und warum hat mir Pasqual zweitausend Mäuse gegeben?«
Er legte mir seine Hand auf den Arm, um mich am Aufstehen zu hindern. Es war eine sonnengebräunte, wohlgestalte Hand. Die Fingernägel oval und glattgefeilt. Am rechten Mittelfinger trug er einen blassgoldenen Siegelring. Der Stein war ein Karneol mit einem tief in die Oberfläche eingeätzten Halbmond. Dessen Mondphase exakt der entsprach, die ich über meinem Guerillagarten auf einer herrenlosen Verkehrsinsel an der Hauptstraße in North London gesehen hatte.
Ich war weit weg von zu Hause.
Lazaro sagte: »Ich habe Ihnen einen Vorschuss geschickt – als Geste des guten Willens. Wir …«, er wedelte mit der Hand im Tischkreis, »haben ein kleines Clubhaus. Wir hätten gern, dass Sie uns einen Dachgarten gestalten.«
»Oh.« Gerade hatte ich seine Hand abschütteln und hinausrauschen wollen. Jetzt kam ich mir blöd vor und sah vermutlich auch so aus. »Da hätten Sie doch einfach anrufen können.«
»Bestehen Sie wirklich auf sie?«, fragte Lesley Sharpe.
»Sie ist schwierig, und sie ist Vegetarierin«, sprang Garth Harding ihr bei.
»Sie soll uns ja keinen Küchengarten anlegen«, sagte Lazaro geduldig. Alle lachten laut.
Mir erschloss sich die Komik nicht, ich hatte nur das unbehagliche Gefühl, dass es um mich ging. Aber vielleicht kam das Unbehagen auch von der Nähe zu so viel Fleisch.
»Sie riskieren ziemlich viel.« Garth stopfte sich einen großen Bissen triefendes Fleisch in den Mund.
Einer der Buchhalter schob Sharpe ein Memo hin, als wäre es eine Vorstandssitzung und kein Abendessen. Sie nickte. »Haben Sie die Risiken einkalkuliert?«, fragte sie Lazaro.
»Wie bitte?« Ich sah Lazaro an. »Was denn für Risiken?«
Er erhob sich. »Es ist noch zu früh für solche Spekulationen. Ich schlage vor, da unsere Besucherin nichts essen möchte, führe ich sie in die Bibliothek, damit sie sich die Fotos ansieht. Ihre Meinung ist wichtig. Derweil genießen Sie bitte weiterhin alles, was meine Küche zu bieten hat.«
Ich erhob mich ebenfalls, achtete darauf, an die Tasche unter meinem Stuhl zu denken, und gefolgt von den Beaus verließen wir den Speisesaal.
Draußen wartete ein Mann, er lehnte an der Wand und rauchte eine schwarze Zigarette. Sein Haar war ungeschnitten, er trug einen schlabbrigen braunen Trainingsanzug, graue Turnschuhe und sein Gesicht war voller Aknenarben. Es hätte mich erleichtern können, hier jemand Normales zu sehen, aber er hatte zwei Leinen mit üblen Stachelhalsbändern dabei.
»Grigori«, sagte Lazaro scharf. »Künftig bleiben Sie bitte in Rufweite, wenn Gäste im Haus sind und die Hunde frei herumlaufen.«
»Sieht nicht aus, als hätten sie irgendwem was getan«, sagte Grigori und stierte die Hunde kalt an. Sie stierten zurück. »Ich glaub, wenn Sie die Wahl hätten zwischen einer Explosion in Ihrem Gasboiler und zwei freilaufenden Hunden, würden Sie erst den Gasboiler versorgen. So wie ich.«
»Na schön«, sagte Lazaro. »Aber jetzt nehmen Sie sie mit und füttern sie, und treten Sie ja nicht Ihre Zigarette auf dem Boden aus.«
Die Beaus unterwarfen sich stoisch Grigoris Halsbändern und schritten an seiner Seite davon. Insgeheim schwor ich mir, wenn es menschenmöglich war, würde ich zurückkommen und sie retten. Aber ich sagte nichts – du behältst deine Pläne für dich, wenn du Diebstahl im Sinn hast.
Ich war todmüde, fragte mich aber unwillkürlich, ob die hier für die Inneneinrichtung zuständige Person ein Filmfreak war. Die Bibliothek war so typisch Herrenhausbibliothek im Spielfilm, dass ich das Gefühl hatte, jeden Winkel zu kennen. Es gab einen Eichentisch mit grün beschirmten Leselampen, auf dem in gleichen Abständen Ausgaben der Times und der Financial Times ausgelegt waren. Lazaro zog einen Hartholzstuhl für mich heran und legte eine lederne Mappe vor mich. Ich seufzte und schlug sie auf. Die fünf Fotos waren Luftaufnahmen eines Hauses – identisch bis auf die Schatten.
»Wo ist Norden?«, fragte ich.
»Sehr gute Frage.« Er streichelte meinen Arm, eine anerkennende Liebkosung. In meinem Hinterkopf sagte etwas: ›Das ist alles bizarr hier, und ich mag deine Freunde nicht.‹ Es war eine leise, kalte Stimme. Aber meine Haut sagte: ›Bitte liebe mich.‹
Er zeigte auf Norden, und ich ordnete die Fotos von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang an, indem ich mich nach dem Schattenwurf benachbarter Gebäude richtete. »Innenstadt«, murmelte ich. »Trotzdem ganz schön viel Sonnenschein. Wie sind die Maße?«
»Vielleicht vierzig mal sechzig Meter.«
Es war natürlich ein Flachdach. An einem Ende ein Aufbau, der Klimaanlage und Wassertank verbarg. Ich sagte: »Haben Sie Architekturzeichnungen oder Statikpläne? Denn die Tragkraft spielt eine entscheidende Rolle. Und haben Sie eine behördliche Genehmigung?«
»Alles vorhanden«, sagte er.
»Zugang?« Ich zeigte auf eine Falltür. »Das da wird nicht reichen, weder um den Garten anzulegen noch um ihn zu pflegen.«
Ich versuchte erfahren zu klingen, pragmatisch und souverän, aber mein Kopf war voller Träume. Rosen rankten sich über die Mauerkrone der Einfassung und bildeten einen Vorhang an der Hausfront. Oder Blauregen. Goldene Geisterkarpfen faulenzten dicht unter der Oberfläche eines mit blauen Schwertlilien gesäumten Teichs. Kamelien für den Januar, Fächer-Ahorn für den Herbst – ich sah es alles vor mir.
Bloß hundertsechzig Quadratmeter, dachte ich betrübt, nachdem ich den Bedarf für Versorgung und Zugang abgezogen hatte. Und dann fing ich an, über Terrassierung nachzudenken und über clevere Raumgewinnungsmöglichkeiten. Ich stellte mir einen grasbewachsenen Miniatur-Hügel vor mit einem winzigen Hain aus Zwergbäumen auf seiner Kuppe.
»Sie beginnen zu träumen«, sagte Lazaro sanft. »Zeit, ein Pfeifchen zu teilen oder auch zwei. Dann schicke ich Sie nach Hause. Morgen fertigen Sie ausgefallene und wundervolle Zeichnungen an. Dann haben wir etwas, worüber wir sprechen können. Diese Arbeit könnte der Auftakt zu einem schönen neuen Leben sein. Sie werden sehen.«
4
Am nächsten Morgen erwachte ich schwermütig vom Nachklang eines Traums: Lazaro wanderte einen steinigen Berghang hinunter. Hinter ihm war ein leeres Grab in die Felswand eingelassen. In den Händen trug er ein Paar juwelenbesetzte weiße Slipper, die reichte er mir und sagte: »Tanz für mich, meine junge Liebste.« Ich zog sie eilends an und wusste, sie würden mich befähigen zu tanzen, wie ich nie zuvor getanzt hatte. Doch dann wachte ich auf, ohne auch nur einen Ton Musik gehört zu haben. Ich fühlte mich beraubt und den Tränen nahe.
Es war beinahe Mittag. Ich hatte den ganzen Vormittag verloren. Entsetzt fuhr ich hoch, fürchtete, ich hätte Termine vergeigt. Aber dann sah ich in meinem Kalender, dass ich mir den Vormittag freigehalten hatte, um mich mit Gartenbedarf einzudecken.
Die einzige Sprachnachricht war von Hannah, die sagte: »Lazarus ist auch eine Bezeichnung für einen Bettler. Ach ja, und für einen Aussätzigen. Sei bitte vorsichtig, Liebes.«
Ich wünschte, ich hätte mich ihr nicht anvertraut. Sie war eine sehr alte Frau und verbiss sich manchmal in Belanglosigkeiten. Ich beschloss, sie nicht mehr zu besuchen, bis sie ihre fixe Idee bezüglich Lazaro überwunden hatte.
Ich betrachtete meine Einkaufsliste. Außer Pflanzen und Saatgut musste ich Kompost, Quarzsand und Kies besorgen. Schon der Gedanke, diese Ladung ins Auto wuchten zu müssen, war mir zu viel. Stattdessen trat ich an meinen Schrank und sah den weißen Hausanzug an. Ordentlich hing er zwischen meinen restlichen Klamotten, die im Vergleich billig und schäbig wirkten. Ein schönes neues Leben.
Ich ging an meinen Schreibtisch und suchte Zeichenblock, Bleistifte und Wasserfarben heraus. Dann machte ich eine Liste, die mit Engelstrompeten und Oleander begann, und schrieb sämtliche mir bekannten Blumen auf, die ihren Duft nachts entfalteten. Aber irgendwie kreisten meine Gedanken immer wieder um Tabakpflanzen, insbesondere Nicotiana alata