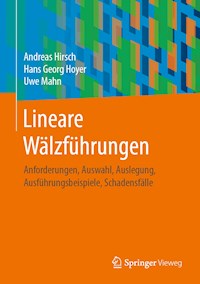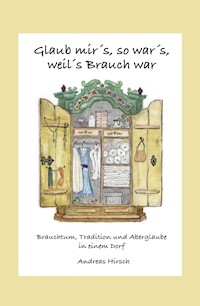
3,99 €
Mehr erfahren.
Der Autor, Andreas Hirsch ist 1939 auf dem Goggerbauernhof in Eitensheim geboren und aufgewachsen. Er war immer Bürger seiner Heimatgemeinde. Über 30 Jahre widmete er sich der Geschichte, dem Brauchtum, dem Dialekt und der historischen Entwicklung seines Dorfes und seiner näheren Heimat. Seit seiner Kindheit interessierten ihn das Brauchtum und die Tradition in der über Jahrhunderte hinweg vom christlichen Glauben und dem Bauerntum geprägten fruchtbaren Gegend an den südlichen Ausläufen des Frankenjuras. Die harte Arbeit im Hof, Stall und auf den Fluren hat diesen ruhigen, besinnlichen aber auch fröhlichen Menschenschlag geprägt. Das zeigt sich noch immer in der Familientradition und den verschiedenen Dorf- und Vereinsfesten. Die Heimatverbundenheit ist ein nach wie vor prägendes Element der Dorf-gemeinschaft, trotz Industrialisierung, Internet, Handy und Computer. Ihr Credo lautet: "Lass die Welt sich globalisieren, do san mia dahoam."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Glaub mir’s, so war’s, weil’s Brauch war
Brauchtum, Tradition und Aberglaube in einem Dorf
Andreas Hirsch
Brauchtum, Tradition und Aberglaube in einem Dorf
Die schnelllebige moderne Zeit im dritten Jahrtausend birgt für die Weiterentwicklung eines harmonischen Dorflebens vielfältige Gefahren. Da ist die Ausweitung der Baugebiete mit den bekannten Auswucherungsproblemen. Die Ursache liegt in den noch relativ erschwinglichen Grundstücks- und Mietpreisen und der Stadtflucht der Menschen, welche der Tristesse der Industrie- und Supermarktödnis entfliehen wollen und das heile Landleben suchen. Eine Rolle spielt auch der steigende Trend zum Single-Haushalt. Der Bauernstand mit seinen einstmals großen Familien, in denen meist drei Generationen unter einem Dach zusammen wohnten, hat weitgehend an Bedeutung verloren. Die Kinder verlassen ihr Elternhaus und ziehen aus der Dorfmitte hinaus in ihr eigenes Heim am Ortsrand. Der Dorfkern verödet. Die Neubürger integrieren sich in das Dorfgeschehen sehr zurückhaltend. Die Einheimischen finden nur schwer den Weg zum Miteinander mit den Neubürgern. Diese, man möchte beinahe sagen Konfrontation, erlebten die Einheimischen auch nach dem 2. Weltkrieg, als viele Heimatvertriebene und Flüchtlinge in durch die Kriegsgeschehnisse oft in Mitleidenschaft gekommene Häusern untergebracht, und in das Dorfleben einbezogen werden mussten. Die Bewältigung dieses Prozesses dauerte rund 20 Jahre. Jetzt mehren sich die Anzeichen dafür, dass die alte Dorfgemeinschaft in Altbürger und Zuazogne aufgespaltet und der Ort zur Schlafstätte wird. Ein gelebtes dörfliches Brauchtum, das alle Bürger in den jahreszeitlichen Ablauf mit einbezieht, könnte ein Weg sein, um eine frische und lebensfrohe Dorfgemeinschaft zu entwickeln. Selbstverständlich können und sollen nicht alle alten Bräuche und Sitten wiedererweckt werden. Genauso wenig sind Pseudo-Bräuche, womöglich noch mit Konsumzwängen unterlegt und ungeeignet ein Dorfleben zum Blühen zu bringen. Zum Einstieg in eine neue Dorfgemeinschaft wäre es wünschenswert, wenn sich jeder Einzelne Gedanken darüber machen würde, was er persönlich zur Entwicklung eines liebenswerten Miteinanders aller Dorfbewohner beitragen könnte. Auf geht’s bringen wir den Mut und die Bereitschaft auf, unbefangen und unvoreingenommen im Dorfleben, in den Vereinen, Organisationen und Verbänden aktiv mitzumachen. Gartln, ratschn, sportln, radln. Auf geht’s, versuchen wir es – heute. Gehen wir auf unseren Nachbarn zu. Es lebt sich im Alltag angenehmer, wenn wir die Nachbarschaft auch in der Gemeinde pflegen.
Von Brauchtum spricht man im Allgemeinen dann, wenn Leute einer Gemeinschaft wie selbstverständlich bestimmt Handlungen vollziehen oder dabei mitmachen, ohne dass sie dazu aufgefordert wurden. Es geht sogar soweit, dass sich diejenigen, die nicht dabei sind, wie ausgegrenzt vorkommen. Bräuche wurden und werden auch dann, wenn sie einen lustigen Hintergrund haben, mit großem Ernst eingehalten.
Die Dorfgemeinschaft wurde über einen langen Zeitraum vorwiegend vom Bauerntum geprägt. Dies hat sich auch im Brauchtum deutlich niedergeschlagen. Die Bauern waren schon immer von Wind und Wetter abhängig und so ist es nicht verwunderlich, dass ein großer Teil der Bräuche im Dorf einen Zusammenhang mit den Naturgewalten hatten. Zwar waren die Leute stets brav christgläubig orientiert, aber weil halt „a doppelte Naht allemoi bessa hoit ois a oafache“, hat man sich nicht nur ausschließlich auf die Heilige Dreifaltigkeit verlassen. Nach der Überlegung; (‚ma woas ja nix gnaus‘), hat man ‚diamoi‘ (gelegentlich) auch noch die alten Götter und helfenden Geister aus der frühchristlichen Zeit mit in Anspruch genommen.
Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Ausarbeitung. Es wurde zur Unterhaltung des Lesers konzipiert. Um meine Vision umsetzen zu können habe mir Bürgerinnen und Bürgern persönlich Vieles erzählt. Ein großer Teil der Angaben konnten durch die Recherche in diversen Archiven, in Kreis-. Gemeinde- und Pfarrunterlagen „ausgegraben werden.“ Einiges weiß ich aus eigener Erinnerung, oder konnte aus diversen regionalen Publikationen, Dokumenten und alten Unterlagen zusammengetragen werden.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
© 2015 Andreas Hirsch
Autor und Herausgeber
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Brauchtumsregister
Abdanken
130
Advent, der
20
Adventsbrauch, der
20
Adventskalender, der
21
Adventskranz, der
21
Adventsingen, das
33
Adventssonntage, die
20
Agatha-Brot, das
56
Allerheiligen
104
Allerheiligenkranz, der
105
Allerheiligenspitz, der
105
Allersellen
104
Allerseelenmaß, die
105
Allerweltskirchweih, die
104
Altweibermühle, die
51
andienen
54
Andre, Andreastag
15
Andreas Weissagung
15
Andreaslos, das
15
Andreasreiser, die
16
Angelusläuten, das
19
angestammter Kirchenstuhl
58
Anna-Dreißigster, der
97
Antlaß, der Ablass
68
Antlaß-Kränzlein
90
Antlaßeier, die
67
Antlaßpfinsta, der
67
Antonius Tag, der Anzeig, die
49
Arma Christi, die
71
Armenseelenkerzen, die
54
Arnt, die (Ernte)
93
Arntgans, die
93
Artngeld, das
94
Aschermittwoch
62
Aschermittwoch Fischessen
62
Aufbleiber, der
36
Auferstehungsfahne, die
71
Auffahrtstag, der
87
aufsagen
54
Aus der Gesellschaft der Ledigen ziehen
123
Ausgemachte, das
55
Ausgespannte, die
69
ausgräuchert
26
ausgspuit
50
Ausgsuachtn’, die
29
auslassen’
113
Auslös, die
77
Ausgmachen, das
109
Auslös, die
128
Ausrutscher, der
117
Ausschnalzen, das
39
Ausstehtag, der
55
Ausständige, die
55
Austrägler, der
32
auszahlt
55
Auszogne, die
60
auszogne Schmoiznoln
103
Babet, Barbara
22
Babettoch, der
22
Bachordnung, die
116
Bam ohrama, den
45
Barbarazweige, die
22
Bärendreck, der
85
Bartholomäustag, der
95
Bauernhochzeit, die
124
Bauernjahrtag, der
56
Bauernkripperl, das
22
Bauernobmann, der
57
Bauschngarbal, das
118
Beichtgab, die
72
Beichtgeld, das
72
Beichtzettel, der
72
Beisteuer, die
113
benedicieren (segnen)
67
Bercht, die
28
Besenkreuz, das
136
Betläuter, der
26
Bettstatttretn’, das
30
Beziehungen, die
123
Biergutzerl, das
110
Bitterin, die
110
Bittprozessionen, die
79
Blasitag, der
56
Blasiussegen, der
56
Blech und Silberling
58
Bleiber, der
53
Bleigießen, das
36
bludiger Thamerl, der
27
Bockbier, das
64
Bock-Sunnta, der
73
Boizn, die
94
Böllerer, der
49
Brauch um das Kranksein
106
Brauchtum zur Geburt
133
Brautausstoßen, das
131
Brautkränze, die
124
Brautstehlen, das
127
Breznstrick, der
39
Bruderschaftsstäbe, die
78
Brühsuppe, die
34
Bschoadessn, das
122
Bschoadtuch, da
57
Büchsn’ aufziag
134
Buchstabenschreiben, das
15
Buttntroga, der
51
C + B + C
44
Christbaumaufstelln, das
31
Christbaumversteigerung, die
39
Christie Himmelfahrt
82
Christkindlbrief, der
26
Christkindlfiguren, die
32
Christkindlsingen, das
33
Christkindltragen, das
32
Christkindlwiege, die
39
da Kunta (das Konto)
42
Dachsngirlanten, die
76
Dachsnring, die
76
Darbwurst, die
64
das Eingepackte
128
das Hohheilige Osterfest
71
das Vieh verrichten
59
das Zweite Gesicht
27
Dauerkranz, der
105
Dehla, der
42
der arme Schlucker
58
der große Frauentag
94
der Kirda, Kirchweih
103
des san Pfanz
142
die drei heiligen Männer
44
die erste Wurst
64
die Fasten
63
Dienstboten, die
54
Dienstweiser, der
54
Dispens, die
91
die wuidn Männa
84
Docken, die
32
Docken machen
32
Dohl, die
42
Donnerer, der
49
Dorfgred, das
129
Dorfhirte, der
86/102
Dorfzier, die
76
Draufgänger, der
122
Drei Heilige Moila
83
Dreierstückl, das
126
Dreikönigskletzn, die
43
Dreikönigsroas, die
45
Dreikönigstag, der
44
Dreikönigswasser, das
44
Dreißigsten Eier, die
97
Drensch, der
131
Dreschn, das
97
Drischleg, die
99
Drischln, das
98
Drogabats, das
54
Druden, die
37
Drudenei, das
37
Drudenfuß, der
37
Drudenkreuz, das
37
Dulten, die
85
Dusl, der
22
ebas odua
133
Ehalten, die
54
Ehehinternis, das
121
Eheseminar, das
121
Eheverlöbnis, das
121
Ehestreitigkeiten, die
134
Ehewein
123
Ehrenmutter, die
125
Ehrenvater, der
125
eigener Rauch
118
einaschln’
62
einen Korb kriegen
117
eingebrockte Suppe, die
119
Eingepackte, das
117
Eingschmust
37
Einsagen, das
123
Einstehen, das
54
Einstehtag, der
54
Eintrag, der
41
Eisstockschießen
45
Elevatio, die
97
Englamt, das
19
Epiphanie, die
43
Erntebrauch, der
91
Erntedankfest, das
101
Erntezeit
94
Ersterben, das
106
Ewiges Licht, das
112
Fahrzeugsegnung, die
78
Falottn’, die
139
Fallsucht, die
59
Fasching, der
46
Fastenexempell, das
63
Fastengeister, die
64
Fastenkraut, das
63
Fastensonntag, der
64
Fastenspeisen, die
63
Fastenpredigt, die
63
Fastentuch, das
62
Fastenvögel, die
63
Fastenzeit, die
60/63
Fastnachtsumzüge, die
50
Fatschnkindl, das
138
Favortechnik, die
105
Feldstoarucka, der
41
Fensterln, das
13
Feston, das
105
Fetzln’, das
41
Firmrosenkranz, der
110
Fischessen, das
62
Fleglheng,
99
Flüssige Bestechung, die
76
Flurprozession, die
78
Fosnocht, die
46
Fosnochtumzug, der
51
Fotzhobl, der
118
Frais, die
59
Fraisbeter, der
59
Frauendreißiger, die
82/96
Frauentage, die
94
Frauentragen, das
89
Freinacht, die
28
Freitagsabstinenz, die
63
Freitagsläuten, das
79
Freynachtstanz, der
49
Frieslausschlag, der
107
Fronleichnam
88
Führpferd-gaul, der
124
Funkenfeuer, das
63
Gabenbringer, der
25
Gangerl geht um
26
Gaudiwägen, die
51
Gelbeutelwaschen, das
62
Geldkatze, die
62
Geldsack, der
36
Georgi
73
Glücksbringer, die
136
Glückssuppe, die
132
Goaßerer, der
58
Goaßlblodan, die
37
goaßln’
49
Goaßltog, der
49
Gschmalzner Samstag
67
gschussert
141
Gsottboden, der
118
Gstanzln, die
129
Gsteckerl, das
57
Gutwill, der
33
gutes Recht
55
Gvattersleute, die
133
Gvatteressen, das
135
Gutzerlfensterl, das
141
Gweichtn, das
44
Habergoaß, die
24
Halloween
102
Halm einsähen, die
123
Handgaul-roß, der
124
Harmonie, die
49
Haubenstäbe, die
78
Hausball, der
46
Hausgesinde, das
54
Hausnamen, die
30
Haus- Stalleinräuchern
43
Hausschutzbilder
139
Haussegnung, die
137
Hausweiber, die
28
Heiliger Abend
33
Heilige Drei Könige
41
Heilige Fürsprecher
101
Heiliges Grab, das
68
Heiliges Licht, das
39
Heilige Zeit, die
20
Heiligenschwörer, die
141
Heiratsaufschreiben, das
120
Heiratsmachen, das
119
Heiratsmacher, der
120
Hemadlenzn’, die
50
Herbergsuche, die
31
Herrentage, die
105
Herz-Maria-Bruderschaft
79
Hexe, die
34/74
Himmel, der (Baldachim)
78
Himmelsringschlüsslein, die
85
Hoagartn’, der
65
Hochfeste, die
18/94
Hochzeiteinsagen, das
122
Hochzeitsbräuche, die
122
Hochzeitsloder, der
122
Hochzeitsrosenkranz, der
124
Hochzeitsschuhe, die
124
Hochzeitsordnung, die
122
Hochzeitstanz, der
127
Hochzeitstüchlein, das
125
Hochzeits-Wallfahrt, die
132
Hochzeitswalzer, der
127
Hochzeitswerber, der
120
Hochzeitszug, der
125
Hofamo, der
Hoffahrt, die
135
Hoizbuttn, die
49
Holzscheitelklauben, das
29
Holzscheitelknien, das
123
Holz vor der Hüttn’, das
51
Hund tratzn’, den
30
Hungertuch, das
18/62
Hutzlbrot, das
26
Ibidum
74
Iden Tage, die
37
in den April schicken
73
in der Gnad sein
19
in der Klag sein
111
is hoam ganga
108
Irxnschmoiz, das
76
Johannes Minn, die
40
Johannissegen, der
40
Johannisfeuer, das
86
Josefi
65/73
Josefs-Bruderschaft, die
64
Juche-Fenster, das
88
junge Gmüas, das
49
Kälberrute, die
86
Kammerfensterln, das
119
Kammerwagen, der
124
Kappenabend, der
46
Karfreitag, der
68
Karfreitagsprozession, die
68
Karfreitagsratschn’, die
68
Karsamstag, der
69
Karwoche, die
65
Kaswoche, die
53
Kathrein
116
Katzenmusik, die
135
Kegelscheibn, das
79
Kerbenzäuner, der
85
Kerbn, die
98
Kerzenweihe, die
53
Kiacharln’, die
60
Kindbettschenken, das
135
Kinderalltag, der
140
Kindsmagd, die
141
Kindheit-Jesu-Fahne, die
79
Kindleinwiegen, das
133
Kirchenpatrozinium, das
14
Kirchgang, der
136
Kirchl. Haussammlung, die
61
Kirchweih, die
103
Kirchweihfest, das
103
Kirchweihtanz, der
104
Kirtagans, die
103
Klassenesel, der
71
Kletzenbrot, das
26
kloane Fretter, der
58
Kloasn, die
25
Kloasnbabet, die
25
Klöpferholz, das
16
Klöpflgehen, das
16
Klöpflsingen, das
16
Klosterarbeiten, die
138
Kopulation, die
120
Kranzabtanz, der
131
Kranzljungfrauen, die
127
Kranzlweihe, die
132
Kräuterbüschel, das
93
Kräuterweiberl, das
85
Kräuterweih-Sonntag, der
93
Kreuzauffindung, die
77
Kreuztroger, der
77
Krippenspiele, die
32
Kripperl, das
22
Krückei, das
37
Krüllschnitt, der
36
Kuppelpelz, der
120
Kuppler, der
119
Lader/Lodera, der
57/125
Lebensbaum, der
133
Leich, die
109
Leichenbitten, das
109
Leichenbitterin, die
109
Leichenschmaus, der
111
Lesehochzeit, die
132
letzte Spreis, die
107
Leviten aufsagen, die
25
Liabschaft, die
119
Licht des Herrn, das
34
Lichterweihe, die
53
Lichtmeß
53
Lichtmessmarkt, der
54
Lebensbäumchen, das
133
Liederlichkeit, die
135
Lorettoglöcklein, das
82
Lostage, die
28
Luzia
27
Luzienkreuz, das
28
Luziennacht, die
27
Luzienschein, der
27
Malefizmenschen, die
28
Mahlgänger, die
121
Mahlgeld, das
123
Maiandachten, die
77
Maibaum, der
75
Männerschutzen, das
52
Maria Himmelfahrt
94
Maria Lichtmeß
54
Marianische Kongregation
66
Marter, die
70
Martini
112
Martinslegende, die
113
Martinsminne, die
115
Martinspläzchen, die
115
Martinstag, der
113
Martinsumzüg, die
115
Martinswein, der
115
Maskenprämierung, die
47
Maß, die
81
Mechanikum, das
76
Mettn’, die
34
Mettensau, die
34
Mettnspeis, die
36
Mettnwürste, die
36
Ministrantensackln, das
39
Ministrantenprob, die
52
Mitbringsl, das
127
mit dem Kreuz gehen
78
Moarschaftn, die
81
Musterung, die
60
Muttertag, der
78
Nachbarschaftshilfe, die
100
Nachkirda, der
104
Nachtgespenst, das
37
Nachtmahr, der
37
Nachtwächter, der
118
Nadelgeld, das
120
Nagelbaum, der
137
Nagelschmied Tanz, der
118
Narrenaufträge, die
74
Narrentanz, der
126
Narretei, die
46
Neujahr
42
Neujahrseinsagen, das
42
Nikolaus, der
25
Niklausweiberl, das
25
Niklo, der
25
Oialaffa, das
71
obangslt
71
Oblitzta’, der
86
Obstaculum, das
121
Ochsenaugen, die
67
Ochserer Hans
27
Ohwandlte, der
81
Oia ohschlong
71
Oide, die
98
orakln’
140
Osterfest, das
71
Osterfeuer, das
69
Osterkerze, die
69
Osterweihe, die
70
Palmbüschel, die
66
Palmröschen, die
65
Palmsegen, der
66
Palmsonntag, der
65
Pantoffelwerfen, das
29
Papiererne, die
104
Paternoster, der
58
Patroziniumstag, der
14/103
Petri Stuhlfeier
61
Pfingsten
85
Pfingstbamerl, das
86
Pfingstmontag, der
86
Pfingstochs, der
86
Pfingstsonntag, der
86
Plätzchenbacken, das
32
Plumpf, der
123
Poimbliatn’, die
66
Pferdesegen, der
79
Poimesl, der
66
Prangertag, der
88
Predigthochzeit, die
132
Proklamation, die
121
Pschordtücherl, das
57
Ratschn’, das
68
Rauhnächte, die
41
Rausschmeißer Tanz, der
116
Rieb, der
78
Röckerlstricken, das
20
Rorateamt, das
19
Rosenkranzgebet, das
112
Rumtreiber, der
26
Rußiger Freitag, der
64
Sacklministrant, der
43
Sankt Barbara
22
Sankt Nebenanbeter, die
135
Scharwerksdienste, die
100
Saublodern, die
37
Schauerfreitag, der
74
Schauermesse, die
57
Sauschlachten, das
63/64
Schicksalsbefragung, die
29
Schiedum, die
108
Schlachtschüsssel, die
64
schlampige Verhältnis, das
121
Schlenkertag, der
55
Schlenkerweil, die
55
Schmu, der
120
Schmu(geld), das
120
Schmuser, der
119
Schnaderhüpfeal, das
139
schöne Stuben, die
139
schöne Rosszeug, das
124
Schuhknarrzn’, das
30
Schurzbinden, das
133
Schwaiberln, die
76
schwöche Hausprozn’, die
60
Sebastitag, der
49
Secherer, der
110
Seelendank, der
105
Seelenkerze, die
105
Seelenweckerl, die
106
Sieben Marterwerkzeuge, die
68
Siebener, die
57
Silvester
41
Singbrauch, der (Liedgut)
33
sitzen bleiben
118
so lernte man tanzen
118
Sommerkeller, der
81
Sonntagssuppe, die
131
Speisengitter, das
55
Speisnpfinsta, der
67
Speisglöcklein, das
107
Springerle, die
22
Stalleinräuchern, das
43
Stallsegen, der
138
Starkbierzeit, die
64
Steflstog, der
38
Steinsetzer, der
57
Sterbeglöcklein, das
108
Stimmakrobaten, die
83
Stolarien, die
57
Stolgebühren, die
122
Straußleg, die
132
Strohsacktreten, das
29
Scheyrer Kreuz, das
82
Tanz mit der Resi, der
51
Taufkappe, die
134
Techtlmechtl, das
122
Teufelsgeige, die
49
Thamerl, der
27
Theaterstücke, die
40
Thomasnacht, die
28
Tolentinbrot, das
26
Totenbrauch, der
108
Totermo, der
102
Trömpel, der
25
Truden, die
37
Truhenbeigabe, die
110
Übergeben, das
118
Überstandige, die
119
Übung zur heiligen
Nüchternheit, die
33
Unholden, die
36/74
Unseres Herrn Angst
läuten
19
Unsinniger Donnerstag
59
Unter die Haube kommen
120
Vastestmi, das
76
vastoins (heimlich)
26
Vatertagstouren, die
82
verbrannte Hand, die
128
Vereinsfeste, die
83
Vereinswapperl, das
76
Verkündigungssonntag
122
Versehgang, der
107
Vierzehn Nothelfer, die
83
Vierzigstündige Andacht
68
Vinzenstag, der
49
Vollerwerbslandwirt, der
57
Vorgemerkten, die
117
Vormerk, der
117
Wachsgießen, das
36
Wachsstöckerl, das
54/109
Waisat, das
134
Walburgisnacht, die
74
Wallburgisöl, das
105
Wallfahrten, die
96
Wandelkerze, die
82
Watschn’, oane kriagn
100
Wegmachen, das
101
Wehrkandidaten, die
60
Weiberfasching, der
47
Weiberfosnoat, die
47
Weichbrunnakessl, der
43
Weihnachten
38
Weihnachtskranz, der
31
Weihnachtsschießen
38
Weißer Sonntag, der
72
Wetterglöcklein, das
82
Wetterkerze, die
43/54
Wettersegen, der
79
Wiagngaul, der
60
Wichs, die
125
Wintersonnwendfeuer, das
115
Winterunholden, die
36
wuide Männa
47
Wunschzettel, der
26
Wunschzettelröllchen, das
31
Zachastog, der
103
Zaunspitzlzählen, das
29
Zehr, die
54
Ziachnausschlog, der
49
Ziehharmonikastiefel, die
56
zuaböllern
38
Zuchglockn’, die
108
Zugab, die
121
Zugehlaib, der
55
Zunftstangerl, das
76
(Bruderschaftsstäbe)
Zweites Gesicht, das
27
Zwetschgenschütteln, das
30
zwölf Nächte
27
„Fensterln’“ Ob das im altbayerischen Raum durchaus Übliche als Brauch einzuordnen ist, oder als Vorstufe zur Bevölkerungsentwicklung gewertet werden sollt bleibt der Fantasie des geneigten Lesers überlassen.
„Geh mach dei Fensterl auf,
I wart scho so lang drauf.
A oanzigs Bussarl möchte I nur,
vielleicht laß I di dann in Ruah.“
Die vielen Kirchen- und Heiligenfeste in der alten Zeit hatten nicht nur eine wichtige religiöse, sondern ganz besonders auch eine herausragende soziale Funktion. Das Wort und die Sache – Urlaub – waren den breiten unteren und mittleren Schichten der Landbevölkerung gänzlich unbekannt, oft noch bis tief in das 20. Jahrhundert hinein. Diese Aufgabe erfüllten neben den Sonntagen die Hochfeste im Kirchenjahr und die vielen Heiligenfeste, die als Feiertage begangen wurden. Dazu kamen noch die Apostel- und Frauentage (Marienfeste), das örtliche Kirchenpatrozinium, die Bruderschafts- und Wallfahrtsfeste. Selbstverständlich wurden auch die großen Kirchenfeste der Umgebung mit einbezogen. Diese Feiertage füllten weit über ein Drittel der Jahrestage aus, denn die großen Kirchenfeste feierte man gewöhnlich mehrere Tage, im Extremfall sogar eine ganze Woche lang. Das örtliche Kirchenpatrozinium beging man üblicherweise an zwei Tagen, wobei der Festtag mit der Frühmesse, mit großer Predigt, die selten weniger als eine Stunde dauerte, begann.
Bis Ende des 2. Weltkrieges sind hier bei uns, als fast ausschließlich katholischen Gemeinden, nur die Namenstage gefeiert worden. Eine Geburtstagsfeier war in den katholischen Gemeinden, außer an runden Ehrentagen, nicht üblich. Es war ein alter Brauch, dass alle Anderln, Hansl, Sepperl, Franzl usw. an ihrem Namenstag ins Wirtshaus gingen, sofern dieser Tag ein echter Feiertag war. Wenn dem nicht so war, so traf man sich am darauf folgenden Sonntag. Da saßen dann alle Männer, jung und alt (ab ca. 18 Jahren) ohne Unterschied von Alter, Rang und Namen, gerade so wie sie zur Türe hereinkamen nebeneinander am Biertisch und unterhielten sich. Weil die Jungen meist eng bei Kasse waren, spendierte der ältere Nachbar schon einmal ein Quartl (= 0,25 Liter) oder gar eine Halbe Bier und bei der Emmentalerbrotzeit durfte das junge Gmüas (Heranwachsende) auch herzhaft mit zugreifen. Jeder im Ort kannte und grüßte seinen Namensvetter, wenn er mit ihm auf der Straße zusammentraf. Wer aber weiß heutzutage an seinem Geburtstag, wer noch alles an demselben Kalendertag das Licht der Welt erblickt hat, um mit ihm gemeinsam zu feiern?
Meine Ausführungen beginnen nicht mit dem Kalenderjahr, sondern mit dem Patrozinium in der Heimatgemeinde. Dieser wichtigste Tag im Jahresablauf in den Dorfkirchen war das Kirchenpatrozinium.
Der Patroziniumstag ist ein großer Festtag im Kirchenjahr. Es ist das Fest des Schutzheiligen der Pfarrkirche. Jedes Dorf hat seinen eigen Kirchenpatron, und somit an einem anderen Tag seinen besonderen (eigenen) Festtag. Die ganze Verwandtschaft aus umliegenden Dörfern kam früher zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roßgig, um diesen festlichen Tag gemeinsam würdig zu begehen. Selbstverständlich begab man sich zur gegebenen Zeit zur gleichwertigen Festtagsfeier zur Verwandtschaft in den Nachbarort.
Andre - Andreastag – 30. November (Patrozinium), Hochfest der Pfarrkirche. Dazu gehörte das feierliche (nicht die levierte Messe - gelesene) Hochamt mit Sakramentenprozession und die feierliche Vesper bzw. Andacht am Nachmittag, die der Ehre des Titelheiligen zugedacht war. Die Teilnahme war für die gesamte Bevölkerung obligat Am nächsten Tag las der Pfarrer am Friedhof das Requiem mit Libera und nachfolgender Gräbersegnung. An diesen Hochfesten hörten auch die Geistlichen der Nachbargemeinden die Beichte ab. Etwa vier- bis fünfmal im Jahr: an Ostern, am Portiunkula-Sonntag (Ablasstag am ersten Sonntag im August), an Allerheiligen und an Weihnachten und am Neujahrstag gingen alle Gläubigen zur hl. Kommunion. Dergleichen auch an den Wallfahrts- und Bruderschaftsfesten. Kommunionempfang ohne vorhergehende Beichte war in jener Zeit eine seltene Ausnahme. Die Gläubigen freuten sich an der Schönheit des Kirchenfestes, und an der aufwendigen frommen Pracht zur Ehre Gottes, und der vielen hilfreichen Heiligen. Die Bauern haben an diesen Tagen nur das Hauswesen und das Vieh versorgt. Darüber hinaus wurde nicht gearbeitet.
Andreas Weissagung - Wie in den anderen Losnächten des ganzen Jahres über, so war die Andreasnacht eine offene Zeit für Weissagungen. Was man in dieser Nacht träumt, geht in Erfüllung. Eine Weissagung war für die heiratswilligen Mädchen das Buchstabenschreiben. Die Kandidatin schreibt an die Innenseite ihrer Kammertüre mit Kreide die 24 Buchstaben des Alphabets, und greift mit verbundenen Augen danach. Der Getroffene ist der Anfangsbuchstabe des Namens der künftigen Geliebten. Die in den Losnächten angewendeten Mittel sind zahllos und wiederholen sich zum großen Teil auch zu anderer Zeit und Gelegenheit. Die Obrigkeit und die Kirche verurteilte diese „schädliche Supersitiones“, aber ohne nachhaltigen Erfolg.
Der heilige Andreas gilt überhaupt als Heiratsvermittler. Zur Erklärung der Bedeutung des hl. Andreas für Ehe, Liebe und weibliche Fruchtbarkeit, findet sich nach Hanns Bächtold Stäubli keine kirchliche Aussage.
In früherer Zeit gab es das Andreaslos. Das Wort Los bezeichnet – Wahrsagen, Vorhersehen. Wenn ein Mädchen in der Andreasnacht rückwärts mit dem linken Fuß zuerst in das Bett stieg und dabei sagte:
„Heiliger Andreas, i bitt’,
wenn i mei Bett betritt,
dass mir erschein,
der Herzallerliebste mein.
Wie er geht und wie er steht,
und wia er mii zum Traualtar führt.“
Dann erschien bald darauf im Traum der erwünschte Mann.
Andreasreiser
Noch bevor das Schneiden von Barbarazweigen zum Brauch wurde gab es die Andreasreiser. Sie sollten Glück bringen, wenn sie am Andreasabend um sechs oder neun Uhr abends geschnitten wurden. Es mussten aber in einem Bund die Reiser von sieben Bäumen sein. Nämlich die vom Apfel-, Birnen-, Kirschen-, Pflaumen- und Holunderbaum sowie von einem Johannis- und einem Stachelbeerstrauch.
Ab diesem Festtag gab es das Klöpfergehen oder Klöpfersingen. Arme Leute gingen singend von Haus zu Haus und erhielten für ihren Gesang und die guten Wünsche etwas Geld oder Esswaren. Vermutlich haben sie dabei Adventslieder gesungen. Bis Weihnachten durften sie diese erlaubte Bettelei an drei Donnerstagen ausüben.
Die jungen Burschen im Dorf zogen von Hof zu Hof und forderten von den Hausbewohnern mit einem Spruch ein Stamperl Schnaps. Ihre nachdrückliche Forderung verstärkten sie mit dem so genannten Klöpferholz. Dieses bestand aus einem Haselnussstock, an dem sie mit dünnen Lederriemen Holzklötzchen befestigt hatten. Damit schlugen sie an die Fensterläden oder Haustüren.
Ein Reimspruch zum Klöpfatag hieß:
„Heint is Klöpfernacht,
wer hot de aufbracht?
Unser Herr Damer (Damian)
Rumpelt nei in ’d Kamma,
laaft d’ Stiagn naaf und ro.
Wer muaß biaßn’?
D’ Hauserin mit’m Stückal Broat.“
„As’ Feia heart ma kracha,
Kiachal wern bacha,
d’ Schissln heat ma klinga,
d’ Moila heart ma singa,
Kiachal werns uns bringa.
Teats Kiachaln naus, tuats Kiachal naus,
oda mia schlong enk aa drum Loch ins Haus!“
Wer muaß dannat biassn’?
d’ Hauserin mit’m Kiachalspitz. “
„Draus, in’n Tenna,
doa laffa de fättn’Henna.
Drom im Firscht hengan de gesölchtn’ Würscht.
Gebts uns de längan,
lasst’s de kurz’n henga.
D’ Schüssl heat ma scho klinga,
Würscht deans uns bringa.“
oder:
„Heint is die erste Klöpfanacht,
Kiachaln werns uns bringa.
Des wird da Bua scho wissen’.
Deats Kiachaln naus, deats Kiachaln naus,
und wenn d’Bäurin koane Kiachaln bacht,
na wird’s dem Baua vadriaßn’.
Der Baua is schö, die Bäurin is schö,
drei Roasn, drei Roasn
de wachs’n aufm Stengl,
de Kinda san wia Engl. “
der Baua is schee, dee Bäurin is schee,
de Kinda san wia Engl. “
oder:
„Wir klopfa oh, klopfa oh,
kummts raus Hauserin und Mo,
bringts uns an Schnaps oda an Wein,
oda mia tretn’ enk an Türspiagl ei!”
Kummts raus Hauserin und Mo,
bringts uns an Schnaps oder Wein,