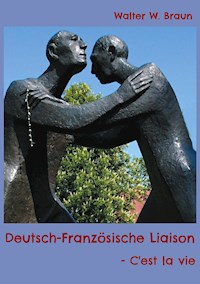Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Glauben ist ein Kompass im Leben und das nicht nur im religiösen Kontext. Nach der Flucht aus dem Elsass, Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde der Autor 1945 als Kind in der Neuapostolischen Kirche getauft und versiegelt. Die Geleitworte zur Konfirmation und zur Hochzeit verwiesen auf Wege, womit sowohl der Lebens- als auch der Glaubensweg zu sehen ist. Sein Leben verlief im Spannungsfeld der "Botschaft" von J.G.Bischoff und von Hans Urwyler geprägter "Eigenverantwortung" Schon als Jugendlicher war er innerhalb der Kirche aktiv und blieb das über 40 Jahre in unterschiedlichen Ämtern. Dabei erlebte die Sonnen- als auch die Schattenseiten hautnah, ohne sich von dem einen oder anderen beirren zu lassen, nach der Devise: "Schauet ins Licht und nicht in die Finsternis". Neben der Erfüllung im Glauben fand er wohl manche Merkwürdigkeiten - bedingt durch menschliche Eigenheiten und persönliche Befindlichkeiten. Sie waren wie Steine auf dem Weg, wurden aber nie zum Hindernis. Dagegen waren glaubensstarke, aufopfernd wirkende Persönlichkeiten prägend, die sich nie abgehoben gaben, die aufrichtig und ehrlich Vorbilder im Glauben wurden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Ein schlechtes Gewissen
2 Eintritt in die Neuapostolische Kirche
3 Die Neuapostolische Kirche entwickelt sich rasant
4 Regelmäßige Kirchenbesuche
5 Neue geistige Heimat in der Kirche
6 Ein Mann mit weltmännischem Format
7 Wissen ist Macht
8 Gottesdienste bei uns zu Hause
9 Gebietsveränderungen in der Kirche
10 Kirchenneubau in Offenburg
11 Umzug in eine bessere Wohnung
12 Gottesdienste auch in Zell
13 Konfirmation in Nordrach
14 Lehre in Biberach
15 Ungeeigneter Sänger im Kirchenchor
16 Stammapostel J. G. Bischoff ist gestorben
17 Ende der Lehrzeit
18 Der erste Amtsauftrag
19 Ein „mea culpa“ war fällig
20 Wehrdienst bei der Marine
21 Hochzeit am Freitag, den 13.
22 Weitere Beauftragungen
23 Vielfältige Aufgaben als Priester
24 Engagierter Einsatz als Priester
25 Umzug nach Offenburg
26 Verlagerung der kirchlichen Arbeit nach Zell
27 Die Gemeinde Zell wird selbständig
28 Höhepunkte in der Gemeinde und zu Hause
29 Dunkle Wolken ziehen auf
30 Neue berufliche Aufgaben
31 Strafrechtliche Konsequenzen
32 Ein neuer Zeitabschnitt beginnt
33 Die Gemeinde Bühl unter neuer Leitung
34 Vielfältige Aufgaben in der Seelsorge
35 Das Blatt wendet sich
36 Die Gemeinde Bühl feiert ein Jubiläum
37 Schuld war der Nikolaus
38 Es brodelt unter der Decke
39 In Lichtenau ist der Himmel blau
40 75 Jahre Gemeinde Lichtenau
41 Veränderungen stehen an
42 Leben im Unruhestand
43 Wie geht es weiter?
Anhang 1 Biblischer Schöpfungsbericht – Gedanken zu Adam und Eva
Anhang 2 Herz und Gesinnung
Anhang 3 Ewiges Leben
Anhang 4 Moses und das Volk Israel - 40 Jahre Wüstenwanderung
Anhang 5 Gedanken zur künftigen, zielgerichteten Gästearbeit
Anhang 6 Die Gedanken als schnellste Informationswege
Anhang 7 Stellungnahme zu einem Leserbrief im Internetforum „mediasinres“
Anhang 8 Stellungnahme zu einem Leserbrief zum „Uster-Abend“ im Internet in „mediasinres“
Anhang 9 Korrespondenz mit einem Website-Betreiber
Epilog
Vorwort
Die Wege des Lebens sind außerordentlich vielfältig, manchmal geheimnisvoll und nicht immer kalkulierbar und vorausschauend, sie sind wie verschlungene Pfade in den Bergen, gehen mal steil aufwärts und dann wieder beängstigend abfallend bergab talwärts. Zwischendurch verlaufen sie im Zickzack der Serpentinen, führen stückweise über ausgesetzte, schmale Felsengrate oder unangenehm durch dichtes Gestrüpp. Die Erfahrungen lehren uns, sie verlaufen nie einfach nur bequem von A nach B, und es ist schon gar nicht immer sofort erkennbar, wohin sie führen wollen, welcher Weg gewählt werden sollte, um ohne Umwege ans gewünschte Ziel zu gelangen. Betrachten wir aber einmal die Wegverläufe nicht nur horizontal, sondern in der Vertikalen. Vor Jahren hatte ich die Gelegenheit, mit einem Heißluftballon zu fahren und hier staunt der Laie über die da einwirkenden physikalischen Gesetze. Sind es auch nur einige Quadratmeter Stoff, feste Seile und ein tragfähiger Korb, doch durch die mit der Gasflamme erhitzte Luft füllt den Ballon, er stellt sich auf, beginnt zu steigen und gewinnt mit Leichtigkeit immer mehr an Höhe. Von oben ist es dem staunenden Betrachter möglich, in Areale zu sehen und Bereiche zu überblicken, die dem Auge vom Boden aus durch Mauern oder andere Hindernisse verdeckt sind.
Der Heilige Geiste wird nach dem Wort der Bibel als Flamme gekennzeichnet und in Bildern dargestellt. Wer die tragenden und inspirierenden Kräfte des Heiligen Geistes in sein Leben einbezieht, wird geistig emporgehoben und sieht viele Dinge aus einer anderen Perspektive, schwebt sozusagen über den Beschwernissen des Alltags. Der Heilige Geist kann dem gläubigen Menschen ein Tröster sein und ein Beistand in allen Lebenslagen. Sind die Last und Bürde des Lebens nun des Menschen Bestimmung oder einfach ein unabänderliches Schicksal? Jeder erwachsene Mensch hat primär das Recht, sein Leben gemäß seinen eigenen Vorstellungen gestalten zu dürfen, sei es als Christ oder überzeugter Atheist. Wie immer er sich aber entscheidet, es sollte konsequent und ehrlich sein. Zudem darf und muss eine Entscheidung auch einmal korrigiert werden können, wenn neue Erkenntnisse das erforderlich machen.
Gott wusste von Anfang an, wie sich das erste Menschenpaar zu seinem Gebot entscheiden würde und hat ihnen trotzdem die Wahl gelassen, sich frei zu entscheiden. Für ihre Entscheidung hatten sie dann auch die Konsequenz zu tragen, sie mussten das Paradies verlassen. Aber auch da hatte Gott schon den Plan in der Erlösung durch seinen Sohn eingeleitet. Wieder werden sich bis zum Ende der Erlösungsgeschichte alle Menschen, die einmal auf dieser Erde gelebt haben, für oder gegen ihn entscheiden müssen, um danach in der Gott-Nähe oder Gott-Ferne die Ewigkeit zu verbringen.
Ohne Frage war es für mich einfacher, meinen Lebensweg im Glauben innerhalb der Neuapostolischen Kirche zu gehen. Glauben wird – bewusst oder unbewusst – überall und zeitlebens gefordert. Wenn wir uns ernsthaft Gedanken über Gott und die Welt machen, stellen wir zwangsläufig fest: „Wir wissen viel zu wenig – im Grund nichts – und müssen manche Dinge einfach glauben.“ Wie könnten wir ohne Glauben an die eigenen Kräfte den tausendfach gehörten Grundsatz leben: „Du kannst im Leben alles erreichen, wenn du es nur willst und unerschütterlich daran glaubst“? Oder Jesus sagte es so: „Alles ist möglich dem, der da glaubt“ (Markus 9, 23). Viele vertrauten auf diese Grundsätze und stellten fest, es funktioniert. Sie hatten Erfolg, erreichten mit eisernem Willen und festem Glauben an sich ein hohes Ziel. Verborgene Kräfte konnten sich entfalten und so wurden plötzlich Kranke auf unerklärliche Weise wieder gesund? Sie wurden es, weil sie felsenfest daran geglaubt hatten; dem viel gepriesenen Placebo-Effekt sei Dank, oder war es ein Wunder?
Die Kreiszahl Pi (π), auch bezeichnet als Ludolphsche Zahl oder Archimedes-Konstante, ist eine reelle mathematische Konstante und für viele Berechnungen, wie den Umfang und Kreis wichtig. 1) So wie Pi eine mathematische Größe ist, mit nach dem Komma unendlich viele Stellen, kann der Glaube ein Konstante im Leben sein, um das sich alles dreht, alles unterordnet.
Während meiner Sanitätsausbildung in der Bundeswehr lernte ich spannende Zusammenhänge über das vegetative Nervensystem des menschlichen Organismus kennen, das nicht bewusst steuerbar ist. So nehmen der Sympathikus und der Parasympathikus, die sich als Gegenspieler verstehen, auf körperliche Vorgänge Einfluss und steuern lebenswichtige Vorgänge. Der Idealzustand ist dann erreicht, wenn beide in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander wirken, wenn ein inneres Gleichgewicht besteht. Näher betrachtet ist der „Homo sapiens“ ein überaus kompliziertes, komplexes Wesen und den vielfältigsten Stimmungen unterworfen. Wir können uns schon morgens darin beeinflussen, dass der Tag entweder freudig optimistisch beginnt und wir positiv in den Tag starten oder missmutig aus dem Bett steigen – sozusagen mit dem linken Fuß aufstehen – und der Tag ist versaut. Wer will solche Phänomene rational erklären?
Wer kennt nicht in seinem Umfeld den geborenen Pessimisten und andererseits die lebensbejahenden Optimisten? Fraglos tut sich ein Optimist im Leben viel leichter, gleich in welcher Lebenslage er sich aktuell befindet. Kurzum, im Leben kann jedem der Glaube an Gott eine wertvolle Hilfe, eine Stütze sein. Glauben gibt in beschwerlichen Lebenslagen Halt, die Kräfte aus dem Gebet – der inneren Zwiesprache mit Gott – und einer Predigt, oder einem Gespräch mit dem Seelsorger seines Vertrauens können Sicherheiten vermitteln und Orientierung geben. Die Verbindung zu Gott lässt Hoffnung schöpfen und bewahrt uns die Bodenhaftung zu behalten. Hilfreich ist, wenn man sich bewusst macht: „Ich bin nur ein winziges Teilchen in einer unermesslichen grandiosen Schöpfung.“ Das macht demütig und hilft zudem die Schöpfung gut zu bewahren.
Einstein formulierte es so: „...an der Grenze des Wissens beginnt der Glaube.“ 2) Ein anderer Wissenschaftler sagte: „Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht aus, sondern ergänzen und bedingen sich einander.“ 3)
Mein Weg in der Neuapostolischen Kirche verlief in wesentlichen Phasen im Spannungsfeld zwischen der „Botschaft“ von Stammapostel J. G. Bischoff und der Fokussierung auf die persönliche Eigenverantwortung, wie sie 1986 Stammapostel Hans Urwyler als neue Ausrichtung für die Kirchenmitglieder artikuliert hat. Dabei bin ich mir bewusst, die Institution Kirche – gleich welcher Konfession – ist nur der Rahmen. Entscheidend und Maßstab ist allein das Evangelium Jesu Christi. Die Kirche wurde und wird von Menschen geleitet und der Mensch an sich unterliegt Irrtümern. Die handelnde Person dient einzig zum Zweck in der Sache. Solange man es mit Menschen zu tun hat, wird es keine absolute Vollkommenheit geben, keine geben können. Schon Apostel Paulus klagte über sich: „Das Gute, das ich tun wollte, tat ich nicht, das, was ich nicht tun wollte, das tat ich.“ Früher hatte die Neuapostolische Kirche, wie andere Kirchen ihrerseits auch, das Alleinstellungsmerkmal als Kirche zum Heil betont. Das hat sich geändert: „Von der Einheit der Christen in der Vielseitigkeit“, bis hin zur offiziellen Verlautbarung der NAK: „Die Tatsache, dass wir von unserer Glaubenslehre überzeugt sind, hindert uns nicht, sowohl den geistlichen Reichtum anderer Kirchen wie auch die Verdienste ihrer Mitglieder anzuerkennen.“
Mit Bedauern muss man heute feststellen, dass sich immer mehr Menschen von den Kirchen und von Gott abwenden. Sie schaffen sich stattdessen – vielleicht unbewusst – Ersatzgötter in Materialismus, Egoismus, dubioser Esoterik und narzisstische Selbstverwirklichung. Das Streben nach Erfolg, Anerkennung und der Umsetzung eigener Träume, lässt im Leben keinen Raum mehr für einen Gott. Und es stören sich viele an Äußerlichkeiten, an menschlichen Unzulänglichkeiten innerhalb der Institution Kirche, deshalb wenden sie ihr enttäuscht den Rücken zu. Da ist die Neuapostolische Kirche nicht ausgenommen. Doch wer geht, hat keinen Einfluss mehr auf eine Veränderung zum Guten oder die Möglichkeit, es besser zu gestalten. Natürlich ist es leichter, enttäuscht das Schiff zu verlassen, anstatt sich mit aller Kraft in die Riemen zu legen, sich einzubringen, mühsam an Verbesserungen zu arbeiten. Nirgends ist der Begriff „Dickbrettbohrer“ angebrachter als in diesem Zusammenhang. Der Schlüssel zum Erfolg ist: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Niemand sollte Vollkommenheit erwarten, aber jeder darf auf die Gnade Gottes hoffen und vertrauen. Gerne zitiere ich den Hohepriester Gamaliel. Er mahnte im Kreise der Pharisäer (sinngemäß, im Blick auf die rasant wachsende Sekte der Christen): „Ist sie von Gott, dann könnt ihr sie nicht aufhalten, ist sie von Menschen, wird sie untergehen.“ Wer gottgläubig ist, sollte darauf vertrauen: Der Allmächtige steuert und lenkt alles. Zeigen sich Entwicklungen, die in die falsche Richtung gehen, kommt sicher der Tag, wo ER korrigierend eingreifen wird. In diesem Kontext sehe ich in Martin Luther ein prägnantes Beispiel. Man sollte sich also nicht so sehr an den Äußerlichkeiten oder an menschlichen Schwächen reiben und aufhalten, sondern mehr auf den Kern achten, das ist das angestrebte Heil der Seele, das Evangelium Jesu Christi, und im Mittelpunkt steht seine Verheißung: „Ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr da seid, wo ich bin.“ 4)
Das ist einer von drei Zentralpunkten der Neuapostolischen Glaubenslehre:
1. Sendungsauftrag Jesu Christi an die Apostel: „So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi Statt: Lasset euch versöhnen mit Gott. 5)
2. Die Erlösung und Vermittlung von Heil an unsterblichen Seelen ist nicht auf das zeitlich begrenzte Leben beschränkt, es schließt das Jenseits – die geistige Welt – mit ein, ist somit umfassend für die unsterbliche Seele.
3. Die Wiederkunft Christi in der „Ersten Auferstehung“ und Heimholung der Brautgemeinde.
Mit diesem Ereignis endet der Sendungsauftrag an die Apostel. Jesus Christus selbst wirkt danach im „Tausendjährigen Friedensreich“, unterstützt durch die Könige und Priester, mit dem Ziel, jedem Menschen – den Lebenden und den Toten – Heil anzubieten. Gott ist kein rächender, sondern ein liebender Gott, und sein Wille ist, so hat es Jesus Christus unmissverständlich vermittelt, dass allen Menschen Heil angeboten wird, egal in welchen Zeiten sie gelebt haben. Damit bietet er – so wie er es von Anfang an wollte – eine ewige Gemeinschaft mit ihm und in seinem Reich an. Gott hat den Menschen als „Krone der Schöpfung“ geschaffen, weil er mit ihm die Ewigkeit teilen und von ihm geliebt werden will.
Ein entscheidender Aspekt in diesem Zusammenhang ist die zielgerichtete Vorbereitung auf das Leben nach dem körperlichen Tode. Wenn hier sich auch die Geister scheiden, zeigen doch zahlreiche wissenschaftliche Studien: Die Persönlichkeit, das Bewusstsein bleibt dem Menschen nach dem Tode erhalten. Dabei sollte jeder bedenken: Es gibt nichts in dieser Schöpfung, was dauerhaft verloren geht. Energie ist nicht zerstörbar, sie bleibt bestehen, wenn auch in veränderter Form. Warum sollte also ausgerechnet das höchstentwickelte Gut, der menschliche Geist sein, der für immer ins Nirwana verschwindet?
In diesem Kontext gewinnt das Sinn, was einst Stammapostel Johann Gottfried Bischoff so formuliert hat: „Lerne im Leben unterlassen, was du im Jenseits nicht vorsetzen kannst.“ Der stoffliche Leib vergeht, Geist und Seele bleiben, und nach meiner Glaubensüberzeugung damit auch alle im Leben gesammelten Erfahrungen, Wünsche und Sehnsüchte. In diesem Kontext ist es gut vorstellbar, wie bisher gepflegte Süchte nach dem körperlichen Tod immer noch Sehnsüchte wecken, die befriedigt werden wollen, deren Mangel nun aber seelische Qualen verursachen? Vielleicht hatte die katholische Kirche aus dieser Sichtweise den Begriff „Fegefeuer“ geprägt.
Dazu äußerte sich Jesus Christus unmissverständlich: „Jeder kommt in den Bereich seinesgleichen“. Der Geist bleibt, und damit auch das Verlangen, das von ihm ausgeht. Und hinter jeder Idee steht zudem ohne Zweifel ein Geist, sei er gut oder böse. So wie ich es sehe und verstehe, wirkt der Glaube in zwei Bereiche hinein. Einmal kann er ein helfender Begleiter im Alltag sein, der mit Gottvertrauen, Liebe zum Nächsten und zu sich selbst, ein wenig leichter und sinnerfüllter sein kann. Und andererseits im Hinblick auf das Leben danach, in der uns unbegreiflichen geistigen Welt, das wir Jenseits nennen. Dafür gilt es in diesem Leben frühzeitig die Weichen richtigzustellen.
Sowohl zur Konfirmation als auch zur Hochzeit erhielt ich ein Bibelwort als Geleit, das in die gleiche Richtung weist. Das habe ich nie als Zufall empfunden, sondern darin einen Fingerzeig Gottes für meinen künftigen Lebensweg und meine Lebenseinstellung gesehen.
Wort zur Konfirmation:Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Psalm 86.11
Wort zur Hochzeit:Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn; er wird's wohl machen Psalm 37.5
1 ) https://de.wikipedia.org/wiki/Kreiszahl
2 ) Albert Einstein, 14.03.1879 - 18.04.1955, deutscher Physiker, Nobelpreisträger, Physik1921
3 ) Max Planck, 1858-1947, deutscher Physiker
4 ) Johannes 14:3 (Lutherbibel 1912)
5 ) 2.Korinther 5:20 (Lutherbibel 1912
1
Ein schlechtes Gewissen
Das idyllische 2000-Seelen-Dorf Nordrach liegt in einem Nebental der Kinzig im Mittleren Schwarzwald, weitab aller bedeutenden Verkehrswege. Die Gemeinde zieht sich über nahezu 10 km Länge im engen Tal des gleichnamigen Flüsschens entlang. In der Dorfmitte ragt weithin sichtbar der markante Turm der im neugotischen Stil erbauten katholischen Kirche St. Ulrich empor. Rund um die Kirche und zum Friedhof in der Nachbarschaft gab es einst große Freiflächen, ideal für uns Buben zum Bolzen (Fußball spielen) und anderem Freizeitvergnügen. Bei den jährlich im Dorf stattfindenden traditionellen Feste wie die Kilwi (Kirmes-Kirchweihfest), stand auf der nordwestlichen Seite der Kirche ein großes Festzelt und in dessen Umfeld boten ein Kettenkarussell und ein Autoskooter dem vergnügungssüchtigen Publikum Nervenkitzel und Spaß, da waren Schießbuden, Luftballonverkäufer und mehr, die uns anlockten. Das zog uns Buben magisch an, da waren wir mittendrin, wenn die karge Freizeit das zuließ. Stände mit Lebkuchenherzen und gebrannte Mandeln verströmten einen unwiderstehlichen Duft, die Losverkäufer versprachen verlockende Gewinne. Schreiende Händler priesen den Kindern heißbegehrte, bunte Luftballons an langen Schnüren an und dutzende Stände boten eine bunte Vielfalt für den Haushalt, die Begehrlichkeiten bei den aus nah und fern angereisten Bäuerinnen weckten.
Mit sechs Jahren war es endlich so weit, die Schule begann und ich wurde Erstklässler in der Volksschule im Dorf. Das mehrstöckige Schulgebäude war nur einen Steinwurf vom Kirchplatz entfernt. Nach Schulende jagte ich an einem sonnigen Nachmittag, wie so oft zuvor, mit ein paar Schulkameraden über den Kirchplatz. Dort spielten wir „fangis“, einer war Jäger und musste einen von uns fangen, während wir in alle Richtungen davonstoben. Schon als Kind war ich wieselflink, da gelang es selten, mich einmal einzufangen. Während einer kurzen Verschnaufpause sahen wir eine alte Frau mühsam mit einem klapprigen Fahrrad von Zell her die Dorfstraße talaufwärts kommen. Wobei „alte Frau“ relativ zu sehen ist, denn für mich als Kind waren alle Frauen jenseits der dreißig Omas. Die Straße verläuft von der Dorfmitte in Richtung Hintertal leicht ansteigend, die Frau musste deshalb kräftig in die Pedalen treten und quälte sich ein wenig mit ihrem Uralt-Fahrrad mit auffallend hochgestelltem Lenker, ähnlich denen, die heute als „Alt-Holland-Lenker“ bekannt und hierzulande nicht mehr so gebräuchlich sind.
Die unbekannte Person lenkte uns kurzzeitig vom Rennen und Toben ab und wir amüsierten uns köstlich über das ungewöhnliche Vehikel. Spottend rannten wir hundert Meter hinterher, so wie es eben freche Lausbuben im kindlichen Übermut manchmal unüberlegt tun. Doch schon bald hatten wir die Lust verloren, wir trollten zurück zum Platz und gingen wieder unserem gewohnten Spiel nach.
Zwei Stunden später musste ich nach Hause. Wir wohnten damals etwa einen Kilometer vom Kirchplatz entfernt in einem alten Gebäude, direkt an der Dorfstraße ins Hintertal. Rückseitig des aus drei Häusern bestehenden Ensemble stieg der Hang teils felsig, teils bewaldet steil auf, die Häuser schienen am Hang zu kleben oder in den Fels hinein gebaut zu sein. Dieser Straßenabschnitt hieß „Am Schrofen“, was die Lage trifft, denn Schrofen steht für steile und felsige Hänge. Vom Dorfplatz nach Hause brauchte ich höchstens eine Viertelstunde. Angekommen, bin ich im alten Gebäude schnell die schmale Holzstiege nach oben gestürmt und betrat polternd die dunkle Wohnstube. Und wen sah ich da sitzen?, die „alte Frau“ mit der Mutter am Wohnzimmertisch. Ein gehöriger Schrecken ist mir in die Glieder gefahren, ich wurde schamrot und mein schlechtes Gewissen regte sich, mein ungutes Verhalten mit den Spielkameraden war mir jetzt sehr peinlich. Ob sie mich wiedererkannt hat oder etwas zu meinem Benehmen erwähnt hat, weiß ich nicht mehr. Später war sie mir jedenfalls nie böse, die Sache kam nie auf den Tisch und ich bekam auch nie Vorhaltungen gemacht. Im Gegenteil, Tante Schaumburg – wie wir sie nannten – war mir sehr wohlgesonnen. Wir blieben befreundet, bis sie starb, und da war sie weit über 80 Jahre und somit wirklich „alt“.
2
Eintritt in die Neuapostolische Kirche
Der überraschende Besuch von „Tante Schaumburg“ hatte eine Vorgeschichte. Etwa fünf Jahre zuvor, im November 1945 hat Bezirksapostel Karl Hartmann meine Mutter und mich in Schopfheim in der Neuapostolischen Kirche versiegelt. Ein Jahr zuvor hatte sie mit mir und weiteren Angehörigen spektakulär das Elsass verlassen müssen, wo ich 14 Tage zuvor auf die Welt gekommen war. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges lebten meine Mutter und ich danach in den kleinen Ortschaften Bürchau und Holl im „Kleinen Wiesental“ am Fuße des mächtigen Belchens im Südschwarzwald. Dort war zuvor schon die ursprüngliche Heimat der Verwandtschaft mütterlicherseits, dort sind meine Großeltern, Tanten und ein Onkel, nach der Flucht und wochenlangen Internierung in der Schweiz auch alle wieder untergekommen. Im kleinen Weiler Holl kümmerten sich Tante Frieda und Onkel Max fürsorglich und hilfsbereit um meine Mutter und ihr Kleinkind. Sie waren Geschwister des Großvaters und bewirtschafteten zeitlebens den Binoth-Hof, ein kleines landwirtschaftliches Anwesen im engen Tal.
Der Binoth-Hof in Holl (Kleines Wiesental)
Mein Großvater Rudolf Binoth war Ende der 1930er Jahre samt kinderreicher Familie ins nahe Elsass gegangen, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen. Vorausgegangen war ein verlockendes Angebot des Nazi-Regimes, das den deutschen Bauernsöhnen, die keinen Hof erben konnten, verlassene Höfe im Elsass zur Bewirtschaftung überließ. Die ursprünglichen Besitzer waren vertrieben worden, sind in den Süden oder Westen Frankreichs ausgewichen oder man hatte sie verhaftet, nachdem das Elsass wieder unter deutscher Verwaltung stand. Fünf Jahre später eroberte die französische Armee das Elsass zurück. Jetzt wurden die neuen Hofbesitzer vertrieben oder inhaftiert. Meine Geburt kam, wie man mir später sagte, vierzehn Tage früher als berechnet. Durch diese göttliche Fügung war es der Mutter möglich, mit mir als Kleinkind und mit ihren Angehörigen von Hesingen (franz.: Hésingue) im Sundgau, über die nahe Grenze nach Basel zu flüchten und sich dort in Sicherheit zu bringen. Sie erreichten gerade noch rechtzeitig erreichten das nur wenige Kilometer entfernte Schweizer Territorium. Die Schweiz galt als neutral, dort wähnten sie sich vor den über die Vogesen und durch die Burgundische Pforte heranrückenden nordafrikanischen Soldaten der französischen Armee sicher, denn deren Vorhut war in der Bevölkerung wegen der ihnen zugeschriebenen grausamen Gräueltaten gefürchtet und gehasst.
Nach dem Grenzübertritt der Geflüchteten wurde die einzige Brücke gesprengt. Das war also Rettung in letzter Minute. In der Schweiz waren wir, wie alle die es irgendwie über die Grenze geschafft hatten, überhaupt nicht willkommen. Die Frauen wurden letztlich nur geduldet, weil ein Kleinstkind dabei war. Erst nach sechs Wochen Internierung durften sie schließlich von Basel auf die deutsche Seite wechseln und in die ursprüngliche alte Heimat weiterziehen, dem nicht weit entfernten „Kleinen Wiesental“.
Den Großvater hatte das Militär inzwischen arrestiert. Er hatte nicht mit den Frauen fliehen können, denn im Stall stand sein Vieh und auch anderes musste versorgt werden. Er war nie Nazi und sich auch keiner Schuld bewusst, aufgrund dessen er sich hätte in Sicherheit bringen müssen. Die Einkerkerung dauerte allerdings nicht sehr lange, dann kam er mit mehr Glück als Verstand und unter besonderen Umständen wieder frei, was einem Wunder gleichkam (siehe mein Buch: „Leben ist Glück genug“). Bei der Flucht hatten die Frauen nichts von ihrer Habe mitnehmen können, und weder meine Mutter noch die Großeltern verfügten vorerst über ein Einkommen. Sie besaßen kaum das Nötigste zum Leben und waren dringend auf die Unterstützung durch die Verwandtschaft angewiesen. Die Rückkehrer besaßen nichts mehr, aber alle halfen sich in jenen Tagen, jeder war für den anderen da, und so ließ sich auch diese schwere Zeit irgendwie und in Würde überstehen.
Tante Frieda war eine tiefgläubige Frau und ging schon länger in die Gottesdienste der Neuapostolischen Kirche im nahen Schopfheim. Die Eltern der Mutter und die übrige Verwandtschaft der Großeltern, auch der mit Tante Frieda im Haus wohnende Onkel Max, hatten dagegen mit Kirche nichts im Sinn. Öfters spotteten sie ein wenig über die religiös-spinnige Tante. Um ihr den weiten Weg nach Schopfheim zu ersparen, waren später und bis zu ihrem Tod in den 1960er Jahren, vierzehntäglich am Sonntagabend Gottesdienste in der dunklen Stube des großen Bauernhofes. Onkel Max war zeitlebens nie dabei, wenngleich er dies geduldet hatte oder gegen den Willen seiner Schwester nicht ankam. Der Großvater Rudolf Binoth blieb auch bis ans Ende seiner Tage ein überzeugter Atheist. Später wurde er ohne die üblich religiösen Rituale beerdigt, so hatte er es zuvor bestimmt und es sich gewünscht. Ob es feierlich war, darüber konnte man geteilter Meinung sein, das war für mich auch nicht so wichtig, denn ich konnte unabhängig vom äußeren Rahmen für ihn beten. Wenn die Großmutter in meinen Kindertagen hin und wieder über Wochen bei uns in Nordrach weilte, ging sie gerne mit in die Gottesdienste, auch nach Zell. Die gläubige Frau fühlte sich in der Kirche wohl und seelisch angesprochen. Sicher wäre sie irgendwann neuapostolisch geworden, wenn sie nicht den Zorn ihres Mannes gefürchtet hätte. So verzichtet sie wahrscheinlich um des lieben Friedens willen darauf. Es ist zu hoffen, und das kann ich mir gut vorstellen, dass ihr in der geistigen Welt eine Möglichkeit zum Heil eröffnet wurde; war wirklich eine bescheidene, gottesfürchtige und liebenswerte Frau.
Doch noch einmal zurück zu Tante Frieda. Sie nahm sich in diesen für meine Mutter schweren Tagen ihrer Nichte fürsorglich an und kümmerte sich um uns beide. Zudem nahm sie uns in die Gottesdienste nach Schopfheim mit. Dorthin waren es rund 15 Kilometer und in der Nachkriegszeit fuhren kaum öffentliche Verkehrsmittel. Die Frauen hatten dafür auch nicht das Geld, aber die Tante besaß ein altes Fahrrad. Mit drei Personen auf dem Fahrrad ging nicht gut, doch sie arrangierten sich anderweitig und behalfen sich pragmatisch. Die Tante fuhr die eine Strecke mit dem Fahrrad, während meine Mutter zu Fuß lief und den Kinderwagen schob. Auf dem Rückweg wurde gewechselt und man machte es nun umgekehrt. So mussten sie nur eine Wegstrecke zu Fuß gehen.
Der Vater war Soldat bei der Wehrmacht im Elsass, Mitte 1944 geriet er aber bei einem Unfall unter die Räder, erlitt bei einem Verkehrsunfall schwerste Verletzungen, wobei nie geklärt werden konnte, war es Sabotage oder einfach nur Fahrerflucht des Schuldigen. Zuerst lag er über Wochen im Koma und hinterher folgten zwei Jahre in Behandlungen im Lazarett und psychiatrischen Einrichtungen. Die Mutter war deshalb mit mir auf sich allein gestellt und musste zusehen, wie sie zurechtkam. Das schreckliche Unglück hatte außerdem die geplante Heirat verhindert und somit hatte meine Mutter auch keinen Versorgungsanspruch. Möglicherweise bekam sie nicht einmal Geld, weil der Vater nicht in der Lage war, vom Sold ihr einen Teil zukommen zu lassen. Da war sie mit mir wohl oder übel auf die Hilfe ihrer Eltern und Verwandtschaft angewiesen. Ich denke aber, durch ihre Mitarbeit auf dem Binoth-Hof in der Holl waren Kost und Logis abgegolten.
Erst in einer günstigen Phase während des langwierigen Heilungsprozesses konnten die Eltern im April 1945 in Bürchau heiraten und gleichzeitig wurde ich als eheliches Kind legitimiert. Einen Monat später war dann auch der unsägliche Krieg beendet und die Hoffnung keimte auf, dass nun alles endlich besser würde.
Die herzliche Gemeinschaft in der Kirche, der seelische Zuspruch und die Zukunftsverheißungen, taten der Mutter seelisch gut. Hier fühlte sie sich angesprochen, dort fand sie eine geistige Heimat. Bald fasste sie den Entschluss und wollte dazugehören und aufgenommen werden. Tags zuvor wurde ich in einer Hausandacht in der Wohnung meiner Tante getauft und anderntags wurde die Mutter und ich in Schopfheim versiegelt.
Schon kurz darauf wurde die Mutter in Nordrach gebraucht. Dort wohnte Cäzilia Braun, die andere Großmutter und Mutter meines Vaters. Sie war pflegebedürftig geworden und da war es selbstverständlich, dass sich die Schwiegertochter sich um sie zu kümmern hatte. Die Geschwister meines Vaters wohnten mit ihren eigenen Familien ausnahmslos außerhalb und zum Teil weit entfernt und der Großvater Karl war lange zuvor schon nach einem Arbeitsunfall im Wald an Blutvergiftung gestorben.
Die Pflegezeit währte zum Glück nicht sehr lange und die Großmutter beendete ihr irdisches Dasein. Das mag sarkastisch klingen, die andere Oma soll aber altersbedingt in ihnen letzten Lebensjahren eine sehr dominante, herrschsüchtige Frau gewesen sein. Dies verschlimmerte sich dem Ende zu ins Unerträgliche und sie schikanierte ihre Schwiegertochter nach Strich und Faden. Zudem war sie krankhaft geizig und gönnte ihrer Schwiegertochter nichts. Die übrige Verwandtschaft des Vaters war allerdings auch nicht besser.
Von Vaters Geschwistern und dem Werdegang der Braun‘schen Verwandtschaft ist uns heute nur wenig bekannt. Die familiären Bande waren nie sonderlich ausgeprägt, weil wir für sie nur als die „arme Verwandtschaft“ galten. Dabei hatten die Geschwister des Vaters, nachdem die Großmutter gestorben war, alles, was nicht niet- und nagelfest war, an sich gerissen und unter sich aufgeteilt. „Nicht einmal die Nähmaschine haben sie mir gelassen, womit ich für die Bauern im Tal hätte nähen können und so ein kleines Einkommen gehabt“, klagte die Mutter später ohne Verbitterung.
Nicht unerwähnt soll in diesem Zusammenhang bleiben, dass der Vater schon vor Kriegsbeginn erst zum Arbeitsdienst und danach freiwillig zum Militär gegangen war und gut verdient hat, aber wenig für sich brauchte. Das hatte es ihm ermöglicht, seiner Mutter zweimal die Kaufsumme für das Haus, in dem die Familie wohnte, zu übergeben, damit sie es kaufen sollte. Sie hat es nicht getan, lieber gab sie die „Grand Dame“ und verbrauchte alles für sich. Der Großvater lebte zu dieser Zeit schon nicht mehr, der hätte vielleicht anders gehandelt.
Schließlich kam der Vater nach rund zwei Jahren Krankenhaus und Psychiatrie mehr krank als gesund nach Hause. Doch an den Folgen des Unfalls und den körperlichen Beeinträchtigungen litt er bis zum Ende seines Lebens. Seine Lebensqualität war, bis er im Alter von 57 Jahren gestorben ist, massiv eingeschränkt. Jetzt aber war die Familie erst einmal komplett und es bestand Hoffnung, dass alles besser werden würde. Schnell hatte er auch einen Arbeitsplatz gefunden und konnte für ein bescheidenes Einkommen sorgen.
Die Großeltern väterlicherseits waren schon lange in Nordrach-Kolonie ansässig. Es ist ein Teilort und etwa sechs Kilometer vom Dorfkern entfernt. Die Familie wohnte somit weit abseits am Ende eines engen Tals. Das gemietete alte Häuschen blieb nach dem Tod der Großmutter vorerst noch als Wohnung den Eltern erhalten. Selbst wenn das Haus alt und baufällig war, waren sie froh, denn Wohnungen waren kurz nach Kriegsende überall sehr knapp, sogar in einem kleinen Dorf im Schwarzwald. Zahlreiche Flüchtlinge drängten in diesen Jahren in die Städte und Dörfer und alle mussten irgendwo untergebracht werden. Jedermann war froh, der ein bescheidenes Dach über dem Kopf hatte, die Lage oder ein gewisser Wohnkomfort waren da eher zweitrangig. Erschwerend erwiesen sich auch noch die Verkehrsverhältnisse jener Tage. Wohl fuhr der Linienbus ein oder zweimal täglich ins Dorf und weiter nach Zell am Harmersbach. Dort verkehrte das „Zeller Bähnle“, eine Kleinbahn, die zwischen Oberharmersbach und Biberach pendelte. In Biberach war der Umstieg in die Schwarzwaldbahn möglich, mit dem man nach Offenburg oder in die andere Richtung bis zum Bodensee reisen konnte. Doch wer hatte in jenen kargen Jahren Geld dafür und konnte sich einen solchen Luxus leisten? Meine Eltern hatten es nicht, sie mussten überwiegend die Wege zu Fuß zurücklegen oder mit einem alten klapprigen Fahrrad unterwegs sein.
Bei diesen widrigen Verhältnissen ergab es sich zwangsläufig, dass die Mutter den Kontakt zu ihrer Kirche verloren gegangen war. Die nächstgelegenen Gemeinden befanden sich in Hornberg oder Offenburg und wie hätte sie dorthin kommen sollen? Die Amtsträger und Seelsorger waren ebenso wenig mobil. So vergingen die Jahre und die Neuapostolische Kirche geriet mehr und mehr ins Vergessen und in den Hintergrund. Dafür waren andere Dinge drängender, es ging schlichtweg um die Existenz. Nur in schweren Stunden suchte sie die Nähe Gottes in der kleinen Kapelle, die zum Lungensanatorium Kolonie (heute Rehaklinik Klausenbach) gehörte und dort wird sie still gebetet haben und Kraft geholt. Das half ihr weiter, sie war zudem eine leidensfähige, zähe und stille Frohnatur und ihr noch jugendliches Alter gab ihr die nötige Tragfähigkeit dazu.
Jeder Tag war geprägt im Kampf um die Versorgung der nach und nach größer gewordenen Familie. Im Jahr 1946 kam mein jüngerer Bruder auf die Welt und weitere zwei Jahre später ein Mädchen, meine Schwester. Wie viele der ungelernten Arbeiter verdiente der Vater damals wenig. Im Hitler-Regime hatte die „verlorene Jugend“ ja nur das Töten gelernt. So bestand die tägliche Sorge ausschließlich darum, für die mehrköpfige Familie ein gutes Essen auf dem Tisch zu bringen, sowie angemessene Kleidung und Schuhe zu besitzen.
Mit drei und vier Jahren hing mein Leben sprichwörtlich mehrfach am seidenen Faden. Unmittelbar am Haus verlief ein schmaler Wasserkanal und der mündete in ein etwa 4 mal 3 m großes Stauwehr oder „Gumpen“. Mit dem darin aufgestauten Wasser wurde im rund hundert Meter entfernten Gasthaus Adler Strom erzeugt. Das Gasthaus Adler und das Sägewerk Echtle, in dem mein Vater arbeitete, und vielleicht noch ein weiteres Sägewerk, erzeugten mit Wasserkraft Strom für den eigenen Bedarf und versorgten auch ein paar Häuser im Tal. Ein öffentliches Stromnetz gab es noch nicht und längst nicht alle Häuser hingen am Stromnetz.
Während die Mutter in der dunklen Küche den kleinen Bruder in der Wanne badete, spielte ich draußen vor dem Haus und entdeckte auch schon im Gumpen einen Igel schwimmen, mit dem Bauch nach oben. Das Tier war tot, war ich nicht erkannte, nicht erkennen konnte, ich war noch zu klein und hatte keine Ahnung. Einer Gefahr war ich mir nicht bewusst und wollte nur den Igel herausholen, dabei platschte ich prompt ins Wasser. Im Reflex bekam ich noch ein Grasbüschel zu fassen, an dem ich mich festhielt und garantiert hatte ich einen wachsamen Engelsschutz. In der Not schrie ich Zeder und Mordio, trotzdem ist gefühlt eine Ewigkeit vergangen, bis mich die Mutter hören konnte, herbeikam und aus dem Wasser zog. Vermutlich lief die Turbine gerade nicht, sonst hätte mich der Sog nach unten an den Schmutzrechen gezogen.
Ein Jahre später folgte das nächste Malheur. Durch unglückliche Umstände wurde ich mit kochendem Wasser verbrüht und ich erlitt großflächige Verbrühungen vom Kopf bis zu den Füßen. Nur dank meiner damals schon guten körperlichen Konstitution und der Hilfe Gottes überlebte ich dieses Desaster. Über ein Vierteljahr wurde ich von Nonnen der katholischen Schwesternstation behandelt und medizinisch versorgt, bis ich wieder einigermaßen auf den Füßen stand, musste aber zuerst wieder das Laufen lernen. Zeitlebens blieben sichtbare Narben zurück, doch sie haben mich nie beeinträchtigt, behindert oder gestört, sie waren und sind seither ein Teil von mir. Die Betreuung von Kranken und Pflegebedürftiger durch Nonnen war damals im dörflichen Bereich nicht ungewöhnlich. Sie nahmen in der katholisch geprägten Bevölkerung vielfältige Aufgaben wahr und waren in der Krankenpflege ausgebildet. Ärztliche Hilfe stand sonst nur sehr eingeschränkt zur Verfügung, und wenn, dann waren Arztbesuche eher sporadisch. Die Siedlungen und verstreut weit abseits liegenden Häuser und Höfe in den entlegenen Tälern waren zu weit entfernt, und nur wenige Ärzte hatten so kurz nach Kriegsende ein Auto und genügend Benzin im Tank zum Fahren.
Ob mich die Mutter hin und wieder auch in die Kapelle mitgenommen hat, ist mir nicht mehr bewusst, ich denke eher nicht. Doch ich war einige Tage und manchmal Wochen bei einer älteren Bäuerin, die vermutlich zur Verwandtschaft zählte. Sie war praktizierende Katholikin und ging regelmäßig in die erwähnte kleine Kapelle und betete dort den Rosenkranz oder nahm an einer Messe teil. Sie nahm mich öfters mit und ich erinnere mich noch gut, dass sie mir eines Tages einen Rosenkranz schenkte. Vielleicht sogar auch ein Gebetbuch, obwohl ich noch nicht lesen konnte? Das gehörte in der Bevölkerung selbstverständlich dazu. Ich war stolz wie Bolle, der Rosenkranz mit vielen bunten Perlen ist mir sicher aber nur wegen den glitzernden Kugeln in Erinnerung geblieben, das war vermutlich ein faszinierendes Spielzeug; bunt, glitzernd, das war für gleichbedeutend wie edel und wertvoll.
Wie es seit jeher in jeder traditionsbewussten katholischen Bevölkerung Sitte und Brauch war, gab es bei ihr in der Wohnstube einen geschmückten Herrgottswinkel. Hinten in einer Ecke im dunklen, holzgetäfelten Raum stand ein holzgeschnitztes Kruzifix mit dem gekreuzigten Jesus, dazu allerlei Devotionalien, wie Marien-Bildchen, geweihtem Rosenkranz und reich verzierter Schmuckkerze. Daneben hing ein prächtiger Hochzeitskranz im schwarz-glanzlackierten Rahmen. Solche Hochzeitskränze waren ein kostbarer Teil der bäuerlichen Tracht. Damals heiratete das Hochzeitspaar noch in der örtlichen Tracht und das ist heute auch wieder zunehmend so. So eine reich geschmückte Brautkrone war die Zierde jeder Braut und die wertvolle, schmucke Krone wurde nach der Hochzeit im verzierten Bildrahmen hinter Glas geschützt, aufbewahrt und über Generationen weitervererbt.
3
Die Neuapostolische Kirche entwickelt sich rasant
Ein Jahr vor meiner Einschulung wechselten wir vom hinteren Ende des Tales, der Kolonie, in die zentralere Dorfmitte. Der Vater hatte „am Schrofen“ eine Wohnung mieten können, nachdem uns das alte Haus gekündigt worden war und später abgerissen wurde. Die neue Wohnung im alten, etwas baufälligen Haus des Emil-Sepp (Josef Ficht) war nicht viel besser, wie wir bis dahin wohnten, sie war jetzt aber nicht mehr so weit abseits gelegen, so abgeschieden vom Dorfkern.
Inzwischen gab es auch im etwa 20 Kilometer entfernten Haslach im Kinzigtal eine kleine Neuapostolische Gemeinde. Sie gehörte zum Bischofsbezirk Süd und wurde von Bischof Karl Weiss geleitet. Im August 1950 war Bezirksapostel Karl Hartmann überraschend während eines Erholungsaufenthalts in der Schweiz gestorben und Stammapostel Johann Gottfried Bischoff ordinierte den Bezirksevangelisten Friedrich Hahn zum Bezirksapostel für Baden. Mit Friedrich Hahn bekam der Apostelbezirk eine außergewöhnlich charismatische Persönlichkeit, gepaart mit einem schier unerschöpflichen Arbeitspensum. Schon mit 30 Jahren hatte er es zum Direktor eines großen Industrieunternehmens gebracht. Seine auffallenden Merkmale waren eine große Ausstrahlung, seine gewinnende Persönlichkeit und ein phänomenales Personengedächtnis.
Die kleine Kirchengemeinde Haslach umfasste die politischen Gemeinden Hausach, Zell, Ober- und Unterharmersbach, Biberach, Steinach, Welschensteinach und letztlich auch Nordrach. Allerdings wohnten damals nur sehr wenige Kirchenmitglieder in diesem flächenmäßig großen Gebiet. Da mag man ermessen, welche Opfer die Seelsorger jener Tage gebracht haben, wenn sie Gottesdienste hielten und die Geschwister betreuen wollten. Sie gingen die Wege entweder zu Fuß oder mussten fuhren mit dem Fahrrad. Mitte des 20. Jahrhunderts konnte sich nur wenige ein Motorrad oder Moped leisten und nur eine kleine Minderheit besaß ein Auto.
Der stetige Zuwachs an Mitgliedern war überwiegend dem Zuzug sogenannter „Flüchtlinge“ zu verdanken, den Strömen der Vertriebenen, die aus dem Osten kamen. In den ehemaligen Ostgebieten, insbesondere in Ostpreußen, bestanden vor dem Krieg schon große, mitgliederstarke neuapostolische Gemeinden. Noch vor dem Kriegsende hatten viele Ostpreußen und Schlesien, später auch die Ostzone – wie die DDR ursprünglich genannt wurde – verlassen müssen oder wurden, wie die Sudetendeutschen, über Nacht ausgewiesen. Sie landeten zuerst in Sammellagern in Dänemark und anderswo, dann wurden sie von den Behörden im Bundesgebiet verteilt. Die der Heimat entwurzelten Menschen wurden erst einem Bundesland und dann den Städten und Dörfern zugewiesen. Zu zigtausenden gelangten sie so auch in den Südwesten Deutschlands und sogar in die entlegensten Täler des Mittleren Schwarzwaldes. Jede auch noch so weit entfernte freie Wohnung auf den Bauernhöfen war noch recht, ob im schlicht ausgebauten Kellerraum oder im zugigen Dachgeschoss. Die Ankömmlinge fanden zuerst hier eine Irdische, und natürlich suchten sie am neuen Wohnort auch nach ihrer Kirche, der geistigen Heimat. Andererseits war das seelische Verlangen in den Nachkriegsjahren nach Frieden und Geborgenheit unter der geschundenen Bevölkerung übermächtig. Die Menschen suchten die Wärme der kirchlichen Gemeinschaft und den seelischen Trost im Gotteswort der Predigt. Gemeinsam lobten sie Gott und im Kreis der Gläubigen beteten sie ihn an.
Nach Jahren bekamen die Haslacher aus Schopfheim die Information, dass in Nordrach eine junge Frau mit Kind wohnen soll, die der Kirche angehört. Wir waren also nicht in Vergessenheit geraten und man wollte nach uns schauen. In Unterharmersbach wohnten Else und Kurt Schaumburg, die es nach dem Krieg von Wuppertal-Elberfeld ebenfalls in den Schwarzwald verschlagen hatte. „Onkel Schaumburg“, wie wir ihn nannten, war der Auftrag zugefallen, nach der Mutter und ihrem Kind zu suchen.
Übrigens war 1950 der erste Gottesdienst der Neuapostolischen Kirche in der Region in ihrer kleinen Wohnung, ein Novum für das Nordrach- und Harmersbachtal und ging in die Annalen ein. Kurt Schaumburg betätigte sich als Anzeigenvertreter für das Offenburger Tageblatt und viel unterwegs. Da er wochentags vermutlich keine Zeit hatte, übernahm seine Frau den Auftrag, nach den Brauns in Nordrach zu suchen. So kam es, dass Tante Schaumburg mit ihrem Uraltfahrrad die Dorfstraße aufwärts radelte. Ihr war aber nur die alte Anschrift bekannt und deshalb quälte sie sich sogar unnötig die sechs Kilometer in die Kolonie und musste hören: „Die Brauns sind nach draußen ins Dorf verzogen.“
Der mühsame Weg ins Hintertal von Nordrach war umsonst, doch das hielt sie nicht ab, weiter nach uns zu suchen, sie fuhr zurück, erkundigte sich im Dorf und bekam unsere Adresse. Die gesuchte Frau war meine Mutter und ich war das Kind, das kurz nach „Tante Schaumburg“ in die Wohnung gestürmt kam. Ich war der Bengel, der die Radlerin mit den anderen Lausbuben im Dorf gehänselt hatte.
4
Regelmäßige Kirchenbesuche
Von nun an konnte meine Mutter wieder, mit gewissen Einschränkungen zwar, doch immerhin in die Gottesdienste der Neuapostolischen Kirche gehen, und sie erhielt vom Ehepaar Schaumburg hilfreiche Unterstützung. Wenn es die Umstände zuließ, radelte die Mutter sonntags bei Wind und Wetter mit ihrem alten Fahrrad nach Haslach. Sie war noch jung, noch nicht einmal dreißig, hatte aber schon schwerste Zeiten hinter sich. Gerade erst zwanzig, kam ich zur Welt und gleich darauf folgten die beschwerlichen Umstände der Flucht. Anschließend musste sie eine Zeitlang die herrschsüchtige und schwierige Schwiegermutter pflegen und ertragen, während ihr Mann ein Jahr nach Kriegsende immer noch gesundheitlich schwer angeschlagen war und in der Psychiatrie behandelt werden musste. Dazu fehlte es immerzu am nötigen Geld, und die gebotenen Verdienstmöglichkeiten waren spärlich. Wie es so geht, wurde die noch junge Familie auch größer, im Abstand von jeweils 2 Jahren kamen zwei Kinder dazu. Die lebensbedrohenden Vorfälle, die ihr gehörige Schrecken einjagten und große Sorgen bereiteten, habe ich schon erwähnt und mein kleiner Bruder ist auch nicht vom Unglück verschont geblieben. Das Leben hatte es bisher keinesfalls gut mit ihr gemeint. Sowas erträgt ein Mensch allgemein nur mit viel Optimismus und einer positiven Natur, und wenn er belastbar und geduldig ist. Gut ist auch, wenn man, wie meine Mutter, über einen unerschütterlichen Glauben verfügte. Daraus entstand ihr großes Verlangen nach Gott, nach seelischem Zuspruch, Wärme und Geborgenheit innerhalb einer lebendigen Kirchengemeinde und genau das fand sie in jenen Jahren auch wieder in Haslach, da war sie akzeptiert, wertgeschätzt und angenommen. Das Ehepaar Schaumburg und andere wurden ihr eine wertvolle Stützen, gaben ihr Trost, wenn es nötig war, und zeigten sich als ehrliche und unverzichtbare Ratgebern.
Die Entfernung von Nordrach bis nach Haslach beträgt rund 20 Kilometer und hin zu zurück also die doppelte Strecke. Mit einem alten Fahrrad war das eine sportliche Leistung. Berücksichtigt man zudem noch, dass die Straße nicht flach verläuft, weder auf dem Hinweg nach Haslach noch auf dem Rückweg von Zell nach Nordrach. In jeder Richtung gibt es moderat ansteigende Abschnitte und die damals gesplitteten Straßen machten es auch nicht leichter, sondern manchmal gefährlich rutschig. Trotzdem ließ sie es sich nicht mehr nehmen, möglichst oft in die Gottesdienste zu kommen. Sehr hilfreich war ihr die Natur eines abgehärteten Schwarzwaldmädchens, sie war ungemein zäh und drahtig, somit fiel es ihr nicht sonderlich schwer, oder wenn doch, dann hat sie es sich nicht anmerken lassen und hätte es auch niemals zugegeben.
Ob sie mich gleich schon von Anfang an auf dem Gepäckträger ihres Fahrrads mitgenommen hat, weiß ich nicht mehr, möglich ist es aber schon. Mit Onkel Schaumburg dagegen hatte ein altes Motorrad und hin und wieder hat er mich auf dem Sozius mitgenommen und nicht nur zu Gottesdiensten. Mehrmals durfte ich ein oder mehrere Tage bei ihnen zu Hause sein. Die Zeit bei dem kinderlieben Ehepaar behielt ich in gut Erinnerung und ich genoss es, das war wie Urlaub. Dort wurde ich verwöhnt, und seit ich denken konnte, war es mir immer ein drängendes Bedürfnis von daheim wegzukommen. Schon bald darauf kauften die Schaumburg ein gebrauchtes Auto, wenn es auch nur ein alter Opel aus der Vorkriegszeit war, und das machte fortan die Mitfahrgelegenheiten für mich noch interessanter. Das war ein willkommenes Abenteuer; ob kurz oder weit, egal, wenn ich im Auto saß, fühlte ich mich wie ein König.
Während den Sommermonaten und weit in den Herbst radelte die Mutter unverdrossen nach Haslach und das ging lange Zeit gut. Dann kam aber der Winter, es lag Schnee auf den Straßen und stellenweise war es glatt. Dabei ist es passiert, sie ist unglücklich gestürzt und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Für uns war das eine mittlere Katastrophe, denn wer sollten den Vater und uns drei Kinder versorgen? Die Mutter war über Wochen gehandicapt und der Vater musste tagsüber zur Arbeit. Da wurde die jüngere Schwester der Mutter zur Helferin in der Not. Die Tante kam für ein paar Wochen aus dem Wiesental nach Nordrach, wie sie es schon bei den Geburten meiner Geschwister getan hatte und versorgte den Haushalt, bis wieder Normalität herrschte.
Das dauerte allerdings viele Wochen und der Vater wollte danach nicht mehr, dass sie allein mit dem Fahrrad zur Kirche fährt: „Entweder du bleibst zu Hause oder du fährst nur, wenn ich dabei bin“, entschied er, und wenn er etwas durchsetzen wollte, konnte er ein richtiger Sturkopf sein, doch die Mutter war es auch. Sie hatte im Glauben wieder Feuer gefangen und ließ sich nicht mehr und durch niemand abhalten. Was blieb dem Vater übrig? Er musste sie fortan begleiten. Inzwischen hatten sie sogar ein zweites, ebenfalls gebrauchtes und altes Fahrrad und das erlaubte gemeinsam zu fahren. Das Fahrrad bekam einen Kindersitz am Lenkrad und wenn die Eltern nach Haslach wollten, wurde Waltraud beim Vater vorne in den Kindersitz gesetzt und Rudolf hinten auf den Gepäckträger. Ich saß bei der Mutter hinten auf dem Gepäckträger und so erreichten wir in der Regel zu fünft nach gut einer Stunde wohlbehalten die Stadt Haslach.
In der Dorfbevölkerung hatte sich bald herumgesprochen, wohin die Brauns an den Sonntagen radelten und die Eltern werden auch kein Geheimnis daraus gemacht haben, was sicher für den Vater etwas Mut erforderte. Die Nordracher Bevölkerung war überwiegend konservativ und streng katholisch, und da sahen sie es nicht gerne, wenn welche aus der Dorfgemeinschaft einer Sekte angehörten. Spöttisch wurde der Vater „Apostel“ gerufen und dieser Spottname ist ihm dauerhaft geblieben.
An einem sonnigen Sonntagnachmittag sind wir wieder einmal mit den Fahrrädern das Dorf hinausradelten, während halbwüchsige Buben auf der gemähten Wiese links der Straße unterhalb des mächtigen Muserhofes dem Fußball nachjagten. Nachdem sie uns sahen, riefen welche spöttisch: „Apostel, Apostel“. Der Vater hielt stoppte wütend, ließ das Fahrrad fallen und die jüngeren Geschwister lagen lauthals heulend im Gras am Straßenrand. Behänd rannte er den in alle Richtungen davoneilenden Kindern nach und bekam einen der Burschen am Schlafittchen zu fassen. Der bekam links und rechts ein paar kräftige „Backpfeifen“. Hinterher belegte ihn die Gemeinde wegen dieses Vorfalls mit einer 150 Mark-Strafe. Wir haben danach aber nie mehr Kinder spotten hören, das muss sich also im Dorf schnell herumgesprochen haben. Hingegen war er, offen und hinter herum, an den Stammtischen des Ortes weiter der „Apostel“, was jedoch eher scherzhaft gemeint war, und das hat ihn in diesem Kreis anscheinend weder geärgert noch gestört. Zumindest hat er sich nie dazu aufbegehrend geäußert. An manche unabänderlichen Dinge gewöhnt man sich halt, das war vielleicht auch bei ihm so, oder er hat es ignoriert und nahm das den Stammtischbrüdern nicht übel. In der dörflichen Gemeinschaft, in der jeder jeden kennt, hatten sowieso alle Männer einen Spitznamen weg. So redete man sich im Umgang untereinander an, nicht mit dem eigentlichen Namen. Die Braun‘sche Sippe kannte man, vom Spitznamen „Apostel“ einmal abgesehen, seit alters her als die Korbers. Der Großvater war der Korber-Karl, der Korber-Wilhelm und einen Korber-Schneider gab es auch noch, der weitläufig mit uns verwandt war. Warum, und woher dieser Übername kam, ist mir nicht bekannt. Vielleicht war ein Vorfahre in alter Zeit Korbmacher von Beruf.
5
Neue geistige Heimat in der Kirche
Die Neuapostolische Kirchengemeinde in Haslach im Kinzigtal gehörte Anfang der 1950er Jahre noch zum Bischofsbezirk Süd. Die seelsorgerische Betreuung oblag überwiegend wenigen priesterlichen Ämtern, die dazu aus Triberg und Hornberg angereist kamen. Die Gemeinde Haslach bekam erst später mit Onkel Schaumburg den ersten Amtsträger, nachdem er zum Diakon ordiniert worden war. Damals kam es gelegentlich sogar vor, dass er als Diakon den Gottesdienst leiten musste, weil kein Priester anwesend war. In solchen Fällen begann und beendete er den Gottesdienst mit Gebet und Segen, hielt eine kurze Andacht, jedoch ohne die sakramentale Handlung des Heiligen Abendmahls. Allgemein reisten die Amtsträger sonst mit der Eisenbahn von Hornberg und Triberg an. In guter Erinnerung blieb mir – schon wegen seines ausgefallenen oder für einen Kirchenmann ungewöhnlichen Namens – der Priester Teufel aus Triberg. Allerdings findet sich dieser Namen im Hochschwarzwald häufiger. Erinnert sei nur an den ehemaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, und in der Neuapostolischen Kirche wirkte viele Jahre Karl Teufel aus Tuttlingen als Bischoff im südlichen Baden. Ungewöhnlich war und ist der Name also keineswegs; eher gewöhnungsbedürftig.
Zu besonderen Anlässen und Festgottesdiensten, unter anderem, wenn Bezirksapostel Friedrich Hahn in den Schwarzwald kam, waren wir Haslacher nach Hornberg oder Triberg eingeladen. Solche größeren Gottesdienstveranstaltungen fanden meistens in angemieteten Stadthallen statt, in denen mehrere hundert oder tausend Teilnehmer Platz fanden. Zu den Highlights der 1950er Jahre zählte der Besuch des Stammapostels J. G. Bischoff in Hornberg, der durch das „Hornberger Schießen“ bekannten Stadt. Wir Nordracher waren bei diesem außergewöhnlichen Ereignis mit dabei.
Diese Stadt hatte da in der Neuapostolischen Welt schon einen besonderen Klang. Es wurde berichtet, dass Stammapostel Hermann Niehaus, der bei der Eisenbahn beschäftigt war, während einer Bahnfahrt über den Schwarzwald einen außerplanmäßigen Halt in Hornberg einlegen musste. Daraufhin prophezeite er: „In dieser Stadt wird eine blühende Gemeinde entstehen.“ Nur wenige Jahre später hatte sich seine Vision erfüllt. Die Neuapostolische Kirche Hornberg zählte zu den ältesten Kirchengemeinden im Schwarzwald, ist aber heute, wie viele andere Traditionsgemeinden auch, vor einigen Jahren mit Triberg fusioniert worden.
Zu diesen Großveranstaltungen in Hornberg oder Triberg fuhren die Eltern mit uns Kindern ab Biberach mit der Schwarzwaldbahn. Da bei uns Geld stets knapp war, versuchte der Vater zu sparen, wo es ging. Die Kinder fuhren bis 4 Jahren bei den Eltern noch kostenlos mit, und das Alter eines Kindes ist allgemein schwer einzuschätzen. Kurzerhand gab der Vater meinen kleinen Bruder noch länger mit vier Jahren aus, obwohl er schon älter war. Eines Tages saßen wir wieder im Zugabteil und der Vater hatte Fahrkarten für zwei Erwachsene und ein Kind gelöst. Der Kontrolleur kam, wollte die Fahrscheine prüfen und dabei wissen: „Wie alt sind die jüngeren Kinder?“ „Die sind zwei und vier“, antwortete mein Vater. „Nein, ich bin doch schon sechs“, protestierte Rudolf. Das war jetzt aber sehr peinlich, der Vater musste die fehlende Fahrkarte nachlösen und vielleicht auch noch einen Strafzuschlag bezahlen. Nach dieser Blamage hat er nie mehr getrickst, dafür fand er eine andere Lösung, wie ich noch erwähnen werde.
Im Jahr 1951 wurde der in Triberg mit meinem jüngeren Bruder Rudolf und der kleinen Schwester Waltraud durch Bezirksapostel Friedrich Hahn versiegelt. Diesmal waren wir von Haslach mit dem Bus angereist und der Gottesdienst fand in der Stadthalle statt. Für mich blieb dieser Tag in besonderem Maße in Erinnerung. Jene Jahre waren durch ein rasantes Wachstum der Neuapostolischen Kirche geprägt. Sicher waren die Gründe in der noch nicht lange zurückliegenden Kriegszeit und der Kargheit jener Tage zu sehen, die Menschen hungerten nach seelischem Zuspruch, der ihnen in den etablierten Kirchen oft fehlte. Jährlich kamen zigtausende Mitglieder neu hinzu, sogar im katholisch geprägten Süden oder im erzkonservativen Schwarzwald. Bei der Verabschiedung strich mir der Bezirksapostel mit der Hand über den Kopf und sagte: „Lieber Walter, ich wünsche dir Gottes Segen.“ Das beeindruckte mich und ich wunderte mich, woher kennt der Apostel denn meinen Namen? Wie sollte ich als Kind wissen, dass er natürlich informiert worden war und wusste: Der Versiegelte hat neben den zwei Kindern, die mit ihm am Altar standen, auch noch eine Frau und ein weiteres Kind, die schon länger der Kirche angehörten.
Der charismatische Bezirksapostel war eine prägnante Persönlichkeit mit großer Ausstrahlung. Schon in jungen Jahren schaffte er es bis zum Direktor in einem weltweit agierenden Industrieunternehmen. Es war sogar vorgesehen, so wurde berichtet, dass er Generaldirektor dieses Unternehmens werden sollte, das würde heute dem Vorstandsvorsitzenden entsprechen. Diese Berufung lehnte er unerwartet ab und gab, für alle unverständlich und überraschend, seinen Posten auf, nachdem er Bezirksapostel geworden war. Niemand im Unternehmen hatte seine Entscheidung verstanden und nichts wurde unversucht gelassen, ihn noch umzustimmen. Garantiert hätte ihn eine grandiose Karriere erwartet, mit deutlich besserer Dotierung als in der neuen Funktion als Leiter der Neuapostolischen Kirche in Baden. Im Kreis der Jugend wurde gerne auch eine Begebenheit aus seiner aktiven Zeit als Direktor kolportiert. Im beruflichen Auftrag und als Repräsentant seines Unternehmens weilte er am ägyptischen Hof, es ging bei den Verhandlungen um einen bedeutenden Auftrag. Zu seinen Ehren gab der ägyptische König Faruq I ein Festbankett und eine Prinzessin wertete das Ereignis mit ihrer Anwesenheit gebührend auf. Gemäß dem Protokoll war bestimmt, dass Friedrich Hahn mit ihr den Tanz eröffnen sollte, was als besondere Ehre galt. Doch damals war Tanz in der Neuapostolischen Kirche noch verpönt. Schweren Herzens und in Sorge, die Verhandlungen könnten scheitern, offenbarte Friedrich Hahn der Prinzessin: „In meinem Glauben gilt Tanz als gottlos und ist nicht erwünscht.“ Seine Furcht war unbegründet. Im Islam haben streng gelebte Glaubensgrundsätze einen hohen Stellenwert, und so bekam das Unternehmen doch oder gerade deshalb den Auftrag für das lukrative Geschäft.
So wie er sich im Unternehmen mit ganzer Kraft engagierte, tat er es über viele Jahre auch für die Kirche im Apostelbezirk Baden, den er souverän leitete. Innerhalb kurzer Zeit hatte er ungemein viel bewegen können und er war überall präsent. Noch Jahrzehnte später schwärmten die Kirchenmitglieder von denkwürdigen Begegnungen mit ihrem Apostel, und auch beim Stammapostel war er höchst angesehen. Manchmal kam es vor, dass Friedrich Hahn mit dem Auto durch Karlsruhe fuhr, irgendwo auf der Straße ein bekanntes Gesicht sah, spontan anhielt, kurzerhand das Auto stehen ließ und über die Straße rannte, um das Geschwister zu begrüßen. Ob deshalb die Straßenbahn anhalten musste, war ihm egal. Oft arbeitete er weit über seine Kräfte, war für jeden und für alle ansprechbar. Doch gesundheitlich wirkte sich vermutlich nicht nur sein Arbeitspensum negativ aus, sondern vielmehr wird es sein exzessiver Zigarettenkonsum gewesen sein und das sollte sich später rächen. Seine Leidenschaft für die Zigarette war im Apostelkollegium nicht unumstritten. Im Norden war Bezirksapostel Karl Weinmann aus Hamburg ein strikter und erklärter Gegner des Nikotingenusses und er wollte das Rauchen auch gerne den Amtsträgern seines Bezirkes verbieten. Sogar im Kreis der Apostelkollegen regte er an, sie sollten das Rauchen aufhören. Bei diesem Thema fand er bei Hahn kein Gehör und deshalb machte folgendes Gespräch humorvoll die Runde: Der Bezirksapostel Hahn erhielt die Anfrage: „Wenn ich das Rauchen aufgebe, bin ich dann ein Überwinder?“ Da soll Hahn geantwortet haben: „Nein, ein Nichtraucher.“ Da war er wieder pragmatisch.
6
Ein Mann mit weltmännischem Format
Von Onkel Schaumburg und Els’chen – wie er seine Frau liebevoll nannte – war schon die Rede und auch, dass ich öfters bei ihnen zu Hause sei durfte. Aus mir unbekannten Gründen waren sie kinderlos und litten unter dem ungewollten Umstand. So war ich für sie vielleicht ein Kindersatz, was mir nicht unrecht war. Ich war gerne bei ihnen und noch wichtiger war, ich war eine Weile von zu Hause weg, weit weg aus dem Bannkreis meines strengen Vaters.
Kurt Schaumburg in jungen Jahren
Die Schaumburgs fanden anfangs der 1950er Jahre in Haslach eine größere Wohnung. Sie bezogen in der Innenstadt dort zwar auch nur eine Altbauwohnung, aber sie bot mehr Räumlichkeiten als bisher in Unterharmersbach. Nicht unwichtig war, sie wohnten außerdem, was die Kirche betraf, direkt vor Ort. Die größere Wohnung war zudem noch aus einem anderen Grund wichtig. Häufig weilten Gäste bei ihnen und das waren nicht nur höhere Ämter, die zu den Gottesdiensten in die Gemeinde Haslach kamen, die von ihnen bewirtet wurden und dort übernachteten. Regelmäßig klingelten auch durchreisende Glaubensmitglieder an ihrer Türe. Noch immer waren unter den vielen Wohnsitzlosen auch sogenannte „Flüchtlinge“ der Neuapostolische Kirche unterwegs. Zum einen waren es Rückkehrer aus der Kriegsgefangenschaft und andererseits, aus welchen Gründen auch immer, entwurzelte Menschen. Alle fanden bei dem Ehepaar ein offenes Haus und demzufolge waren die Schaumburgs weithin bekannt wie „bunte Hunde“. Schon damals wurden die Gemeinde-Adressen der Kirchen und Versammlungsstätten, sowie die Namen des zuständigen Vorstehers als mögliche Ansprechpartner dem Reisenden mitgegeben. Demzufolge war in einer Stadt der Vorsteher immer die erste Anlaufstelle. Bei den anderen Konfessionen war es nicht anders, klingelten die Reisenden an den Pfarrämtern.
Seine Offenheit und warme Ausstrahlung steigerten „Onkel Schaumburgs“ Bekanntheitsgrad zusätzlich. Er war weltgewandt, überaus belesen und rhetorisch geschult. Die Zeit der Arbeitslosigkeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte er gut genützt und Rhetorikkurse belegt. So verstand er geschickt zu formulieren und er konnte sprachlich die Zuhörer fesseln. Schon darin hob er sich von den vielen einfachen, meist handwerklich geprägten Männern ab, die als Priester oder in höheren Ämtern predigten. Sie verstanden zwar gut ihr Handwerk, waren beruflich geschickt, aber eben keine geschliffenen Redner. Damit will ich keineswegs den aufopfernden Einsatz dieser Männer schmälern. Deren Predigtstil war schlicht und völlig anders, kam mehr aus dem Herzen, der Seele, und wurde nicht rein vom Intellekt geprägt. Bei einer vom Dialekt gefärbten Predigt kam es bei den meisten der gläubigen Menschen auch in erster Linie nicht auf die perfekte Grammatik an und theologische Feinheiten, da war eher die blumige, beispielgebende Sprache gefragt.
Anfangs der 1950er Jahre wurde die Gemeinde Haslach selbständig und Kurt Schaumburg als Priester eingesetzt. Anfangs leitete er die Gemeinde noch kommissarisch, wobei Robert Steiner als weiterer Priester hinzukam. Die Gottesdienste fanden ab 1950 zuerst in der Volksschule in gemieteten Räumen des „Fürstenberger Hof“ statt, denn ein eigenes Kirchenlokal besaß man noch nicht. Später versammelten sich die Gottesdienstteilnehmer kurzzeitig in einem Nebensaal der Wirtschaft „Bierkrämer“, was sich nicht als ideal erwies. Die laut grölenden Zecher störten die Andacht manchmal doch mehr als erträglich und sicher war das beabsichtigt. Den besten Leumund hatte die Kneipe auch nicht und so waren alle froh, als sich eine bessere Lösung anbot. In der Haslacher Seegerstraße wohnte die Familie Maus und sie besaßen ein großes Anwesen. Sie waren unserer Kirche wohlgesonnen, deshalb konnte bei ihnen das Dachgeschoss für Gottesdienstzwecke angemietet werden. Die Räume mussten jedoch zuerst noch geeignet umgebaut werden. Die Umbauarbeiten zum Kirchenraum und die der Nebenräume erfolgte weitgehend in Eigenregie, die Kosten für das Material übernahm die Kirchenverwaltung. Der große Versammlungsraum, mit separater Sakristei und Sanitärräumen, war danach für die Gemeinde über mehrere Jahre ein würdiger Gottesdienstsaal, bis 1960 in der Königsberger Straße eine Kirchenneubau eingeweiht werden konnte.
Die 1960 eingeweihte Kirche in Haslach
In diesen Jahren wurden in Baden zahlreiche neue Kirchen gebaut und fast immer als Serienbauten. Die Kirche in Haslach war ein 200er Typ, bot also Platz für 200 Personen. Im Erdgeschoss befand sich die Sakristei und einen Nebenraum für Kindergottesdienste, Religionsunterricht, Gemeindezusammenkünfte und sonstige Veranstaltungen. In jenen Jahren waren Festgottesdiensten, da waren durchweg sämtliche Räume bis auf den letzten Platz belegt und sogar im Treppenaufgang saßen Gottesdienstteilnehmer. Dann wurden schon mal mehr als 400 Anwesende gezählt. Die neue Kirche und größeren Räumlichkeiten waren dringend nötig geworden, denn die Mitgliederzahl hatte Jahr für Jahr im zweistelligen Bereich zugenommen. Dafür mag es mehrere Gründe gegeben haben. Die Menschen waren noch empfänglicher für das Wort Gottes, es gab kaum Fernseher oder andere Zeitfresser, wie heute in der materialistischen, durch Events und Egoismus geprägten Zeit. Allgemein waren die Menschen noch dankbar für den seelischen Zuspruch. In der Neuapostolischen Kirche gab es aber noch einen wesentlichen Grund, das war die unmittelbare Naherwartung Jesus Christus und sogenannte „Botschaft“.
Im Gottesdienst in Gießen an Weihnachten 1951 hatte Stammapostel J.G. Bischoff sinngemäß verkündet: „Ich werde nicht sterben. Gott hat mir die Verheißung gegeben, dass Jesus Christus in meiner Lebenszeit wiederkommen wird.“ Das zog die gläubigen Menschen magisch an, die an die Verheißung Jesu Christi und sein Wiederkommen glaubten. Die „Botschaft“ war ein Ziel im überschaubaren Zeitrahmen und es gab den Mitgliedern einen unglaublichen Motivationsschub, diese frohe Botschaft allen Menschen kundzutun, sie aufzurütteln und in die Gottesdienste einzuladen. Das blieb nicht ohne Erfolg, und es erweckte auf das Wiederkommen Jesu Christi eine stimulierende Euphorie. Alles konzentrierte sich auf dieses hohe Ziel im verheißenen und herbeigesehnten Ereignis.
Die „Botschaft“ schaukelte sich nach und nach hoch, verselbständigte sich gewissermaßen und in den Folgejahren wurde sie – heute nicht mehr nachvollziehbar – zum Dogma erhoben und das nahm da und dort skurrile Züge an: Da ließen Eltern ihre Kinder nicht mehr studieren oder einen handwerklichen Beruf ergreifen. „Das brauchen sie nicht mehr, der Herr Jesus kommt bald“, so die etwas verblendete Begründung. Stattdessen sollte man die freie Zeit nützen und „Zeugnis bringen gehen“, wie man die Missionstätigkeit nannte. Bei meiner Mutter fiel die Botschaft ebenfalls auf einen fruchtbaren Boden, das Wiederkommen Jesu Christi, die verheißene Hochzeit der Brautgemeinde im Himmel, das unendliche Glück einer unbeschwerten Ewigkeit mit Gott wurde ihr Lebensinhalt.
Die „Botschaft“ in allen Fassetten, wenn auch je nach Region und Verantwortlichen in der Ausprägungsform etwas differenzierter, nahm später Formen an, die dann aber selbst unserer gläubigen Mutter zu weit gingen. In einem Gottesdienst wurde dem „Gottesvolk“ nahegelegt: „Das neuapostolischen Heim braucht keinen Weihnachtsbaum, das ist ein weltliches Brauchtum.“ Das machte sie nicht mit und wir Kinder schon gar nicht. Selbstverständlich stand bei uns jedes Jahr weiterhin ein reich geschmückter Weihnachtsbaum in der Stube. Eine andere Sache tangiert uns nicht. Gegen Ende der 1950er Jahre folgte die Verteufelung der neu aufgekommenen Fernsehgeräte. „Da holen wir nur die sündige Welt (ein Begriff für Vergänglichkeit und Gottlosigkeit) ins Haus.“ Wir hatten zuhause noch viele Jahre keinen Fernseher, doch wir Kinder waren dem neuen Medium nicht abgeneigt. Wenn wir fernsehen wollten, fanden wir in der Nachbarschaft oder anderswo dafür Gelegenheiten. Das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1954 verfolgte ich mit anderen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Nebensaal des Gasthauses „Stube“ im Dorf. Häufig ging ich zu einer benachbarten Familie und saß stundenlang vor der „Klotze“. Damals liefen solche spektakulären Sendungen wie: „Soweit die Füße tragen“, aber auch an andere Klassiker der damaligen Zeit. Eine