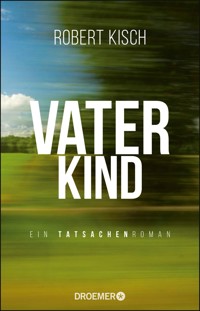6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Robert Kischs Geschichte geht weiter: Er wurde gefeuert, seine Frau hat ihn verlassen, und er begibt sich auf eine Mission, die so mutig ist wie universal: Kisch sucht das Lebens-Glück. Auf seinem Weg begegnet er interessanten Menschen. Einem Physiker, einer Zen-Lehrerin und einem ehemaligen Kommunisten. Einem Hirnforscher, einem Unternehmensberater, einer Hospiz-Mitarbeiterin und einem ehemaligen Flüchtling. Erstaunt registriert Kisch eine große Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft: Menschen, die nicht mehr links oder rechts stehen, sondern die ihr Leben danach ausrichten, was wirklich wichtig ist. Geburt und Tod, Essen und Trinken, Liebe und Glück. Dieser mutige Roman öffnet die Augen. Und das Herz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Robert Kisch
Glück
Ein Tatsachenroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Robert Kisch ist das Pseudonym eines preisgekrönten deutschen Journalisten in Berlin, einer sogenannten Edelfeder, hochdekoriert mit den wichtigsten deutschen Journalismuspreisen, Stipendien und Auszeichnungen. In der Wirtschaftskrise verlor er seinen Job und arbeitete daraufhin als Verkäufer in einem der großen Möbelhäuser Deutschlands. Nach der Veröffentlichung seines Romans »Möbelhaus« und seiner Freistellung reiste er durch Deutschland auf der Suche nach dem Glück.
Inhaltsübersicht
Zitat
Aus und ein
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Ich und du
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Jetzt und gleich
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Groß und klein
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Geist und Wahrheit
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Tee und Tao
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Leben und Tod
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Meckern und motzen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Aus und vorbei
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Die Göttin Großstadt hat uns ausgespuckt,
in dieses wüste Meer von Stein.
Wir haben ihren Atem eingeschluckt,
dann ließ sie uns allein.
Wolfgang Borchert
Aus und ein
1
Heute ist der Tag meiner Kündigung.
Allerdings kann ich mir den Satz noch zehnmal in Gedanken vorsagen und werde ihn trotzdem nicht begreifen. Auch nicht beim elften Mal. Nicht in der Bedeutung, die er in Wahrheit trägt. Nicht in der Dramatik, die er offensichtlich besitzt. Heute ist der Tag meiner Kündigung. Wobei ich mir das Szenario in den letzten Wochen immer wieder ausgemalt habe, mit wechselnden Fantasiefiguren. Und letztlich verläuft alles doch ganz anders.
»Kaffee?«
»Gerne …« Streng genommen habe ich seit zwei Monaten mit so einem Gespräch gerechnet.
»Wasser?«
»Gerne …«
Die Erbin ist sehr intelligent. Und auch sehr nett. Wir stehen anfänglich noch herum, und ich habe fast das Gefühl, dass sie genauso verblüfft ist wie ich über diese bizarre Beliebigkeit unserer Sätze. Das ist so banal, unsere Begrüßung, unser Smalltalk.
»Jaaa …«
Und ich habe beinahe das Gefühl, dass wir uns mögen. Was nicht sein kann. Weil Eulenberg, der mit seiner Einschätzung meist richtigliegt, immer betont, dass sie noch schlimmer sei als der Alte. Also muss ich davon ausgehen, dass auch diese Form der Nettigkeit nur eine ausgeklügelte Form von Schauspielerei ist.
»Wir müssen wohl noch mal über Ihr Arbeitsverhältnis reden …«, sagt sie.
Ich habe mich immer davor gefürchtet, dass alles auffliegt. Weil es mir peinlich ist. Obwohl ich das Richtige getan habe. Aber eine Folge dieser vermeintlichen Richtigkeit ist ein Aktenordner. Und ein Tribunal.
»Es lag in der Luft«, entgegne ich und meine natürlich nicht meine erwartete Kündigung und die hierfür einberufene Zusammenkunft. Bis alle Anwesenden nicken. Weil heute nämlich auch der Tag ist, an dem einer dieser äußerst beliebten Fußballtrainer um seine Entlassung gebeten hat, und alle sprechen davon. Sekündlich gibt es hierzu neue Eilmeldungen. Ich reibe meine Hände und rieche dabei einen merkwürdigen Geruch, obwohl ich mir die Flossen vor dem Gespräch noch gewaschen habe. Wie ein Radiergummi, denke ich, und reibe mir weiter die Hände und überlege, ob es von der Rolltreppe gewesen sein könnte.
»Manchmal ergibt sich alles von selbst …«
Mir gegenüber sitzt einer der Seniorbesitzer, außerdem wie immer eine seiner Töchter, die irgendwann mal das Sagen haben könnte, wenn sie denn wirklich will, und ansonsten jemand vom Betriebsrat, der aber nicht sprechen darf. Oder möchte.
Und es geht um meinen Vertrag.
»Wie haben Sie sich das denn vorgestellt, Herr Kisch? Wie soll es zukünftig weitergehen?«
Sie hat sich gut vorbereitet, die Erbin. So, wie man das wahrscheinlich lernt in Management-Seminaren. Also blättert sie in einer großen Mappe mit diversen undefinierbaren Einlegeblättern, verschenkt ein sanftes Lächeln, fast schon transzendent, und blickt abrupt nach oben.
»Keine Ahnung …« Ich habe ein Buch geschrieben, das in der Branche für einen gewissen Wirbel gesorgt hat, und sie sorgt sich vor allem darum, dass dieser Wirbel möglichst bald wieder verebbt.
Verständlicherweise.
»Hätte ich einen Plan«, sage ich, »dann würde ich nicht hier sitzen.«
»Okay …« Langgezogen, mit der Betonung auf dem letzten Ton.
Der Alte schweigt auffällig lange, als wolle er die Stimmung nicht zerstören, und auch er blättert mit ziellosen, langfingrigen Bewegungen in seinen Unterlagen. Augenblicklich wächst in mir der Wunsch, mir wieder die Hände zu waschen, was wohl an dem undefinierbaren Gummigeruch liegt, aber auch an dieser Blätterei, und an einer jahrelangen Angewohnheit. Pausenloses Händewaschen, sobald es unerträglich langweilig wurde in dem Möbelhaus, oder auch angespannt, erst einmal Händewaschen, denke ich. Um kurz rauszukommen. Durchzuatmen. Aus der Langeweile heraus: Händewaschen. Weil es sonst nichts zu tun gab.
»Wir werden schon eine Lösung finden …«
Es herrscht eine freundliche Atmosphäre, wie man zu sagen pflegt. Wir alle sind freundlich. Weil alles klar ist, alles gesagt ist, aber gleichzeitig steht so eine Ernsthaftigkeit im Raum. Wie Schweißgeruch.
»Ich gehe davon aus, dass wir so etwas finden …« Fast wie bei einer Beerdigung, denke ich. Aber wie bei einer Trauerfeier, wo man dem Verblichenen nicht besonders nahesteht.
»Wir möchten Ihnen einen Vorschlag machen …«, sagt der Alte.
Jedes Wort ist mit Bedacht gewählt. Wir alle sind bemüht, unsere Worte mit Obacht zu meißeln. Ein bisschen Abfindung, ein bisschen Gutwilligkeit auf beiden Seiten, das Übliche. Der entscheidende Unterschied zwischen unseren Positionen ist, dass ich nichts mehr zu verlieren habe. Was soll mich denn noch schocken? Die angedrohte Kündigung? Der verlorene Ruf?
Und der zweite Unterschied besteht darin, dass ich keine Lust mehr habe, hier zu sitzen.
Ich schaue nach vorne.
Heute ist der Tag meiner Kündigung.
Ich würde am liebsten gar nichts sagen. So ein Schweigen, das die Verzweiflung aufzwingt, um ihre Macht zu demonstrieren.
Ich schaue nach unten. Atme. Und plötzlich steht mir klar vor Augen wie nie zuvor: Dann kannst du doch auch endlich leben!
»Können wir so machen«, sage ich.
»Sehr gut!«
Der Alte freut sich. Handschlag. Ich erinnere mich plötzlich an den Weg hierher, in dieses Büro, sehe mich schreiten, bleischwer, auf dem Weg zu meiner Kündigung, als würde ich es gerade noch verstehen, abspeichern, wie etwas zum letzten Mal abläuft. Eine Kündigung ist einerseits hochgradig einschneidend, denke ich, und gleichzeitig so unglaublich albern.
»Ja, dann … alles Gute …«
»Genau … alles Gute …«
Ich fühle mich wie ein Schauspieler, mehr noch wie eine Schauspielerfigur, wie ein Gegenstand, der sich nunmehr aufbröselt. Und vom Wind zerfressen wird.
Und alles löst sich auf.
2
Was da draußen dann den Boden erzittern lässt wie ein Koloss, was sich da vor meinem geistigen Auge aufbaut, mit gusseiserner Schwere, sind die Zinken HARTZ4. Also zwinge ich mich, auf den Asphalt zu starren.
Dann kannst du doch auch endlich leben!
Ein Impuls zu gehen drängt mich vorwärts. Schnell zu gehen.
Auf dem Weg zum Parkplatz beginnt es schon, mit dem Laufen, auf dem Weg zum Auto: Plötzlich beginne ich schneller zu gehen. Ich kann nicht einfach nach Hause fahren, denke ich, sondern ich muss erst einmal rennen. Also beginne ich mit diesem unseligen Spazierengehen, mit diesem Füßewerfen, denn es ist ein Laufen, wird schnell und schneller. Zu Beginn.
Es beginnt mit diesem affigen Spazierengehen, denke ich, und spüre doch gleichzeitig, wie es mir guttut. Jeder einzelne Schritt lockert den Brustkorb, ich schaue nach unten und gehe. Und Gehen blockiert Grübeln. Tatsächlich. Gehen klärt Denken. Klärschlamm. Aber nur das schnelle Gehen, merke ich, nicht das Schlendern.
Bummeln ist Zufriedenheit, Sattheit, aber vor mir formiert sich HARTZ4, es muss also schneller sein. Und ich gehe. Und ich starre auf die Menschen vor mir. Oder auf die Autos. Nur weg von den großen Buchstaben in meinem Hirn, die mit dem »H« am Anfang, und den Folgen, also zwinge ich mich, dankbar zu sein. Ich zwinge mich, nicht darüber zu spotten, über diese Gedankenzensur, weil ich irgendwie den Koloss besiegen muss. Ich gehe.
Pilgern, denke ich, jawohl, denke ich, das werde ich machen.
Aber anders, sage ich mir, ganz anders.
Mein Pilgern ist doch auch und vor allem eine Form des Weglaufens, weil ich nicht weiß, was ich tun soll oder möchte, bevor diese Sozialhilfe mich auffrisst. Pilgern, denke ich, und mein Ziel besteht nicht darin, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern ich will wieder Hoffnung finden. Und Ruhe, in meinem Herzen.
Aber ich mag nicht über die Felder latschen. Ich kenne doch das Land, weil ich da wohnen muss, ich will nicht über die Felder rennen. Ich bin ein Städter, aus Leib und Seele. Verstädtert. Ich latsche doch nicht durch die Felder, wenn in der Metropole meine Heimat liegt. Und meine Seele. Und das Sehen und Streben der meisten Menschen.
Also gehe ich auch nicht auf ein Ziel hin, weil mein Ziel kein Ort ist. Und auf gar keinen Fall will ich nach Berlin laufen, weil es über Berlin nichts mehr, aber auch gar nichts mehr zu schreiben gibt. Ab heute, denke ich, wird kein Satz mehr über Berlin geschrieben werden.
Mein Ziel ist eine Lösung.
Also laufe ich erst einmal immer nur die gleiche Strecke.
3
Gehen. Du kannst nichts und willst trotzdem einen Platz in der Gesellschaft haben, denke ich. Einfach nur deswegen, weil du atmest und lebst und umhergehst. Aber du kannst nichts. In dieser Wüste, in dieser Steinwüste aus Einsamkeit und Hektik und aus Gleichgültigkeit und Anonymität, und dabei wird mir plötzlich klar, augenblicklich, dass ich mich bremsen muss, vor allem in meiner Sprache. Ich muss das ausprobieren, zu schweigen, sonst monologisiere ich mich nur zugrunde. Und komme doch keinen Schritt voran. Während ich gleichzeitig bis zur Besinnungslosigkeit renne, immer nur schneller renne und renne. Ich kenne das, also muss ich ruhiger werden.
Schweigen.
Als erste Aufgabe, um den Dämon Hartz 4 zu bändigen. Was vielleicht eine bescheuerte Aufgabe ist, aber in mir drin wird es tatsächlich ruhiger. Schweigen. Weil ich mit meinem Quatschen nur wieder mein Handeln vorbereiten möchte, aber es gibt momentan kein Handeln, keinen Plan, nicht mal eine Vorstellung von einer Vision. Und deshalb muss ich schweigen lernen. Um das alles loszulassen: meine Angst, meine Kommentare, mein Kritisieren, meine Welt. Loslassen. Schweigen.
Um aus meinen Worten herauszugehen.
Um damit aus meiner Angst herauszuwandern.
Und erst einmal nur schauen.
Es wird sich schon etwas finden, denke ich, aber dieses Etwas musst du schauen.
Warum hast du nicht viel mehr riskiert? Es ist doch ohnehin alles vorbei. Warum hast du mit zwanzig nicht viel mehr über das Leben gelacht? Aus dem Scheitern heraus wirkt alles so lächerlich. Warum bist du überhaupt jemals unsicher gewesen? Warum nicht viel mehr Ruhe, viel mehr Offenheit in der Sekunde, und die Bereitschaft, einen Tag verstreichen zu lassen? Warum immer alles sofort erreichen, denke ich, und warum überhaupt etwas erreichen?
4
Gehen. Schneller. Ich sehe ein Haus, das zwar aus Stein erbaut (und das vermutlich schon vor vielen Jahrzehnten), vor kurzem aber täuschend echt bemalt wurde. Jetzt wirkt es so, als sei es eine zusammengehämmerte Bretterbude. Das ist mir noch nie vorher aufgefallen. Aufgepinselte braune Holzbalken erzeugen eine perfekte optische Täuschung. Sie scheinen kreuz und quer vernagelt, auf schwarzem Stein. Eine Terrasse im ersten Stock ist folgerichtig ein Baugerüst, schön von Efeu umrankt. Du hast noch nie richtig hingesehen, denke ich, und jetzt lauf nicht gleich wieder weg. Das ist die Wirklichkeit. Ein Mann steigt in sein Auto, vor dem Efeuhaus, und er streift nach dem Einsteigen zuerst lederne Autofahrerhandschuhe über. Noch bevor er den Motor startet, in einem stolzen Gestus, als müsse er damit seinen Weltekel bannen. Nur anschauen, denn wenn ich leben will, dann muss ich erst einmal still sein. Denn ich bin fünfzig, frisch gekündigt, frisch geschieden, arbeitslos, ohne Zukunftsperspektive – also kann ich mich entweder jetzt verkriechen, abtauchen, versumpfen, umbringen …
Oder.
Lächeln, denke ich.
Ich habe keine andere Wahl. Dieses Liebespaar auf der Straße anschauen, diese Frau mit ihren großen braunen Augen, die scheinbar ohne Lidschlag offen stehen, wund beinahe, dabei aber in der Iris eigentümlich verschwommen wirken, so als wolle sie verhindern, dass man wirklich in sie hineinschaue; eine zierliche, unscheinbare Person, die aber plötzlich unglaublich zu niesen beginnt; und es zerreißt sie beinahe, ihren zierlichen Körper, und sie prustet in einer Lautstärke, dass sich die Leute auf der Straße ängstlich umdrehen. Ihr Mann dagegen hat eine Vorliebe für pathetische Gesten, legt seiner Frau unentwegt die rechte Hand auf die Schulter, und wenn er lacht, dann durchziehen abgeblätterte, goldene Füllungen die Unterseite seiner Zähne.
Lächeln, denke ich.
Nicht grinsen, nicht glotzen. Wärme.
Und Menschen suchen, die über den Dingen stehen. Einfach nur erst einmal lächeln. Wie über den Graffitikrieg an einer Fabrikwand. Letzte Woche hat da noch gestanden: JESUSISTSIEGER, das habe ich gelesen, auf dem Weg zur Arbeit. Einen Tag später hat es jemand übermalt, stattdessen: JUDASISTSIEGER hingesprayt. Dann machte jemand daraus wieder JESUS. Die Gegner wieder: JUDAS. Dann war aller Platz verbraucht, die Wand verwittert. Und es blieb nur ein Wort stehen: SIEGER.
Du hast schon als kleiner Junge nur einen einzigen Weg geliebt, denke ich: Geradeaus. Vorwärts. Von der Haustüre aus, nur noch geradeaus, unabhängig von Straßen und Vorgaben. Immer nur vorwärts. Man kann dabei natürlich um ein Haus herumgehen, das auf dem Weg liegt, aber dahinter wieder auf den ursprünglichen Weg zurück. Durch Bäche und Flüsse, immer geradeaus. Bis ins Morgenland. Nur die Himmelsrichtung wird ausgelost.
5
Ich wohne auf dem Land, also dort, wo die Welt noch in Ordnung ist, wie es heißt, also nicht wirklich dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, sondern eine Stunde hinter den Speckgürteln. Wo es zwar noch Bauern gibt, aber auch schon WLAN, Gülleduft, und auch schon Caffè Latte. Und Fitnessstudios. Und Graffitikurse im Jugendzentrum.
Ich wohne also auf dem Land, und während ich mein Verzweiflungsgehen plane und einige Sachen aus dem Auto hole und während ich vor allem noch diese Kündigung in den Knochen habe und meine Zukunft vor mir sehe, ganz, ganz schwarz, da spricht mich dieser Nachbar an und sagt, es sei noch Platz zum Bürgersteig.
»Bitte?« Ich verstehe nicht ganz, was er meint. Mir wurde vor einer Stunde gekündigt.
Er antwortet, mein Auto wäre nicht nah genug an den Bordstein geparkt. Er ist ein großgewachsener, schlanker Mann mit einer monströsen Brille auf der Nase. Die beiden Gläser scheinen das halbe Gesicht einzunehmen.
»Was ist daran so schlimm?« Ich wusste nicht mal, dass es in diesem Friedhofsviertel eine Schablone für ordnungsgemäße Parkmathematik gibt. Ich stehe dabei immer noch ein wenig neben mir, wegen der Kündigung.
»Nichts … Aber wenn ein Bus kommt oder so …«
In dieser Straße fährt kein Bus. Ich wohne auf dem Land. Hier ist noch nie ein Bus gefahren. Und selbst wenn einer einbiegen sollte, es ist mehr als genügend Platz.
Tatsache ist aber, es stört ihn. Es sieht nicht richtig aus. Der Nachbar trägt einen grünen Trainingsanzug mit altmodischem weitem Hosenbein, und er schüttelt pausenlos die Füße aus. Beinahe wie ein Sportler, der sich warm macht. Aber er läuft nicht. Und er ist unangenehm konsterniert, dass ich mich aufgrund seines Anliegens nicht sofort an das Umlenken begebe (und er spürt wohl eine leichte Feindseligkeit).
Durch diese Straße fährt aber kein Bus.
Hier ist noch nie ein Bus gefahren.
Es geht ihm einzig darum, dass meine Reifen nicht bündig an den Asphalt anschließen, denke ich, das bewegt ihn.
Und mich auch.
»Nein …«
Er starrt scheinbar ins Leere. Ein Blick, als ob er seinen Geist ans zunehmend dunkle Firmament andockt, sich dort auflädt und heimlich einen Schwur ableistet. Und ansonsten mal eben seine Seele verkauft, um diesen Schwur erfüllen zu können.
Ich parke aber trotzdem nicht um.
6
An den Kölner Dom fahre ich als Erstes. Hier will ich starten, weil auch der blöde Jakobsweg nach Santiago de Compostela sich von hier aus gabelt. Außerdem treffen sich dort jeden Tag Tausende Touristen. Ich bin nämlich jetzt auch so einer, ein Pilger. Gemeinsam stehen wir also in der Sonne herum, lassen uns zärtlich bescheinen, von den letzten Strahlen, die durch die aufkommenden Wolken brechen. Den großen Jakobsweg kann ich mir ohnehin nicht leisten, das ist schon mal die erste Erkenntnis: Pilgern auf dem Land ist nur was für Wohlhabende. Dabei ist doch die Stadt meine Wüste, denke ich, meine Einöde, wo ich den Kampf mit meinen Dämonen aufnehmen muss. Weil fast alle Menschen heutzutage Städter sind.
Und ich will mir nichts anderes vornehmen, als nur zu rennen und zu schauen, was um mich herum geschieht, um mich von meiner Steinwüste an die Grenzen führen zu lassen. Nichts erreichen wollen. Denn hinter der Grenze warten nur Hartz 4 und »Ziehen-Sie-bitte-zuerst-eine-Nummer«.
Als hätte sich das Universum zu einem zynischen Kommentar entschieden, verschmelzen am Firmament inzwischen Gewitterwolken zu einer schwarzen Masse. Lautlose Blitze in der Ferne, zu Beginn, Schweißbrenner, Eisen, Assoziationen, als werde im Dunkel der Welt eine schadhafte Stelle repariert. Wind bläst über die Domplatte. Überall kramen Menschen einen Regenschirm aus der Tasche, aus ihren Rucksäcken, aber die Wassermassen sind zu stark, also drängeln wir uns unter den Boutiquendächern zusammen. Touristen aus allen Teilen der Welt. Und wir warten. Enorm, denke ich, in dieser erzwungenen Ruhe, wie viele Gedanken mir jetzt erst bewusst werden, wie viele Verknüpfungen, Ideen, Fantasien, Abneigungen, die sich pausenlos anmelden. Und die ich nicht abschalten kann.
Als Kind, erinnere ich mich, bin ich bei Regen auf mein Fahrrad gesprungen, um die Route des Stadtbusses abzufahren. Dann habe ich den durchnässten Wartenden zugerufen: »Der Bus kommt gleich!« Das klingt wahrscheinlich bescheuert, aber es machte tatsächlich viel Freude, und die Leute lächelten mir zu. Im Regen.
Heute rollen grollende Donnerschläge heiser über die Domplatte. Als Kind, im Regen, ist mir auch der alte Mann aufgefallen. Jeden Tag, vor allem wenn es regnete, stand er an den Parkplätzen am Hauptbahnhof. An der »Park&Ride«-Station. Da, wo unentwegt Frauen zu ihren wartenden Partnern strömen, und umgekehrt, oder Töchter zu ihren Vätern. Also da, wo die meisten sich darüber freuen, abgeholt zu werden.
Der alte Mann fuhr allerdings jeden Tag wieder alleine weg. Ich habe ihn genau beobachtet.
Damals war das alles eher gruselig für mich, aber heute, im Regen, kann ich ihn plötzlich verstehen. Ich würde auch gerne noch mal jemanden abholen.
Enorm, denke ich, wie viele Gedanken auf mich einprasseln, die mir ansonsten gar nicht so bewusst waren. Aber weil ich jetzt warten muss und schauen will, merke ich erst, wie es in mir schreit und tobt. Wenn ich beispielsweise das Gewitter mit Blitz und Donner beobachte, dann sehe ich die Blitze, die Schweißbrenner, aber ich höre den Donner erst einige Sekunden später. Also höre ich jetzt einige Sekunden in die Vergangenheit hinein? Und ich denke daran, wie es mich jedes Mal irritiert, wenn Fernsehbilder nicht synchron zu den Lippenbewegungen der Protagonisten geschnitten werden. Manchmal ist das auch so ein Blick in die Vergangenheit, während das Bild über den halben Erdball geschickt wird, aber manchmal ist es einfach nur Schnittschludrigkeit. Also lass es sein, denke ich, dieses Kritisieren, weil es dich nicht wegbringt von deinen Ängsten, klammer dich nicht an dieses Zeug, sondern mach weiter mit dem doofen Freuen. Einverstanden sein. Einfach nur einverstanden sein. Und damit, dass alles vorübergeht und fließt. Und es regnet.
Die Gegenwart lieben. Denn wenn ich denke, also meine Gedanken nicht lenke, nicht eingrenze, dann geht es nur um die Arbeitslosigkeit und Hartz 4, die vollständige Stigmatisierung, also muss ich auf meinen Weg achten und darf nicht denken, also nicht spintisieren, nicht denken, nicht denken.
Und das soll mich von meiner Angst befreien?
Wie kannst du dich von etwas befreien, an das du dich klammerst? Mach dir doch endlich mal klar, du Idiot, wovor dich deine Ängste schützen.
7
Hier habe ich auch mal gearbeitet, denke ich, nur wenige Meter vom Kölner Dom entfernt. Als der Regen langsam verebbt. Das ist fünfundzwanzig Jahre her. In einem Sex-Shop, ich habe die Karten verkauft, für das Porno-Kino. Und meine Angst lässt tatsächlich langsam nach. Einmal war einer da, erinnere ich mich, der war noch nie in so einem Laden gewesen. Klassischer Kegelausflug. Der Mann war klein, schmächtig und bärtig, hatte auffällig dünne Beine, einen dünnen Po, und trug trotzdem eine enge, schwarze Hose, deren Gesäßtasche herumschlabberte. »Was muss ich denn machen?« So einer mit zittriger Stimme, steht vor den Video-Kabinen, überall um ihn herum das Flackern der Bildschirme, das gekünstelte Stöhnen der Aktricen, so einer, der völlig überfordert ist. Kippt dabei pausenlos seinen Kopf nach links und rechts auf die Schulterblätter, verzieht die Mundwinkel ruckartig nach hinten, bleckt kurz die Zähne, so dass ich an ein Pferd denken musste, dem ein Reiter an der Trense zieht. Sag ich: »Sie müssen Geld in die Kabine schmeißen.« Ich hab doch schon gar nicht mehr hingesehen, wenn diese Landeier kamen. Dann so ein Scheppern. Ich dreh mich um, steht der Typ vor der Kabine und schmeißt unter der geschlossenen Tür, durch einen kleinen Spalt hindurch, sein ganzes Kleingeld nach innen. Und da drinnen saß noch ein anderer Mann, und der schreit und schreit.
Und das alles loslassen, denke ich gleichzeitig, versuchen zumindest, alles loszulassen, woran ich hänge. Um das zu erfahren, an dem ich nicht zu hängen brauche, weil es da ist. Ohne mich daran zu kletten, denke ich und erinnere mich gleichzeitig an Günter Lamprecht, den Schauspieler. Nein, er war nicht im Sex-Shop, aber es gab einen Schmuckstand davor. Der Besitzer des Stands war der Bruder des Sex-Shop-Inhabers, und deshalb durfte er seine Ohrgehänge dort anpreisen. Und deshalb verbrachte ich dort meine Mittagspause. Weil er ein witziger Kerl war. Und eines Tages stehe ich wieder draußen, mit meiner schwarzen Lederjacke, am Schmuckstand, im Verkaufsgespräch, und plötzlich schlendert Günter Lamprecht vorbei. Und schaut. Er hatte »Berlin Alexanderplatz« abgedreht, aber niemand sonst schien ihn in Köln zu erkennen. Er sieht mir in die Augen. Er schaut zweimal, als sei ich eine poetische Existenz, gewissermaßen aus dem Fassbinder-Reservoir, eine tragische Gestalt, mit dieser schwarzen Lederjacke, vor dem Schmuckstand, Fußgängerzone, Hohe Straße.
Er starrte wirklich zweimal.
Diesen Blick sehe ich bis heute. Wie er sich umdreht, mit diesen fragenden Augen, und ich bin der Einzige, der ihn erkennt.
Lächeln, denke ich.
Und genau in diesem Moment passiert etwas, was ich in diesem Moment auf der Straße noch gar nicht so recht einordnen kann (denke ich, während ich meine Notizen zusammenschreibe), denn eine Frau stellt sich einfach neben mich und sagt: »Das wird schon wieder … Es wird alles gut …«
Das ist alles.
Und dann lächelt sie.
Aber sie erweckt in mir tatsächlich eine Form von Glanz. Der sich wie ein warmer Hoffnungshauch in mir ausbreitet.
8
Ein Rucksack muss sein. Wenn ich schon pilgere, denke ich, dann mit Rucksack. Und mit Kappe. Und mit Stadtkarte. Kein Mensch hat heutzutage noch eine Karte, die er mühselig aufklappt, aber ich will nicht mit meinem Handy und einer blöden Software pilgern, ich will schließlich eine Lösung.
Ich will diese Menschen suchen, denke ich, überall, die über den Dingen stehen. Und mich dadurch von Hartz 4 befreien. Weiß eigentlich irgendjemand da draußen, was ein Arbeitsloser so denkt?
Ganz entscheidend, eine Karte, die mich gleich mal definiert, als eine Art Pilger, und dann erweist sich genau dieses Faltteil als entscheidendes Detail. In dem Moment nämlich, in dem ich sie aufblättere und umständlich irgendwie drehe, steht eine freundliche ältere Dame neben mir, die alleine schon dadurch auffällt, dass sie tatsächlich ein buntes T-Shirt mit bunten Cartoon-Figuren und Sprechblasenwitzen trägt, und dazu noch eine gelbe Hose, in einem wirklich strahlenden Leuchtton, und sie fragt neugierig: »Kann ich Ihnen helfen? Wo wollen Sie denn hin«
»Ja, wenn ich das wüsste …«, antworte ich.
»Ungefähr?« Sie lutscht ein Eukalyptusbonbon und lässt es geräuschvoll durch ihren Mundraum flutschen.
»Keine Ahnung«, sage ich. »Ich habe ü-b-e-r-h-a-u-p-t keine Ahnung. Im Prinzip ist mir alles egal.«
Die Dame lacht laut auf. Als hätte sie verstanden.
»Viel Glück dabei«, sagt sie noch und verabschiedet sich. Das gefällt mir. Ab jetzt, denke ich, wird das mein Prinzip: Karte und Ahnungslosigkeit.
Damit habe ich auch mein Pilgerziel gefunden: Nicht einen Ort will ich erreichen, sondern ich möchte jetzt jeden Tag so ein Erlebnis finden, ich will etwas spüren.
Also warten.
Und setze mich auf eine Bank. Und gähne. Und bohre mich gedanklich in diese Müdigkeit hinein, weil ich mir sage, du musst heute nicht mehr arbeiten, du darfst jetzt müde sein, einfach nur müde. Nichts machen, nichts erreichen. Einfach nur hier sitzen. Nichts darstellen, nichts planen. Ich sitze hier. Stille in mir. Staunen.
Und dann fällt mir mein altes Büro ein, hier um die Ecke, und ich suche das Vorhängeschloss vor dem Mülleimer, vor dem ehemaligen Gemeinschaftsbüro, das auch nach so vielen Jahren mit der gleichen Zahlenkombination gesichert ist. Ein schönes Gefühl, mal eben beiläufig eine große Mülltonne zu öffnen, in einer fremden Stadt, um ein Taschentuch hineinzuschmeißen.
9
Am dritten Tag sehe ich die Immergleichen.
Das geht schnell, wenn ich bei meiner Rastlosstrecke bleibe. Ohne Abweichung die Fußgängerzone hindurch, am Neumarkt entlang, bis ich die Ringe erreiche. Am dritten Tag entdecke ich dort Muster, und zwar immer die gleichen Menschen, die ebenfalls dort gehen, jeden Tag, und zwar wirklich jeden Tag. Mit dem kleinen Unterschied allerdings: Sie schlendern.
Für einen zufälligen Passanten sind das genau die Menschen, die ein Straßenbild ausmachen. Eine beliebige Zusammenballung zufälliger Existenzen.
Aber ich entdecke langsam die Strukturen dahinter.
Und die Immergleichen laufen nur hin und her. Sie laufen gegen die Zeit.
Zuerst die beiden Frauen, die sich täglich zum Spaziergang treffen und dabei ihre Schoßhündchen auf dem Arm tragen. Umweht von Einsamkeit. Aber das ist der Vorteil der Großstadtwüste, auf einer Pilgerreise, denke ich, weil diese Einsamkeit plötzlich so deutlich abstrahlt und mich dadurch öffnet. Nur die Einsamkeit macht das möglich, und die Stille, in all dem Straßenlärm. Und dann entdecke ich Herrn Fliege wieder. Das ist nicht sein richtiger Name (davon gehe ich zumindest aus), trotzdem nenne ich ihn so, weil er nun mal keine Krawatten, sondern stets gemusterte Querbinder in unterschiedlichen Größen trägt. Und er trinkt jeden Tag um diese Zeit in einer Frittenbude seinen Morgenkaffee. Das ist keine schöne Atmosphäre, aber er hat damit vor zwanzig Jahren begonnen, habe ich inzwischen erfahren, weil die Frittenbude neben seiner Wohnung liegt. Er ist damit einer von vielen alten Menschen, wie mir aufgefallen ist, die in irgendwie unpassenden Läden Stammgäste geworden sind. Um Kaffee zu trinken. Und zu quatschen.
»Auch wieder da«, begrüßt er mich. Er ist Witwer, alleinstehend. Allerdings spricht er immer in der Gegenwartsform von seiner Frau. Wer Herr Fliege nicht kennt, muss davon ausgehen, er sei ausnahmsweise heute mal alleine unterwegs.
»Ich habe meine Route«, antworte ich. Und er will nie mehr darüber wissen. Was ich zu schätzen weiß.
»Wenn ich meine Route mit dem Auto fahre«, sagt er, »dann lege ich den Gurt nicht mehr an.« Er ist ein Gentleman, immer gut gekleidet, das muss ich ihm lassen, aber irgendwie entwickelt er unterschiedlich starke Schweißränder unter dem Hemd. Rechts stärker als links. »Dafür blinkt dann ein Symbol im Auto«, sagt er, »und das Blinken wird mit jedem Meter durch einen lauten Sirenenton unterstützt. Aber das nehme ich in Kauf.«
Anschließend erzählt er mir noch, wie jeden Morgen, von seinen Blutegeln. »Das ist eine Lebensphilosophie«, sagt er. Er besorgt sich die Viecher inzwischen sogar bei einem Händler. Und steckt damit in einem angeblichen Dilemma, weil er doch ein überzeugter Tierfreund ist. Denn nach der Therapie weigert er sich, die Egel einfach wegzuschmeißen. Also wohin damit? Jetzt pflegt er die Viecher bis zum nächsten Einsatz. Manchmal setzt er sie vorsichtig in der Nähe eines Baches aus. Umgekehrt aber hat Herr Fliege eine Insektenphobie. »Mücken, Malaria!« Da kriegt er absolute Panik. Auch in Hotelzimmern packt der Mann sein Zelt aus, mitten auf dem Bett. Nur ohne Heringe im Boden.
Aber all das ist eine wertvolle Lektion. Denn um wirklich schweigen zu lernen, muss ich erst einmal versuchen, die Klappe zu halten. Als ob ich aus der Welt aussteige, von außen nach innen, aus dem Plapperschweigen in das Gedankenschweigen. Tief hinab, wo das Schweigen in mir wohnt.
»Bis morgen«, sage ich und suche weiter nach den Immergleichen. In der Gegenwart leben, denke ich, das muss mein oberstes Ziel werden. Denn wenn ich mich auf die Zukunft beschränke, auf diese Düsternis, dann vergebe ich mein Leben. Weil sie nicht da ist, die Zukunft, sie ist niemals da. Aber ich lebe am Leben vorbei und schlage immer nur anderswo auf als dort, wo ich bin. In meinen Sorgen.
»Paule …«, sagt die Katzendame, nur wenige Straßen entfernt. Wie offensichtlich jeden Mittag. »Paule …«, krächzt sie monoton. Jeden Tag um diese Zeit macht sie einen Spaziergang mit ihrem alten Kater, habe ich inzwischen erfahren. Er schleicht und schlurft durch die Wohnung, ist krank, und traut sich nur noch mit seinem Frauchen auf die Straße. Und tapst wie ein Hund neben ihr her. Ohne Halsband.
Deshalb will ich mein Schauen, mein Herz, genau in diesen einzigen Augenblick legen. Weil er jetzt da ist: Gegenwart. Und wenn ich mein Herz in diesen Moment legen kann, denke ich, dann binde ich dort auch meine Aufmerksamkeit. Denn wenn ich nur in die Gegenwart schaue, aber mich nicht dafür interessiere, dann wird mein Bemühen mich nicht weiterbringen.
Raus aus meinen Sorgen.
Umgekehrt, frage ich mich, würde es mich interessieren, ob ich damit inzwischen nicht langsam auffalle, mit meiner affigen Rennerei. Und diesem Starren.
Aber ich traue mich nicht zu fragen.
Um mich herum grüßen sich derweil die Gastronomen aus dem Viertel mit erhobenem Arm, ruckartig, fast schon verboten, und gleichzeitig gesenktem Kopf. Aber sie sprechen keinen Ton miteinander. Und sie begrüßen nur ihresgleichen, wie Angehörige einer Untergrundorganisation.
10
Den Beginn der Mittagszeit eröffne ich damit, dass mir die gesammelte Häufigkeit von Kaugummiresten vor Kneipen und Geschäften bewusst wird. Ich bin regelrecht zum Kaugummi-Fachmann geworden in den letzten drei Tagen. Weil meine Sorgen tatsächlich wegschmelzen.
Meine Lieblingskaugummistelle befindet sich an einer Häuserwand am Stadtpark. Früher, kann ich mich erinnern, war hier nur Stein, vielleicht mal ein verlorener Abdruck. Inzwischen aber ist es anscheinend ein Ritual geworden, dort nach der Sauftour einen Kaugummi in die Reihe zu kleben. Jetzt pappen an der Stelle schon Tausende Speichelsteine, fein säuberlich angeordnet, in exakten Reihen. Sie trocken unterschiedlich, in vielen Farbschattierungen.
Ohne Ziel laufen, einfach schlendern, schauen, verlangt ein anderes Atmen, merke ich.
Tiefer atmen, denke ich, manchmal bewusster, um schwer zu werden. Tonnenschwer. Um nicht an meinen Gedanken, wie ein Gasballon, nach oben zu fliegen.
Das Ende der Mittagszeit wiederum bringe ich damit zu, mir eine bemerkenswerte Geste zu merken. Die mir erst dann so richtig bewusst wird, nachdem ich selber »Teil der Bewegung« werde. Sie besteht aus Männern in der Mittagspause, gut gekleidet, aber auch Handwerker sind darunter. Sie alle kommen zum berühmten »Gulasch-Laden« und fummeln sich anschließend, auf der Straße, die Reste aus den Zähnen.
Inzwischen habe ich ohnehin die Vorstellung, dass alle Menschen, die jetzt an mir vorbeilaufen, irgendetwas essen. Ob nun Eis oder Döner oder Sonnenblumenkerne. Zumindest ein Kaugummi. Inzwischen kann ich allerdings auch nicht mehr flott argumentieren, was mein ganzer Gegenwartswahn konstruktiv, wie es heißt, also produktiv bringen soll. Vielleicht ist das alles zwecklos? Aber was bringt es mir, denke ich, stattdessen den ganzen Tag im Internet zu verbringen? Aktionismus vortäuschen, bei Stellenportalen? Oder in einem Café zu schmollen. Was bringt es mir, den ganzen Tag herumzuhetzen, auf der Suche nach einer möglichen Beschäftigung? Befriedigung? Was bringt es mir, über das Auf und Ab in meiner Biographie zu spekulieren? Mit fünfzig Jahren, arbeitslos, gekündigt. Gar nichts. Deshalb bin ich so versessen auf den Augenblick. Auf das Schweigen. Denn wenn etwas angeblich nichts bringt, dann meint man doch: kein Geld.
Dann würde ich aber auch nicht nach oben schauen. Und dort, über meinem Kopf, an allen vier Ecken eines Baugerüstes, sitzt jeweils eine unbewegliche Taube. Die grauen Wesen wirken wie jahrhundertealter Stuck. Dunkel und herrisch. Und dämonenhaft. Das ist Schönheit, denke ich, lächeln, und Schönheit ist völlig überflüssig. Komplett nutzlos. Wie alle wunderbaren Dinge im Leben: Völlig bescheuert, kostenlos, und überflüssig. Der ganze Kosmos ist doch nichts weiter als eine grandiose Ansammlung völlig überflüssiger Unglaublichkeiten. Seit Milliarden Jahren. Wollen wir den Wert der Milchstraße in Aktienkursen abschätzen? Sollen wir an Pluto einen Preiszettel befestigen? Nur das Nutzlose, denke ich, verdient meine ganze Aufmerksamkeit. Der sogenannte Ernst des Lebens drängelt sich schon von alleine in den Vordergrund. Nur die Schönheit, denke ich, in all ihrer Überflüssigkeit. Und das mit allem Nachdruck.
Loslassen, denke ich. Da wartet ansonsten nur Hartz 4, genau vor dir, also loslassen. Weglassen. Auch das Koordinatensystem, um das meine Ansichten kreisen, alles Denken, Fühlen, Wollen. Ich spüre es doch, mit dem Moment, in dem ich mich auf den Irrsinn der Schönheit einlasse, auf den Irrsinn der Überflüssigkeit, wärmt mich wieder dieser Glanz. Und wärmt den ganzen Körper. Und wandelt sich, osmotisch, wie Parfumduft, in diese Straße hinein, in diese Stadt, in die Welt hinaus. Das muss so sein, denke ich, denn ohne Pathos kann ich mich gleich beerdigen.
Wieso kann ich mich eigentlich beim Denken beobachten?
Ich und du
1
Erlangen ist eine interessante Stadt. Nicht sonderlich groß, nicht überragend schön, aber irgendwie geben die sich hier in Mittelfranken überdurchschnittlich intelligent. Angeblich existiert in Erlangen die größte Dichte an Gymnasien in Deutschland, Siemens zentriert sich deutlich sichtbar um Hochschule und Forschung, und weil die Schlüsselindustrie sich beteiligt, ist es auch noch eine der vermögendsten Städte der Republik. Und ich komm da an, mit meiner Angst vor Arbeitslosigkeit. Na ja, eher mit einigen Fragen zum Gehirn. Das andere ist mir zu peinlich.
Hier will ich Professor Manfred Spreng treffen, den ehemaligen Leiter des Instituts für Physiologie und experimentelle Pathophysiologie in der Arbeitsgruppe Biokybernetik, einen Doyen der Hirnforschung. Einen, der wirklich über den Dingen steht (und der eine solche Einschätzung selbstverständlich ablehnen würde). Auf dem Weg dahin werde ich aber erst noch gewarnt.
»Vorsicht!« Ein energischer Einwurf einer jungen Leinenträgerin an alle Passanten, die ihren süßen Welpen streicheln wollen. »Vorsicht … der Hund küsst!« Blitzschnell fährt die Hundezunge heraus und leckt den Leuten über das Gesicht.
Das ist ein Einstieg, denke ich.
Seit über dreißig Jahren wohnt Herr Spreng in dem anliegenden Haus, erfahre ich bei Kaffee und Keksen, und drei Kinder sind hier groß geworden. Er ist eine freundliche, fast schon schüchterne Persönlichkeit.
»Sie können auch Saft haben.« Weit entfernt von professioneller Journalistenbetreuung. Angenehm.
Die Kekse erinnern mich an meinen Bruder, der früher nie Rosinenbrot essen wollte, wenn es auf dem Tisch stand. Die Augen auf den Rosinenbroten starrten angeblich immer so komisch.
»Sie haben Nachrichtentechnik studiert?«, frage ich zu Beginn, ein Begriff, der noch aus einer früheren Epoche zu stammen scheint. Denn das Spannende ist, dass Manfred Spreng als zusätzlich studierter Mediziner den Beginn des digitalen Zeitalters mit geprägt hat. Er weiß noch, wie die Dinger früher aussahen, die heute in jedem Handy aufleuchten und mitunter nerven, und ohne die nichts mehr zu gehen scheint. Als ein Computer noch locker die Größe eines Wohnzimmers in Beschlag nahm.
Damals war die sogenannte »Kybernetik« eher ein Randbereich.
Heute ist aus dem Anfangsbuchstaben ein amerikanisiertes »C« geworden. »Heute ist alles irgendwie cyber«, sagt er belustigt, dabei ist Kybernetik nichts anderes als die Lehre von der Steuerung und Regelung, sowohl in Menschen als auch in der Maschine. Denn in der Maschine kann nichts anderes sein als in unserem Gehirn vorgegeben. »Wir projizieren ja weitgehend das hinaus, als Techniker, was uns im Gehirn vorgegeben ist. Und die komplexe Regulation in einem Organismus ist hochinteressant.« Man kann grundsätzlich Krankheiten als Kybernetopathie bezeichnen, also als Störung von Regulationen.
Da gehen wir doch direkt in die Vollen.
»Das Gehirn ist nichts anderes als ein Computer?«, frage ich, vielleicht ein wenig provokant.
»Die Parallelen sind in der Tat gegeben, und das hat mich auch damals besonders interessiert, so dass ich mich nicht im technischen Bereich engagiert habe, sondern im physiologischen Bereich, wobei mir meine Kenntnisse in der Computerwissenschaft sehr geholfen haben. Damals, in den sechziger Jahren, musste man seinen Computer noch weitgehend selbst entwickeln und zusammenbauen, löten.« Mittlerweile eine eher amüsante Anekdote, aber damals war der private Besitz eines Computers noch undenkbar. Es gab ohnehin nur Monsterkästen von IBM, in Großbüros, bei Statistikämtern, zur Datenverarbeitung. Nicht einmal in kleineren Universitäten standen Computer zur Verfügung. »Damals kamen die Amerikaner nach Erlangen, um sich gewisse Dinge abzugucken. Man pilgerte noch nicht nach Amerika.«
Unpassenderweise stören meine Schuhe. Sie sind alt und piksen innen im eingetrockneten, verschrumpelten Fußbett. Um das Sticheln zu verhindern, verlagere ich deshalb bei jedem neuen Gedankenschritt das Gewicht meiner Füße.
»Der Computer kann keine Schlüsse ziehen«, setzt Herr Spreng seinen Gedanken fort. »Der Mensch dagegen kann aus einem Bereich, den er gerade bearbeitet oder bedenkt, in einen völlig anderen Bereich springen. Der Computer ist allerdings desto besser, über je mehr Informationen und Wissen er verfügt, aber er schlussfolgert nicht. Und er kann auch nicht in Zusammenhängen denken.«
Das gefällt mir. Assoziationen sind einem Computer fremd sowie Allgemeinbildung. Oder wenn mir ein bestimmter Name nicht einfällt, ich mich aber daran erinnern kann, dass ich diese Person einmal vor einer Sparkasse getroffen habe, während es regnete und eine schöne Frau in einem Buch las und dabei noch drei Vögel hintereinander herflogen und ein Bus durch eine Pfütze beschleunigte – und plötzlich fällt mir wieder der Name ein. Diese Art von chaotischer Zielführung kann ein Computer nicht begreifen.
»Wenn Sie in einem Zimmer sitzen und ein Buch lesen und die Standuhr tickt«, erläutert der Hirnforscher, »dann hören Sie das Ticken. Aber nach einer gewissen Zeit hören Sie das nicht mehr, wenn Sie sich auf das Buch konzentrieren. Das hat etwas mit Aufmerksamkeitssteuerung zu tun. Auch ein entscheidender Unterschied: Das menschliche Gehirn kann sofort sagen, das Ticken bringt keine Information, das Buch ist mir wichtiger. Also widme ich die beschränkte Kapazität, die ich habe, dem optischen Kanal und drossle den auditorischen Kanal. Ein Computer kann das nicht aus sich selbst.«
Wir sitzen dabei vor dem großen Fenster im Wohnzimmer, und ich erinnere mich, dass Fenster in meiner Kindheit eine große Rolle für mich gespielt haben. Nach der Schule habe ich mit zwei Freunden versucht, Bierdeckel in angelehnte Küchenfenster zu zirkeln. So etwas konnte ganze Nachmittage ausfüllen. Und gegenüber der Schule, im obersten Stockwerk des Nachbarhauses, stand manchmal eine schwarzhaarige Frau und sah aus dem Fenster hinunter in die kleine Stadt, während sie sich dabei kämmte und eincremte. Sie kam sich vollkommen unbeachtet vor. Die Kleinstadt scheinbar zu Füßen. Ohne die leiseste Ahnung, dass dort gerade drei Schüler den Verstand verloren. Während eine andere Nachbarin, genau ein Stockwerk darunter, manchmal um diese Zeit ihre Fenster putzte. Sie zog die Gardinen zur Seite und ließ dadurch einen Blick auf ihre riesige, lichtdurchflutete Wohnung zu. Es wirkte irgendwie brutal, erinnere ich mich, beinahe obszön. Diese riesige Wohnung, so offen. So verwundbar.