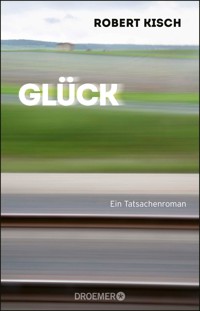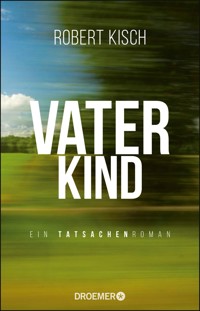
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Tatsachenroman über das neue Rollenverständnis alleinerziehender Väter von Robert Kisch, dem gefeierten Autor des Romans Möbelhaus. Er ist das Scheitern gewöhnt: Erst hat er seinen Job als Journalist verloren, trotz diverser Preise und Auszeichnungen. Dann seine Anstellung im Möbelhaus, und dazu noch seine Frau. Seinen Sohn aber, den will er nicht verlieren, auf keinen Fall! Wie das gehen soll, wenn Mann das eigenen Kind nur alle 14 Tage sehen darf und um jedes bisschen Teilhabe am kindlichen Leben kämpfen muss, weil bei Arzt, Kindergärtnerin und Co. ohnehin die Mutter als natürlicher Ansprechpartner gilt, darüber schreibt Kisch gewohnt brillant und mit entlarvendem Blick auf eine Gesellschaft, die den Kindern fast unbedarft eine Hälfte des Glücks verwehrt: ihre Väter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Robert Kisch
Vaterkind
Ein Tatsachenroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Tatsachenroman über das neue Rollenverständnis alleinerziehender Väter von Robert Kisch, dem gefeierten Autor des Romans Möbelhaus. Er ist das Scheitern gewöhnt: Erst hat er seinen Job als Journalist verloren, trotz diverser Preise und Auszeichnungen. Dann seine Anstellung im Möbelhaus, und dazu noch seine Frau. Seinen Sohn aber, den will er nicht verlieren, auf keinen Fall! Wie das gehen soll, wenn Mann das eigenen Kind nur alle 14 Tage sehen darf und um jedes bisschen Teilhabe am kindlichen Leben kämpfen muss, weil bei Arzt, Kindergärtnerin und Co. ohnehin die Mutter als natürlicher Ansprechpartner gilt, darüber schreibt Kisch gewohnt brillant und mit entlarvendem Blick auf eine Gesellschaft, die den Kindern fast unbedarft eine Hälfte des Glücks verwehrt: ihre Väter.
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
1
Es gibt eine zweite Begegnung. Nach jeder Trennung.
Erstaunlicherweise meist in kurzem Abstand danach.
Lisa fällt mir zum Beispiel ein, wir hatten uns fünf Tage nicht gesehen, auf ewig getrennt, aber ich erkannte ihr Lachen im dunklen Kino sofort. Bei jedem Gag, neunzig Minuten lang; ununterbrochen. Wir saßen nur zwei Reihen voneinander entfernt: Ich in würgender Anspannung und verschwitzter Fluchtposition, während sie lachte und in einer Popcorn-Packung wühlte, aus der sie mit meditativer Bedächtigkeit knusprige Steinformationen sortierte, die sie übertrieben deutlich zerkaute.
Aber mich beschäftigt zurzeit mehr noch eine mögliche, schicksalhafte dritte Begegnung, und zwar die nach längerer Zeit.
Ich habe nämlich auch Charlotte wiedergesehen (zweite Begegnung). Heimlich. Sie hat mich nicht registriert. Ich denke immer wieder an sie, schreibe immer wieder darüber, nach unserer Zeit in Marburg, und ich kann sie nicht vergessen.
Charlotte trug ein buntes, ornamentreiches Kleid, ungewöhnlich eigentlich für sie, und passend dazu eine Handtasche, die mit dem gleichen Stoff bezogen war. Sie parkte ein Fahrrad mit Kindersitz auf dem Gepäckträger an einem mehrstöckigen Gebäude, das vollständig von einem Baugerüst und Kränen umgeben war. Gegenüber eine alte Kirche; die Glocken läuteten. Und irgendwie saugten und filterten die Bleche und Metalle der Umzäunung den Glockenklang an und wandelten ihn in asiatisch anmutende Bambusflötentöne. Wie ein Traumfänger im Wind. Dabei rutschte mir plötzlich auch noch meine Armbanduhr abwärts, bis aufs Handgelenk. Früher, als ich noch eine Uhr mit einem Metalldruckverschluss getragen habe, ist mir das häufiger passiert, weil ich einerseits dünne Handgelenke habe, andererseits der Verschluss dauernd versagte.
Es war schön.
Ihre Schwangerschaft hat uns auseinandergebracht.
Ein Kind verändert alles.
Ich muss immer wieder an diese Begegnung mit Charlotte denken, weil ich soeben Felix übergeben habe, wie es so schön heißt. Nein, gar nicht schön. Die Stille danach ist grausam. Die Leere.
In dem Moment, als ich den Wagen starte, höre ich eine Feuerwehrsirene. Möglicherweise auch einen Polizeiwagen. Felix achtet immer genau auf den Klang und kann exakt vorhersagen, ob gleich ein Polizei- oder ein Krankenwagen um die Ecke fährt. Manchmal rennt er auch zum Wohnzimmerfenster und beobachtet den Weg der Sirene. All das vermisse ich jetzt.
Ich fahre in meine Wohnung zurück, weg vom Haus seiner Mutter, und bilde augenblicklich aus ungewöhnlichen Autokennzeichen Sätze, so wie ich das normalerweise gemeinsam mit Felix mache, wenn wir zusammen unterwegs sind. Und augenblicklich halte ich auf dem Parkplatz des örtlichen Bekleidungshauses nach vertrauten Autos Ausschau, die hier täglich parken, weil ihre Halter in dem Haus arbeiten. Das ist auch so ein Papa-Sohn-Spiel.
Und falls ich es bis dahin immer noch nicht begriffen hätte, dass ich wegen Felix weit abseits der Metropolen in der Provinz gelandet bin, dringt aus einem Fenster das Klappern einer Schreibmaschinentastatur. Das beinahe archetypische Klingeln, das Ratschen am Zeilenende; rhythmisch. So weit weg, denke ich, dieses Geräusch und dieser Ort, und dann doch noch so vertraut. Aber völlig entfernt. Völlig absurd. Das Gefühl, dass sich doch noch jemand um sein Leben schreibt.
Im Prinzip ist das ein Liebesroman.
Aber was ist Liebe?
An dieser Stelle lachen Zyniker vermutlich zum ersten Mal. Was für ein Hohlkopf! Aber es beschäftigt mich tatsächlich. Ernsthaft.
Wenn ich an Charlotte denke, wie so oft, dann erinnere ich mich an dieses besondere Gefühl, beim Küssen, ich erinnere mich an die besondere Schwärze einer Nacht, irgendwo in Bayern, umzingelt von Tausenden Sternenklecksen, auf einem gefährlich morschen Holzsteg, während ich, eingepfercht zwischen schlierigem Mond, oben, und Nebelschwaden aus dem Fluss, zu unseren Füßen, abwechselnd ihre warmen Augenlider und ihre nieselkalten Wangen küsste. Jeder Blick, jeder Gedanke war dabei scheinbar versiegelt, irgendwie in diesen Moment verschweißt. Auch wenn wir miteinander schliefen, miteinander alberten, Pläne schmiedeten, nur alleine Kaffee tranken, fühlte ich mich herausgestanzt aus der Gegenwart. Ihre Postkartenmarotte, erinnere ich mich. Wenn sie Postkarten aus fremden Briefkästen fischte, um eigene Kommentare darauf zu kritzeln und dann wieder einzuwerfen. So vieles.
Aber ich habe auch mit anderen Frauen Kaffee getrunken. Ohne mich zu erinnern. Und ich habe auch mit anderen Frauen geschlafen. Und viele Marotten beschrieben.
Und Charlotte ist nicht die Mutter von Felix.
Aber es geht nicht um das Kennenlernen, nicht um das Besondere, in diesem speziellen Liebesroman, sondern nur um den Alltag. Und um die Frage, wie ich diese Liebe erhalten kann.
Wie kann ich es schaffen, Felix ohne Trauma großzuziehen? Ohne das Trauma der Scheidung, all den ganzen Mist. Was ist das Richtige für ein geliebtes Kind. Darüber kann man erbittert streiten. Könnte man. Ich mag nicht. Denn das Richtige gibt es nicht, behaupte ich mal.
2
Ich habe eine Anzeige aufgegeben. Ich will eine Katze verschenken.
Natürlich will ich das überhaupt nicht. Ich besitze nicht mal eine. Deshalb muss ich mir ein Vieh vom Nachbarn borgen, was allerdings kein Problem ist. Sie streunt ohnehin ständig durch den Hausflur.
Aber ich will nicht mehr alleine sein.
Meine Gespräche mit Carsten über seine Rolle als Hausmann, die ich für dieses Buch aufzeichnen möchte, gestalten sich leider schwierig, weil sich seine Partnerschaft derzeit schwierig gestaltet. Weil die Kinder aus dem Haus gehen.
Carsten hat mich wieder einmal versetzt, also komme ich auf blöde Ideen und gebe Annoncen auf. In der Zeitung steht ansonsten ein Bericht über eine Studie aus Amerika, wonach Schüler und Studenten heutzutage verhaltensauffälliger seien als ihre Altersgenossen vor siebzig Jahren. Bereits seit den 1930ern messen dortige Wissenschaftler anhand eines Tests psychische Auffälligkeiten. Und junge Menschen heutzutage seien nicht nur narzisstischer, egozentrischer und antisozialer, sondern auch besorgter, trauriger und unzufriedener. Mehr noch: dieses seelische Ungleichgewicht sei die neue Norm. Während es den meisten vor sieben Jahrzehnten wichtig gewesen sei, ein reifer Mensch zu werden, moralische Werte zu stärken und ein sinnvolles Leben zu führen, strebten die heutigen Jugendlichen vor allem danach, einen möglichst imposanten sozialen Status durch ein hohes Einkommen und gutes Aussehen zu erlangen.
Wo aber Statusgewinn und Eigensicherung die herausragenden Ziele sind, kann man sich nicht mehr auf andere verlassen. Das Einzige, das man dann noch miteinander gemein hat, ist die Angst. Davor, abgehängt zu werden, Letzter zu sein. Auch in Deutschland, lese ich, lässt sich belegen, dass der soziale Zusammenhalt rapide schwindet. Konkurrenz- und Leistungsdruck, Vereinzelung und Ungleichheit: All das habe die Menschen zutiefst verunsichert.
Der Kaffee schmeckt mir nun auch nicht mehr. Ich schütte den braunen Bodensatz in meine Fensterbankblumen (und bilde mir tatsächlich ein, es gehe ihnen besser, seitdem ich diese Koffeinkur betreibe; ohne Wasser).
Also noch einmal: Wie kann ich es schaffen, Felix ohne Trauma großzuziehen? Ohne das Trauma der Scheidung, all den ganzen Mist.
Sich zu trennen, das ist einfach. Hat wahrscheinlich jeder schon mindestens einmal gemacht. Zack. Weg. Ich erinnere mich nur zu gut, wie Lisa sich mit einer SMS verabschiedet hat. Kein Wort mehr anschließend. Ich hatte allerdings von ihrer Schwester erfahren, dass sie seitdem einen deutschen Popsong inhalierte. Diesen melancholischen Mollmatsch. Von morgens bis abends. Ich fuhr wenige Tage später in einem Taxi und hörte plötzlich dieses Lied, dürftig leise und durch atmosphärisches Rauschen gestört – aber ich lauschte dem doofen Text, als sei er ein buddhistisches Mantra. Nur gebracht hat es mir nicht allzu viel. Also: Trennung ist normal – aber Eltern zu bleiben, darin besteht die Kunst. Nicht alle Brücken hinter sich abzubrechen, sondern ein Leben lang für die Kinder zu sorgen. Gemeinsam. Mein Gott, das ist mehr als ein Eheversprechen.
Aber ich will es versuchen, denn ich war die treibende Kraft beim Kinderwunsch, nicht Ulrike. Ich war schon zweiundvierzig Jahre alt, als ich sie kennenlernte, und sah meine letzte Chance (nach Milenas Fehlgeburten), doch noch Vater zu werden. Und ich wollte das erleben. Also muss ich mich dazu zwingen, meine Gefühle abzubinden, nach der Trennung, und mich allein auf das Wohl von Felix zu konzentrieren.
Dabei kommt mir plötzlich eine schräge Idee für eine Kurzgeschichte, von der ich nicht weiß, ob sie funktioniert. Ein junger Mann gewinnt eine Traumreise für zwei Personen. Er ist aber Single, weitgehend auf sich allein gestellt, hat kaum Freunde. Und entführt deshalb eine Frau …
Das Stigma »Scheidung« sei verblasst. Heißt es. Aber das denken und betonen nur Geschiedene. Betone ich. Als ich nämlich selber noch verheiratet war und damit von Verheirateten umgeben, galten Geschiedene selbstverständlich als gescheitert. Natürlich hinter vorgehaltener Hand. Vor allem diejenigen, die nicht unmittelbar wieder glücklich, also ansatzlos wieder liiert waren, wurden selbstverständlich aussortiert. Nicht von mir. Ehrlich. Aber es ergab sich so. Deshalb finden sich auch so selten Fünfträder bei den üblichen Gartenfesten und Geburtstagssonntagen. Es sei denn, es sind Nachbarn oder sie laufen seit mehr als dreißig Jahren alleine herum. Ansonsten geistern wahre Horrorgeschichten bei den Verheirateten herum, von alkoholisierten Wracks nach einer Scheidung, wobei die Kinder selbstverständlich allesamt drogenabhängig und paralysiert vegetieren. Der Tenor lautet: Wir sind auf jeden Fall besser. Auch wenn wir uns untereinander abgrundtief hassen und verachten und anschreien und betrügen – wir sind auf jeden Fall besser als die Geschiedenen.
Wir sind nämlich keine Versager.
3
Felix verliert wenigstens nicht sein Zuhause. Papa geht.
Und bleibt. Zurückzugehen, nach Berlin, also einige Hundert Kilometer weiter weg verschwinden, das ist unmöglich.
Also bleibe ich auf dem Land.
In dieser anderen Welt.
Nestmodell, heißt das. Der Ausdruck soll angeblich der Biologie entlehnt sein, eine Analogie zu Vogeleltern, die ihre Brut füttern. Der Vorteil liegt auf der Hand, es ist die vertraute Umgebung für Felix, die Schule, die Freunde, und sein Papa ist auch nicht weit weg.
Aber sein Papa leidet. Hier auf dem Land.
Das wird Felix allerdings niemals erfahren.
Es ist schon erstaunlich, denke ich, dass sogenannte zerrüttete Partnerschaften, geschiedene Ehen, heutzutage eine derartige Normalität darstellen. Ein beachtlicher Weg seit dem 19. Jahrhundert, in dem die Kernfamilie als einzig achtbare Lebensform galt. Unter diesen Begriff fiel die Mutter, die in den guten alten Zeiten Haus und Herd hütete, und ein verehrter Vater, der die Brötchen verdiente. Angeblich saß eine solche Familie (selbstredend bürgerliche Mittelschicht) dreimal täglich gemeinsam am Tisch. Schule und Kindergarten waren pünktlich zum Mittagessen beendet. Kenne ich noch. Das Spielen im Hof, zwischen den Wohnhäusern, mit einer Armada von Kindern, und später riefen wir laut nach unserer Mutter. Also: »Butterbrot!« Es war ein Wettbewerb, welche Mutter am schnellsten eine Stulle geschmiert und dann mittels Schnüren abgeseilt bekam. Butterbrot war für mich ein Synonym für Kindheit. Weshalb ich mich als Kind auf das Erwachsensein freute? Weil es bedeutete, nie mehr Brote essen zu müssen.
Heutzutage lebt jedes fünfte Kind in einer Familie, die nicht mehr dieser traditionellen Form entspricht. Und es heißt dann oft: Die Lebenswelt dieser Familien unterscheidet sich wesentlich von der intakter Familien.
Die Trennung verlief schleichend, erinnere ich mich. Es begann, als Felix vier Jahre alt war. Damals arbeitete ich noch in diesem Möbelhaus, und im Einzelhandel ist der Samstag ein heiliger Tag. Das heißt, es gab keine Möglichkeit, Felix mal ein ganzes Wochenende hindurch zu sehen. Ich holte ihn donnerstags, an meinem freien Tag, vom Kindergarten, später von der Schule ab, brachte ihn freitags früh wieder dorthin, und alle zwei Wochen verbrachte ich wenigstens noch einen Sonntag mit ihm.
Horror!
Ab dem zweiten Schuljahr durfte ich Felix keinen Abschiedskuss mehr geben, wollte er nicht, auch keine Berührung mehr vor dem Schulgebäude. Coolness beginnt immer früher. An den freien Wochenenden las ich zur Erbauung in einem UNICEF-Bericht, wonach Kinder Alleinerziehender in Deutschland bereits am Ende der vierten Klasse in Mathematik und Naturwissenschaften einen Leistungsrückstand von einem halben Jahr aufwiesen. Aber was sollte ich denn ändern?
Es klingelt.
Das muss Angelika sein.
Sie hat sich unmittelbar nach Veröffentlichung meiner Annonce gemeldet und ist gerne bereit, meine Katze zu übernehmen. Es haben sich auch noch andere Frauen (und Männer) gemeldet, aber die sind mir entweder zu alt oder zu jung (ansonsten, wie gesagt: zu männlich) oder offensichtlich zu liiert. Angelika wiederum ist Ende dreißig und wohnt nur wenige Autominuten entfernt. Und will nunmehr eine Katze sehen – ich eine Frau. Angelika nickt zur Begrüßung, räuspert sich verlegen, spricht gleich über Katzen, ich (verschachtelt) über eine Partnerin.
Die Katze des Nachbarn streift um ihre Beine.
Sie trägt eine weiße Lederjacke, puh, und ein Stirnband mit dem großflächigen Aufdruck POWER. Nur leider falsch herum. Vor einer halben Stunde ist Gonzalo (der Nachbar) glücklicherweise mit seinem Wäschesack im Keller verschwunden, bei geöffneter Haustür, um anschließend bei den Mitbewohnern zu klingeln. Das kleine Fellvieh sammelt nämlich heimlich Wäsche ein und transportiert sie im Maul umher. Bei Gonzalos Routinebefragung ging es nunmehr darum, überzählige Shorts und Socken den einzelnen Mietparteien zuzuordnen. Und dabei ist Mieze erst mal bei mir geblieben. Reingeschlichen. Sie darf so lange bleiben, bis Angelika sich entschieden hat.
Und die Katze passt offensichtlich, schließe ich aus den entzückten Augen und den unbeholfenen Versuchen, das Schnäuzchen zu kraulen.
Die Frau hingegen eher wohl nicht.
»Kaffee?«
Alleine schon ihre straffen, zurückgezogenen Schultern, denke ich, wie aus Metall, und wie sie pausenlos ihre Hände aneinanderreibt, schnell und kraftvoll, als sei ihr fürchterlich kalt.
»Soll ich die Heizung anmachen?«, frage ich.
Sie lächelt, als habe sie das vergeblich vor einem Spiegel trainiert.
Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass hier wieder eine Frau herumläuft. Folglich ist es lange her, dass ich einem Verhör ausgesetzt war. Mir fehlt ein wenig die Routine.
Angelika stellt nämlich die richtigen Fragen. Auf die ich nur leider nicht vorbereitet bin. »Ist die Katze gesund? Geimpft? Warum willst du sie weggeben?«
Meine Antwort ist eher so: »Ja … Ja … Jaaa …«
Ich versuche daher einen Bogen zu schlagen. Schließlich ist diese Katze nur ein Vorwand.
»Du bist bestimmt Steinbock?«
»Woher weißt du das?« Zum ersten Mal läuft ein Lächeln durch ihr Gesicht, also in meine Richtung.
Puh, Glück gehabt, wenn gar nichts geht, Astrologie funktioniert immer. »Deine Art«, druckse ich herum, »wie du dich bewegst und redest …« Irgendwas halt.
»Du bist Fisch«, sagt sie abrupt und punktet mit dem Zeigefinger vor meinem Bauch herum.
»Wahnsinn«, antworte ich und klatsche in die Hände. Astrologie lügt nicht, der Beweis ist erbracht. Allerdings bin ich kein Fisch. Das ist aber momentan zweitrangig.
»Trinkst du deinen Kaffee mit Milch?«, frage ich, um irgendwie den Bogen weg von der Mieze und hin zu einem möglichen Gespräch zu kriegen. Zu einem Abschlussurteil.
»Viel Zucker«, antwortet sie und schält ihre Jacke im Sitzen nach hinten über die Stuhllehne. Das gibt einen Pluspunkt.
Dann erhebt sie sich ruckartig wieder, weil auf dem Stuhl eine Schraube liegt. Was mich genauso schlagartig an ein solches Ritual erinnert, das mir viele Jahre vertraut gewesen ist. Ich hatte nämlich mit Milena zusammen eine Wohnung gefunden, dort mit zwei Katzen logiert, und deshalb mussten wir die Wohnzimmerstühle immer erst leicht anheben, wenn sie unter den Tisch geschoben standen. Weil eine der Katzen gerne unsichtbar auf der Sitzfläche sinnierte. Um sicherzugehen, dass wir sie dort nicht erdrückten.
Jahrelang vertraut, diese Geste, denke ich – und dann völlig vergessen.
Auch das Geräusch herabfallender Flaschen, erinnere ich mich plötzlich, das Poltern und Rollen, über Jahre hinweg vertraut. Aus der Junggesellenwohnung. Das hat mich immer schon fasziniert: die Besetzung einer Geste mit einem schicksalhaften Verlauf.
»Katzen waren der einzige Lebensinhalt meiner verstorbenen Mutter«, erzählt Angelika leise. »Verwilderte Katzen aufnehmen und die dann beinahe bewusstlos zu quatschen. Sie las ihnen stundenlang Märchen vor und sprach mit ihnen, nur um nach zwei, manchmal erst drei Jahren ein wenig Zutrauen zu gewinnen.«
Ich reiche ihr die Milch und sie schnuppert erst einmal misstrauisch an der offenen Packung. Mehrmaliges Schnuppern. Und beinahe scheint es mir so, als sei diese Vergewisserung von Frische auch ein innerer Dialog über den sonstigen Geruch in dieser Küche.
»Heute gekauft«, sage ich.
Sie schnuppert ein letztes Mal und reicht mir dann wortlos die Packung mit einem deutlichen Stirnrunzeln. Dabei starrt sie mich regungslos an.
»Heute gekauft …«, wiederhole ich mich kleinlaut, um natürlich jetzt auch wie ein Nagetier am Milchtütenfalz zu schnüffeln. Nichts …
Bevor ich meine Milch aber verteidigen kann, greift sie zu ihrem Handy. Der Klingelton ist penetrant laut und simuliert einen früheren Wählscheibenapparat.
»Da muss ich dran«, sagt sie und sieht schon an mir vorbei, während sie ihre geöffnete Hand konsequent in der Luft stehen lässt. »Mmh … Aaah … Mmmh … Aaah …« Die Hand bleibt konsequent in der Luft. Als ich mich auf eine mögliche Anschlussfrage vorbereite, beendet sie das wichtige Gespräch unvermittelt in einer Stimmlage, die gleichzeitig gehaucht, gereizt, sachlich, kindisch und noch eine Prise atemlos wirkt: »Bis gleich … Schatz …«
Gefolgt von einem lippengesprochenen »Ciao«.
»Die Katze …«, sage ich.
Angelika sitzt nun völlig in sich verschlossen vor mir. Wie eine weiße Wand.
»Ich würde sagen … ich melde mich bei dir, Angelika, ob das mit der Katze klappt … Es gibt da noch einen Interessenten im Haus, und das wäre vielleicht am einfachsten und so …«
Dann ist sie weg.
Ich muss das anders angehen, denke ich anschließend beim Kaffee, mit der Katze. Im Gespräch mit mir alleine. Ich muss das anders aufbauen. Dramatischer. Systematischer.
Vielleicht sollte ich es auch eher an einem Wochenende versuchen, an dem Felix bei mir ist. Damit dieser entscheidende Punkt gleich geklärt wäre. Es geht schließlich nicht um die blöde Katze. Wobei sich unmittelbar ein diabolischer Konter in meinen Gedanken verfängt, nämlich: Was machst du eigentlich, wenn du wirklich eine Frau kennenlernst, also richtig kennenlernst, näher, für länger – und dann existiert später gar keine Katze mehr?
Auf Wiedervorlage, denke ich. Es geht erst einmal nur um Felix. Er ist schließlich mein Dreh- und Angelpunkt (was für ein blöder Ausdruck).
Und Felix würde es nicht mögen, wenn ich unsere spärliche Zeit mit irgendwelchen fremden Frauen in der Küche verbringe. Zu Recht. Bislang habe ich das deshalb auch immer abgelehnt.
Weiß ich eigentlich, was Felix mag?
Letztlich, denke ich, ist er so vieles. Er ist mein Spielkind, aber er ist auch das Schulhofkind, das mit seinen Freunden über Raumschiffe diskutiert. Und er ist das Motzkind, das mit Ulrike einkaufen geht. Und bei der Oma schimpft.
Letztlich kenne ich ihn vermutlich überhaupt nicht richtig.
4
Ich sehe meinem Vater verblüffend ähnlich. Felix hingegen sieht eher aus wie Justin Bieber.
Nun ja, vielleicht sollte ich eher schreiben: Er sieht mir nicht ähnlich. Manchmal ertappe ich mich deshalb bei dem Gedanken: Bist du dir wirklich sicher, dass Felix dein Sohn ist?
Und was würde das ändern?
Würde ich ihn wirklich verbannen, wenn so eine genetische Expertise postalisch zugestellt würde? Für mein Vater-Sein würde sich streng genommen nicht viel ändern, außer dem Verlust der Hoffnung, dass meine Gene, mystisch befrachtet, irgendetwas von mir in die Welt tragen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn gezeugt habe. Alleine schon deswegen, weil es hier auf dem Land weit und breit keinen Mann gibt, der so ein wunderbares Kind zeugen könnte.
Das denken wahrscheinlich viele Väter.
Gleich hier in der Nachbarschaft lebt so ein Kind. Ein Mädchen, das ich beinahe täglich sehe: Anna. Sie ist inzwischen sechzehn Jahre alt, hat einen Freund, ist meist schlecht gelaunt, starrt in ihr Handy, ein normales Mädchen eben.
Ihr Vater ist allerdings nicht ihr leiblicher Vater. Was Anna aber nicht weiß. Und ich habe das nur erfahren, weil eine ehemalige Freundin die ehemals beste Freundin von Annas Mutter war, und irgendwann hat sich die Mutter ihrer Freundin anvertraut.
Vermutlich wissen inzwischen eine Menge Leute von diesem Geheimnis. Nur Anna nicht. Vielleicht wissen sogar inzwischen alle darüber Bescheid, und sie alle grüßen Anna und ihren vermeintlichen Vater, der kurz nach der Geburt mit Annas Mutter zusammenkam, aber niemand sagt ihr die Wahrheit.
Wozu auch?
Vaterschaft ist so eine irrsinnig starke Bindung. Und gleichzeitig so brüchig. So beliebig. Wenn ich an meinen leiblichen Vater denke, dem ich so unvergleichlich ähnlich sehe, dann sehe ich einen Mann, der schweigend über seinen Teller gebeugt sitzt, wie ein Tier an einem Napf. Manchmal überkommt mich dann so ein abstoßendes Gefühl von Liebe, unlösbar verknüpft mit Gleichgültigkeit, Verachtung und Ekel. Angst. Wenn er sich darüber aufregte, dass ich die falschen Familienfotos machte. Eben beim Essen, beim Schweigen, beim Aufregen. Ich sollte stattdessen die Familie nebeneinander vor einem Hoteleingang knipsen, nebeneinander vor einem Flussbett, oder all diesen anderen Schrott, der niemanden interessierte. Beim Essen. Ich erinnere mich an meine Mutter, in ihrem Bemühen, dass nach dem Dinieren immer die Töpfe leer sein mussten. Sie stand dann vor mir mit dem Rest Spinat und ich sagte »Danke, satt«, und sie verharrte einen Moment und platschte trotzdem alles auf meinen Teller.
Und wir lachten.
Das Merkwürdige ist, wenn ich so darüber nachdenke, ich kenne noch mehr solcher Fälle. Ich weiß zum Beispiel von Max, dass er einen Sohn in Spanien hat. Mit einer Madrilenin, die seit ihrer Kindheit in Deutschland lebte. Eine Jugendliebe. Sie sind gemeinsam mit neunzehn nach Spanien getrampt, blieben sogar über ein Jahr dort, es ging auseinander, aber sie wurde in Spanien schwanger. Die Ex blieb dann dort wohnen, mit dem Kind. Max hat die Geburt noch miterlebt, auch die erste Zeit danach, aber das Zusammenleben entwickelte sich katastrophal. Beleidigungen, Diebstahl, das volle Ferienprogramm; es ging nicht mehr. Max fuhr zurück nach Deutschland und machte sich schwere Vorwürfe, seinen Sohn zurückgelassen zu haben. Aber Max wurde in dem spanischen Dorf, bei den Einwohnern, den Verwandten, nicht akzeptiert, und er fand keine Möglichkeit zu arbeiten.
»Max?«
Ich rufe ihn an. Schallendes Publikumsgelächter dringt aus dem Telefonhörer. Offensichtlich läuft der Fernseher (mit hundertprozentiger Sicherheit eine amerikanische Sitcom). »Ich sitze hier und schreibe ein Buch über Väter und irgendwie bist du …«
»Meine Ex hat sich gemeldet …«, antwortet er tonlos.
»Nein!«
»Angeblich will mein Sohn mich kennenlernen. Er kann kein Wort Deutsch, obwohl die Mutter es perfekt spricht … Sie hat wohl irgendwann über den leiblichen Vater gesprochen. Weiß Gott, warum …«
»Und?«
»Merkwürdig … Ich bin nur noch ein Wrack. Krankgeschrieben … (Was nicht zu überhören ist.) Ich habe zehn Jahre gebraucht, um einigermaßen damit klarzukommen. Und jetzt diese Nachricht …«
»Wie weiter?«
»Keine Ahnung. Ich will meinen Sohn sehen, aber meine Ex und ihre Familie – no way!«
Schweigen. Rauschen.
Aus dem Fenster sehe ich einen Mann, der mit seinem Handy telefoniert. Er steht breitbeinig, versunken in sein Gespräch, auf einer Wiesenfläche herum, wo ansonsten täglich nur Hunde ihr sogenanntes Geschäft verrichten. Dann macht er einen leichten Schritt zur Seite. Er versteckt abwechselnd seine Hände in den Hosentaschen, mit diesem wankenden Schleichgang voller Glückseligkeit. Vermutlich ein verliebter Anruf. Die nächste halbe Stunde sehe ich ihn mal ganz links, dann ganz rechts, in einem Radius von etlichen Metern.
Schleichend.
»Das Ganze läuft über Mails, in Englisch, in übersetztem Spanisch, und über Skype …«, erzählt Max. »Er sagt ›Papa‹. Das ist schön. Ich hab auch geantwortet: Ciao, Papa. Jetzt ist seine Mutter sauer. Es gäbe einen Mann in ihrem Leben, der als ›Papa‹ akzeptiert sei und ich bräuchte jetzt nicht damit anzukommen … Mein Sohn wiederum sagt, er spricht diesen Mann nur mit Vornamen an …«
»Darf sie das denn?«
»Mein Sohn ist mittlerweile fünfzehn und ich habe ihr eine Mail geschrieben, dass mein Sohn selber entscheiden kann, welche Wörter er verwendet …«
»Alles per Mail?«
»Natürlich.«
Dann wieder Schweigen. Der Mann draußen telefoniert unaufhörlich verliebt weiter. Auf der Hundewiese.
Neben meinem Schreibtisch, neben dem Telefonapparat, spaltet sich irgendwo eine Füllung im Holzgebälk. Schweigen verstärkt die Konzentration auf das Wesentliche. Irgendwo rieselt auch Lehm oder Mörtel herab, und wenn ich mich nicht arg täusche, wächst ein neuer Riss an einem Balken entlang. Ich mag die Vorstellung, dass er sich jetzt von einer Zimmerecke in die nächste vorarbeitet, von dort in das Nebenzimmer, anschließend in einer Irrsinnsgeschwindigkeit abwärts zu Gonzalo, in sämtliche Zimmer dort, weiter in das Nebenhaus, in sämtliche Nebenhäuser, in sämtliche Städte.
»Du musst dir mal reinziehen, sie hat sich nie gemeldet, nicht ein einziges Mal, sie wollte nicht mal ein Bild schicken. Ich habe von meinem Sohn nur ganz wenige Fotos – als Baby!«
»Sie hat Angst.«
»Ja, klar, sie hat Angst, dass ihr Sohn sagt, ich will zu meinem Vater nach Deutschland.«
»Und du? Willst du das?«
Schweigen.
»Mein Sohn wollte dann auch Bilder sehen aus den ersten Lebensjahren, wo wir beide drauf sind. Puh, ich hab wirklich welche gefunden … Aber nur solche, wo er Windeln anhat, als Baby, beim Füttern … Seine Mutter habe ich natürlich immer rausgeschnitten. Nur er und ich, versteht sich …«
Er lacht.
Wenn es um die eigenen Kinder geht, denke ich, dann reicht ein Telefonat, und die Seele kocht. Tiefe Gefühle. Tiefste Gefühle. Und diese Emotionen wirken beinahe wie ein Hilfeschrei. Und immer sind es Verurteilungen. Und Fehler. Und immer urteilen wir über Menschen und Fehler, wo wir vermutlich selber einen ähnlichen Mist verbockt haben. Wir zeigen mit dem Finger, wir weisen alles von uns, und wir weisen damit auch alles von uns, was tief in uns verborgen liegt.
Wenn ich mir eingestehen kann, selber Mist gebaut zu haben, dann bin ich offen, etwas zu lernen.
»Hörst du mir überhaupt zu?«
»Natürlich …«
5
Eine gute Trennung hat fast schon eine philosophische Dimension, so kommt es mir zumindest vor, wie eine gewaltige spirituelle Aufgabe, eine politische Mission. Eine gute Trennung verlangt viel mehr als eine simple Heirat.
Das kann jeder.
Diesen Moment ausblenden, wo wir einander endlich die Wahrheit ins Gesicht schreien wollen, gefolgt von Türenknallen, Flaschenschmeißen, dem berühmten »Das war’s« und all diesen großen Szenen. Stattdessen müssen wir uns zurückhalten, leise sprechen, zurücknehmen, freundlich sein.
Aber ist das denn wirklich so schlimm?
Carsten klingelt. Endlich. Er ist pünktlich. »Mach dir allerdings keine Hoffnung«, sagt er direkt zur Begrüßung, »ich habe kaum geschlafen, kriege keine Gedanken sortiert. Es wird dir nicht viel bringen …«
So ist er halt, denke ich, deute auf eine Espressokanne, während mir plötzlich, beinahe schon peinlich, schuldbehaftet, klar wird, dass ich doch gar nicht weiß, wie er halt ist. Obwohl ich Carsten schon fünfzehn Jahre kenne. Aus einer Bürogemeinschaft, wo er sein Atelier anteilig gemietet hatte. Aber wir haben in all den Jahren kaum mehr miteinander gesprochen als über den Verlauf der Regenwolken. Er wirkte abweisend, kam immer erst dann vorbei, wenn ich auf dem Weg nach draußen war. Über Monate hinweg hatten wir es nicht einmal geschafft, uns einander vorzustellen. Ein Umstand, der sich zumindest bei mir irgendwann zu einem Unbehagen steigerte. Bei jedem flüchtigen Kopfnicken. Mittlerweile waren mir sein kahl rasierter Schädel und seine grummelige Transzendenz schon so vertraut geworden, dass sein Status als »Unbekannter« fast schon peinlich war. Irgendwann bin ich dann sogar länger in der Bürogemeinschaft geblieben, nur um auf seinen Auftritt zu warten. Alle anderen kannten Carsten schließlich. Wenigstens kurz in der Gemeinschaftsküche einen Espresso schlürfen, dachte ich, weil mittlerweile ein Punkt erreicht war, an dem unsere gegenseitige Fremdheit in einem ansonsten liebevollen Ambiente zu einer höheren Ebene von betretenem Schweigen führen würde.
Der Espresso führte dann schnell zu einer gewissen Form von Freundschaft. Ich erfuhr, dass er Architektur studierte, diverse Ausstellungen seit 2001 gehabt hatte, aber kaum verkaufte. Seine farbenfrohen Gemälde, die er nebenan aufstellte, gefielen mir auf Anhieb. Und ich war überrascht zu erfahren, dass er zwei Kinder hatte. Und dann erst recht, dass er sie großzog. Als Hausmann.
»Deshalb bist du immer erst so spät in das Büro gekommen«, eröffne ich das Gespräch und platziere mein Aufnahmegerät neben seinen Sessel. Seine Stirnpartie runzelt unaufhörlich vor und zurück, als sei es eine Form von Muskelflattern.
»Die Kinder«, antwortet er und poliert seine Brille, indem er sie ableckt. Sein Gesicht, unterhalb des Kinns, ist mit Haar bedeckt. Ab der Oberlippe hingegen ist alles sorgfältig glatt rasiert.
»Wie hast du Carmen eigentlich kennengelernt?«
»In einem Studentenheim. Sie studierte Sozialarbeit, ich Architektur. Ich habe in der zweiten Etage gewohnt, sie in der ersten, und ich habe sie immer beobachtet, wenn sie mit dem Fahrrad rein- und rausfuhr. Ihre langen Haare wehten im Wind und ich war schnell in sie verliebt. Ohne ein Wort mit ihr gesprochen zu haben, dachte ich immer nur daran, wie ich sie kennenlernen könnte.«
»Carmen hat dich also nicht als Künstler kennengelernt?«
»Nein, das mit der Kunst kam bei mir relativ spät. Als Kind habe ich in der Schule zwar immer in meine Bücher gezeichnet, aber das hat mir nur großen Ärger gebracht. Es gab auch keinen Lehrer, der mich gefördert hätte, ich war eher ein Ärgernis. Erst Ende der Achtzigerjahre änderte sich das alles. Ich habe Kunst allerdings nicht in einer Galerie oder in einem Museum für mich entdeckt, sondern auf der ›Art Cologne‹, einer Kunstmesse. Ich kam mir vor, als ob ich etwas Verlorenes gefunden hatte. Ich war so begeistert, gerade von den sogenannten ›Neuen Wilden‹, dieser expressiven Malerei, dass ich nicht lange überlegen musste, sondern es war sofort klar: Ich fange an zu malen.«
Ich erinnere mich daran, dass ich mit Charlotte sogar bei einer seiner Vernissagen gewesen bin. Sie hatte sich dort nicht wirklich wohl gefühlt. Irgendwie schienen die Gespräche, die Andeutungen, das Getuschel um sie herum nach abstrusen, gleichzeitig aber dogmatischen Regeln eröffnet und abrupt beendet zu werden, die sie nie verstand. Und die ich ihr auch nicht erklären konnte. Bizarrerweise hatte sich dann ein Kunsttourist ausgerechnet bei Charlotte in den Kopf gesetzt, sie sei eine Vorreiterin der Avantgarde. Wenn er nur über ein wenig Menschenkenntnis verfügt hätte, wäre ihm aufgefallen, dass sie (an diesem Abend) nichts weiter war als ein verschrecktes Reh.
»Geld spielte zu Beginn eurer Beziehung keine Rolle?«
»Auch nicht, als wir 1986 geheiratet haben. Da habe ich noch studiert, sie war gerade fertig. Wir sind gemeinsam mit dem Fahrrad durch die Stadt geradelt, um einen Studentenjob für mich zu finden. Wir waren frei. Es ging nicht um Geld … 1992 kam Pauline zur Welt. Carmen hatte davor die Branche gewechselt und arbeitete als Vorstandssekretärin. Und es war klar, dass sie weiter arbeiten geht. Schon acht Wochen nach der Geburt …«
Ich ziehe und zerre unter großem Geraschel (unfreiwillig) an einer Kekstüte, passend zum Kaffee, ohne irgendwo eine Öffnung zu bewerkstelligen, und als ich mich entnervt der Beschaffenheit des Materials zuwende, entdecke ich, dass ich kurzzeitig schon vergessen habe, was sich in der Tüte befindet.
»Ihr habt das gar nicht groß besprochen?«
»Es war einfach naheliegend. Ich wollte noch zu Ende studieren. Also habe ich Pauline großgezogen.«
»Ohne Zweifel an den eigenen Fähigkeiten? Als Mann, sage ich mal, was macht man da, wenn das Baby schreit?«
»Es gab keinen einzigen Fall, wo ich jemanden um Hilfe gefragt oder bei Carmen angerufen hätte: ›Hilfe, das Baby weint, was soll ich jetzt machen?‹ Für mich war das unkompliziert. Okay, das Bewusstsein, dass ich wahrscheinlich etwas Ungewöhnliches mache, das war da. Das machen nicht viele Männer. Eine polnische Kommilitonin sagte mir sogar scherzhaft, wenn in ihrer Heimatstadt ein Mann um 10 Uhr morgens einen Kinderwagen schiebt, dann rufen die Leute einen Arzt. Oder die Polizei. Da stimmt was nicht.«
»Aber es hat dir nichts ausgemacht?«
Über die Schwiegereltern will er nicht reden, sagt er unvermittelt. Dabei habe ich gar nicht nach denen gefragt. Offensichtlich ist deren Sicht auf die Dinge nicht unbedingt positiv.
»Es gibt eine Studie in Amerika«, zitiere ich, »die herausgefunden haben will, dass die Herzinfarktrate bei Hausmännern höher ist als bei Berufstätigen. Offensichtlich werden viele doch nicht mit dem gesellschaftlichen Druck fertig, zu Hause zu bleiben und die Frau verdient das Geld.«
»Für mich war das kein Problem. Vielleicht, weil ich nach der Hausarbeit meiner Malerei nachgegangen bin. Abends war ich im Atelier, oder am Wochenende. Immer dann, wenn Zeit war. Für mich ist das eine richtige Arbeit, kein Hobby. Viele Leute verstehen das nicht, sie denken, für eine Arbeit musst du einen Chef haben, geregelte Arbeitszeiten. Malerei gilt als nicht vollwertig. Selbst beim Windelwechseln war ich mit einem Teil meiner Aufmerksamkeit auch bei der Malerei. Denn für mich war immer klar: Die Bilder sollen irgendwann verkauft werden. Das ist, wie gesagt, kein Hobby.«
Aber dafür schwieriger als gedacht.
Wobei der Erfolg nicht an die Tätigkeit als Hausmann gekoppelt sei, das betont er. Es sei nicht zwangsläufig, dass ein alleinstehender Künstler sich durchsetze, während der Familienmensch scheitere. Denn nur drei Prozent der Künstler können von ihrer Arbeit leben.
»Allerdings ist es doch schon auffällig«, sage ich, »wie wenige Künstler Kinder haben.«
Carsten denkt kurz nach. Dabei fällt mir zum ersten Mal auf, wie unausgeschlafen er aussieht. Der gefährliche Erschöpfungszustand zeigt sich bei ihm immer dann, wenn er seinen Daumen kraftvoll umklammert. Dann muss man ihn besonders nachsichtig behandeln.
»In fünfzehn Jahren Künstlerkolonie, puh … stimmt, das waren höchstens zwei, drei Künstler, die auch noch Familie und Kinder hatten.«
»Ich kann das verstehen. Von heute aus gesehen wünsche ich mir, ich hätte eine ganze Fußballmannschaft Kinder großgezogen – aber dann nicht als Autor. Als solcher hätte ich besser – von heute aus gesehen – auf alles verzichtet. Also keine feste Partnerschaft und erst recht keine Kinder. Es wäre zumindest einfacher gewesen …«
Er stutzt.
Und immer dann, wenn er sich in ein Gespräch zu sehr hineinsteigert oder unschlüssig ist, wie er ein Argument beleuchten soll, dann dreht er (unbewusst?) seinen Kopf von links nach rechts und wieder zurück, pausenlos von links nach rechts, beinahe wie ein Elefant.
»Andere Künstler«, antwortet er, »die von ihrer Kunst nicht leben können, arbeiten nebenbei in einer Fabrik oder in einer Werbeagentur. Meine Arbeit bestand darin, nach Hause zu gehen und mich um die Kinder zu kümmern … Allerdings kenne ich kaum Künstler, die ohne Familie leben und dabei glücklich sind. Zumeist sind sie verbissen und enttäuscht, erst recht, wenn sie mit ihrer Kunst keinen Erfolg hatten. Und am Ende haben sie gar nichts. Robert Rauschenberg hat mal in einem Interview gesagt, als Künstler opferst du dein Leben.«
Wobei der erfolgreiche Künstler, der wohlhabende Künstler, wie Robert Rauschenberg, dann auch noch eine Familie dranhängen (ernähren) kann, denke ich. Ein Haufen Kinder, problemlos, auch von mehreren Frauen. Dann stellt sich auch nicht mehr die Frage, ob jemand nun Hausmann sei oder nicht. Weil: Er ist ja reich. Und im Wohlstand verschwimmen die Rollen. Künstler sind schließlich auch nur ein Teil der Leistungsgesellschaft.
»Absurd ist das schon«, sagt Carsten, »wenn ein Angestellter jeden Morgen unglücklich zur Arbeit geht und widerwillig seine Arbeit macht – dann wird er trotzdem von der Gesellschaft anerkannt. Weil er ein geregeltes Einkommen hat. Ob du für diese Gesellschaft irgendwas bewirkst, das spielt keine Rolle. Es ist auch absurd, wie ich das kürzlich im Bekanntenkreis gesehen habe. Die Kinder sind aus dem Haus, die Frau geht aber trotzdem nicht arbeiten – und niemand beklagt sich darüber. Das ist für das Umfeld kein Problem. Sogar dann nicht, wenn die Frau darüber meckert, dass es ihr zu Hause zu langweilig sei. Jemand, der aber so lebt wie ich, bekommt keinerlei Anerkennung. Wenn also ein Künstler kein Geld mit seiner Kunst verdient, beschweren sich die Leute.«
»Mal was anderes: Hast du eigentlich ein Erziehungskonzept?«
»Nein.«
»Hast du irgendwelche Bücher über Erziehung gelesen?«
Wie ich weiß, konnte er keine Großmutter zur Seite nehmen. Seine Eltern leben in einem anderen Bundesland, und Carmens Eltern sind, nun ja, eher passiv. Er musste das komplett ohne Frauen stemmen.
»Ich hatte gar nicht die Zeit, um nebenher noch Bücher darüber zu lesen. Wir haben uns auch als Eltern nicht groß über Erziehung unterhalten. Ich wüsste gar nicht, was so ein Konzept sein soll.«
»Warst du denn ein strenger Vater? Oder eher liebevoll?«
»Beides. Liebevolle Strenge. Aber ich habe meine Kinder nie zu etwas gezwungen. Ich merke das manchmal, wenn wir heute beim Frühstück zusammensitzen und die Kinder drücken mich. Das sind so Momente, wo mir klar wird, ich bin nicht so ein konventioneller Vater.«
»Der ›normale‹ Vater ist eher abwesend …«
»Ich habe das komplett mitbekommen, was es heißt, Verantwortung für die Kinder zu übernehmen. Früher sind die Väter nach Hause gekommen, das Essen stand schon auf dem Tisch, und weiter hat sie nichts interessiert. Weder wie es den Kindern geht noch wie sie großgezogen werden, was gekocht wird oder wie gekocht wird. Ein Mann verdient das Geld und gut ist. Das war bei uns anders. Carmen hat das Geld verdient, aber sie war sowohl im Haushalt als auch in der Erziehung sehr involviert. Und ich habe halt immer gekocht. Carmen kam nach Hause und das Essen stand bereit. Ich koche auch gerne. Das war auch für die Kinder immer klar, es gibt immer mindestens eine warme Mahlzeit am Tag, frisch gekocht, keine Tiefkühlware. Für meine Kinder war das irgendwann normal, denen ist das gar nicht mehr aufgefallen, aber ich habe das gemerkt, wenn Freunde zu Besuch waren, aus traditionellen Familien, wo es abends nur Butterbrote gab. Die haben oft zwei volle Teller gegessen, weil sie so etwas gar nicht mehr kannten.«
Ich muss dabei schmunzeln, weil mir Milena in den Sinn kommt, die in ihrem Unternehmen derart reichlich entlohnt wurde, dass wir beide prima davon hätten leben können. Aber es war für sie undenkbar, dass eine Frau das Einkommen heranschafft. Unvorstellbar! Vor allem, wenn tagtäglich andere Männer vor ihr mit den Hufen scharrten, die mehr verdienten. Mehr hatten. Mehr!
»Ich denke, meine Frau und ich sind nicht so materiell«, erzählt Carsten. »Für uns waren andere Dinge wichtig. Alleine jeden Tag frisch zu kochen, das ist teurer als Tiefkühlware. Carmen ist auch nicht wild darauf, ein großes Auto zu fahren oder sich mit Schmuck zu behängen, das ist nicht ihre Welt.«
»Aber ein zweites Kind kostet Geld. Hattet ihr diesbezüglich keine Diskussionen?«