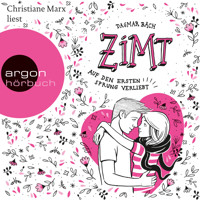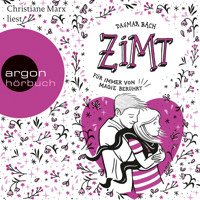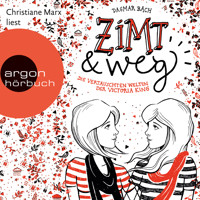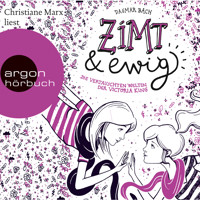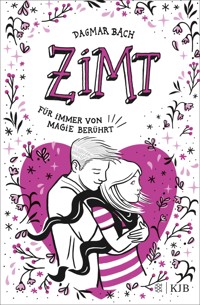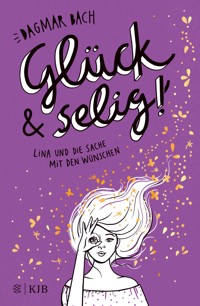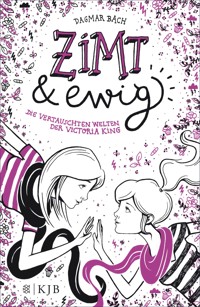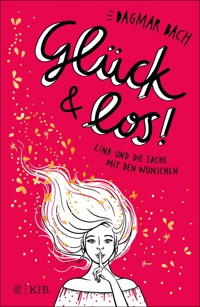
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Glück
- Sprache: Deutsch
Geheime Wünsche, eine moderne Fee und jede Menge romantisches Liebeschaos – Bestsellerautorin Dagmar Bachs (»Zimt & weg«) neue Trilogie lässt Herzenswünsche wahr werden! Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen, das wär's! Früher war Lina überzeugt, dass sie das kann und eine echte Glücksbringerin ist: Um sie herum gingen urplötzlich geheime Wünsche in Erfüllung. Doch das ist schon lange her. Und was genau es war, das die Wünsche wahr werden ließ, hat Lina nie herausgefunden. Schade eigentlich, denn nun hat sie selbst einen riesengroßen Wunsch: Sie will sich endlich, endlich richtig verlieben, mindestens auf den ersten Blick! Wild entschlossen versucht sich Lina wieder an der Sache mit den Wünschen. Leider enden all ihre Experimente im größten Chaos ... Dagmar Bach ist erneut in Höchstform und schreibt über das, was sie am besten kann: ein Mädchen mit einem magischen Geheimnis, zum Verlieben gut aussehende Jungs, die allerbeste Freundin als Fels in der Brandung und viele, viele Fettnäpfchen. Fortsetzung folgt! Alle Bände der Trilogie: Band 1: »Glück & los!« Band 2: »Glück & wieder!« Band 3: »Glück & selig!«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Dagmar Bach
Glück und los! – Lina und die Sache mit den Wünschen
Band 1
Impressum
Alle Bände der ›Glück‹-Trilogie:
Band 1: Glück und los!
Band 2: Glück und wieder!
Band 3: Glück und selig!
Die Hörbücher zur Trilogie,
gelesen von Christiane Marx, sind im Argon Verlag, Berlin,
erschienen und im Buchhandel erhältlich.
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Inka Vigh unter Mitarbeit von Schiller Design, Frankfurt am Main
Coverillustration: Inka Vigh
Vignetten: Inka Vigh
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-5142-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Linas Wunscherfüllungsutensilien
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Liebe Leserinnen und Leser,
Für alle, die wie Lina an das Glück glauben.
Und an die ganz große Liebe.
1
»Vorsicht, der kracht in uns rein!!!«, schrie ich und duckte mich hinter den Beifahrersitz. Mein Herz schlug bis zum Hals, und ich ließ mein nur fünfzehn Jahre kurzes Leben Revue passieren, weil wir hier vermutlich gleich das Zeitliche segnen würden. Ich hatte vorher noch nie erlebt, dass Papa dermaßen halsbrecherisch Auto fuhr! Und dann riss er auch noch das Lenkrad urplötzlich nach links, so dass ich trotz meines Gurtes gegen die Tür flog.
»Au! Papa!!!«
»Hey, das war cool, fast wie in The Fast and the Furious. Du bist nur auf zwei Rädern um die Kurve«, rief mein großer Bruder Mats begeistert und deutete nach vorne. »Schau mal, und den da überholst du auch noch locker.«
Doch mein Vater setzte den Blinker und fuhr einen Hauch weniger schwungvoll von der Stadtautobahn ab, in Richtung Flughafenterminal. Trotzdem begannen meine Eingeweide, sich verräterisch zu verknoten.
»Mir ist schlecht«, sagte ich von hinten und hielt mir den Bauch.
»Setz dich in die Mitte und schau nach vorne, wir sind ja gleich da«, sagte Papa und warf mir über den Rückspiegel einen prüfenden Blick zu. Er kannte mich und meinen nervösen Magen nur zu gut, und tatsächlich wurde er ein bisschen langsamer und nahm die Kurven nicht mehr ganz so eng. Ich hatte ihm schon zu viele Autopolster ruiniert.
Zum Glück kamen wir im Parkhaus an, bevor Schlimmeres passierte, und Papa hielt auf einem Kurzzeitparkplatz.
»Blöd, dass es hier so voll ist, ausgerechnet heute. Egal, wir laufen durch die Abflughalle und dann erst die Treppe rauf zum Ankunftsbereich, das geht schneller!«, sagte er und warf einen entsetzten Blick auf seine Armbanduhr, während wir aus dem Auto sprangen. »Mist, die müssten schon gelandet sein.« Dann rannte er los, Mats und ich hinterher.
»Nur weil du unbedingt noch eine Runde spielen wolltest!«, meckerte Mats, der mit mir Seite an Seite zwischen den Autoreihen hindurchjoggte.
»Ich? Du wolltest doch immer weitermachen! Oder wer hat die ganze Zeit gesagt: Ey, ich kann jetzt nicht aufhören, ich hab ’ne Strähne?«
Papa war vor uns hinter den Glasschiebetüren verschwunden, die ins Terminal führten. Wir rannten hinterher, zwischen parkenden Autos und Absperrpollern hindurch.
»Vorsicht!!!« Ich konnte gerade noch einen Haken schlagen und der Familie mit den vollgepackten Gepäckwägen ausweichen, die urplötzlich aus dem Nichts erschienen war. Doch Mats konnte leider nicht schnell genug anhalten, er versuchte noch, einen Bocksprung über den Rollwagen zu machen, aber – zu spät.
»Was soll das?«, rief die Frau, die panisch ihre beiden Kleinkinder an den Händen grapschte und vom Wagen wegzog.
»’tschuldigung, ehrlich!«, rief Mats, denn er hatte die Beine trotz seiner Sportlichkeit nicht rechtzeitig nach oben ziehen können. Den kompletten Wagen hatte er abgeräumt, alle Taschen fielen zu Boden und purzelten durcheinander.
»Sorry, sorry, sorry!«, rief er entschuldigend, rappelte sich sofort wieder auf, packte meine Hand und zog mich weiter.
»Wir müssen denen helfen!«, protestierte ich.
»Wir müssen vor allem die Zwillinge abholen, sonst macht Bea uns einen Kopf kürzer! Wenn man einmal ein bisschen Glück braucht … jetzt tu was, Lina! Du behauptest doch immer, du kannst Wünsche erfüllen. Also los – ich wünsche mir, dass dieser verdammte Flug sich verspätet hat!«
»Haha!«, presste ich verbissen hervor.
Dass ich das mit dem Glückbringen ernsthaft behauptet hatte, war schon einige Jahre her, in einem Alter, in dem andere an Glitzereinhörner und Drachen glauben. Aber Mats nutzte jede Gelegenheit, mich damit aufzuziehen.
Allerdings – ab und zu klappte es tatsächlich. Ungefähr einmal im Jahr, und natürlich war das reiner Zufall. Aber was hatte ich hier zu verlieren?
Wir waren mittlerweile im Terminal angekommen. Wir mussten leider auf die komplett andere Seite, um zum Ankunftsbereich für die internationalen Flüge zu gelangen, und es war schon halb zwölf. Wir waren fast eine Stunde zu spät, und nirgendwo entdeckte ich eine Anzeigetafel. Keine Ahnung, ob der Flieger schon gelandet war oder nicht. Deshalb versuchte ich es einfach.
Ich löste mich von meinem Bruder und blieb kurz stehen. Ich hätte gerne einen ruhigeren Ort gehabt für mein, äh – Vorhaben, aber heute musste es eben so gehen. Hier. Direkt neben der Schlange an Leuten, die am Check-in-Schalter für ihren Urlaubsflug nach Rhodos anstanden. Und ohne meine obligatorischen Hilfsmittel, was ein Gelingen schon mal grundsätzlich in Frage stellte.
Ich kniff ganz fest die Augen zu.
Bitte, bitte, dieser Flug soll Verspätung haben, wir wollen uns nicht gleich als neue Familie am ersten Tag blamieren!
Dann fing ich an, einen kleinen Tanz aufzuführen. Na ja, es war eher nur eine Schrittfolge, zusammen mit einem Lied.
»Eins, zwei, drei, im Sauseschritt tanzen alle Kinder mit, die Lina ist jetzt an der Reihe und tanzt für uns, macht mit! Zweimal springen, rundrum drehen, viermal klatschen, stampfen, stehen!«
Während ich mich gerade vor ungefähr hundertfünfzig Leuten zum Deppen machte – die Urlauber um mich herum glotzten mich mit großen Augen an –, stellte mein Bruder sich nur auf die Zehenspitzen, um auf die Uhr auf dem Display vor uns zu sehen.
»Fertig? Dann los, weiter!«, rief er und rannte wieder los, und ich ihm hinterher.
Es musste einfach geklappt haben, es musste!
Auf wundersame Weise durchquerten wir die Ankunftshalle ohne größere Zusammenstöße. (Auch wenn Mats sich kurz vor unserem Ziel in der Hundeleine eines überdrehten Boxers verwickelte, der sofort dachte, dass er einen neuen Spielkameraden gefunden hatte, und begeistert an ihm hochsprang.)
Aber den Vogel schoss Papa ab, zu dem wir gerade wieder aufgeschlossen hatten. Der brüllte nämlich, als wir hinter einer riesigen Reisegruppe vor der Rolltreppe feststeckten: »Lassen Sie mich durch, ich bin Pilot!« Dabei fuchtelte er wie wild mit seinem Ausweis der Fluggesellschaft, und die Leute waren so verdutzt, dass sie tatsächlich zur Seite sprangen und uns Platz machten.
»Muss das nicht heißen: Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt?«, fragte ich Mats, aber der konnte gar nicht aufhören zu lachen. Er hatte offenbar – trotz allem – einen Riesenspaß.
Der verging ihm allerdings, als wir drei schlitternd vor der großen Anzeigetafel in der Ankunftshalle zum Stehen kamen. Schnaufend und schwitzend starrten wir nach oben.
»Der Flieger aus Vancouver ist schon gelandet. Vor über einer Stunde. Überpünktlich«, sagte Papa zerknirscht. Mats und ich stöhnten gleichzeitig auf.
Mist.
»Nur weil du noch unbedingt eine Runde spielen wolltest!«, fing mein Bruder wieder an und knuffte mich in die Seite.
»Nein, nur weil du gesagt hast, wir spielen so lange, bis du auch mal wieder eine böse Karte hast. Kindskopf!«
»Selber«, maulte Mats, zuckte dann allerdings nur mit den Schultern, so wie er immer gerne Probleme einfach wegzuckte. »Aber wird schon nicht so schlimm sein, die stecken bestimmt noch in der Zollkontrolle. Als wir nach dem Besuch bei den beiden aus Kanada zurückgekommen sind, war ich eine geschlagene Stunde in dem Kabuff und musste meine dreckige Wäsche von den Zollbeamten durchsuchen lassen.«
»Weil der Sonnyboy immer verdächtig ist«, sagte ich.
»Hey, die Zollbeamtin hat die ganze Zeit mit mir geflirtet!«
»Das glaubst nur du.«
Im Gegensatz zu mir hatten Mats und Papa die Zwillinge schon kennengelernt – ich war in den Ferien nicht dabei gewesen, als die beiden sie zusammen mit Bea in Vancouver besucht hatten. Meine unüberwindbare Flugangst hatte mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich war schon ein bisschen traurig, vor allem, als ich die vielen tollen Fotos sah, die die drei mir schickten, aber trotzdem hätte mich nichts und niemand in diese Sardinenbüchse von Flugzeug bekommen. Zumindest nicht, wenn sie vorhatte, vom Boden abzuheben.
Aber leider lag mein Bruder falsch. Die Zwillinge waren natürlich nicht bei der Zollkontrolle aufgehalten worden, sondern sie saßen auf einer Bank neben dem kleinen Souvenirgeschäft. Ich erkannte sie von den Urlaubsbildern von Mats und Papa und von den Fotos, die in Beas Wohnung waren, allerdings waren sie darauf teilweise um einiges jünger. Und – fröhlicher. Die echten Versionen hier hatten nämlich eher die Ausstrahlung von Gewitterwolken.
»Ach herrje. Das musste ja jetzt nicht unbedingt sein, dass wir uns so sehr verspäten«, murmelte Papa und rief dann: »Vincent! Arthur! Hier sind wir!« Er winkte und ging den beiden entgegen. »Ach, ist das schön, dass wir uns wiedersehen! Wie geht’s euch? Tut uns leid, dass wir erst jetzt kommen, aber wir, äh – wurden aufgehalten. Soll ich euch das Gepäck abnehmen?«
Die beiden murmelten sich etwas Unverständliches zu und standen dann von der Bank auf. Im Stehen überragten sie mich gut einen halben Kopf, obwohl ich schon recht groß bin, und auf den ersten Blick wirkten sie massiver als zum Beispiel Mats: breite Schultern, kastiger Oberkörper, lange Beine, kinnlange, dunkle Haare. Ihre Hände hatten sie hartnäckig in den Taschen ihrer Jeans vergraben, und sie machten keine Anstalten, uns ordentlich zu begrüßen. Und sie schauten recht … gewittrig eben.
Na ja, vielleicht waren sie einfach ein bisschen schüchtern. Das passte prima zu meiner Aufregung, die mir nach diesem turbulenten Vormittag in den Knochen steckte, deswegen quatschte ich erst mal los.
»Hey, Jungs, wie schön, dass wir uns endlich kennenlernen, das ist ja wirklich Wahnsinn, wie gleich ihr ausseht, wie kann ich euch denn unterscheiden? Hab ganz vergessen, Bea zu fragen. O Mann, das war gerade was, Mats ist von diesem Hund angesprungen worden, der hat so getan, als ob sie sich seit tausend Jahren kennen, und hat ihn fast umgeworfen beim Hochspringen. Das war doch ein Boxer, Mats, oder? Oder wie heißen diese Hunde, die so schlabberige Lippen haben und dauernd sabbern? Mops? Nee, das sind die Kleinen. Na egal, jedenfalls sind Mats und ich gerannt wie zwei Irre, immer hinter Papa her, der die ganze Zeit mit seinem Flughafenausweis rumgewedelt hat, ich glaube, alle Leute hatten Angst vor uns, und ich meine, einen Kollegen von ihm gesehen zu haben, wie hieß der gerade noch – Roland? Ronald? Der hat jedenfalls so getan, als ob er uns nicht kennt, kann ich irgendwie verstehen. Und dann ist noch nicht mal mein Wunsch in Erfüllung gegangen, dass sich euer Flug verspätet, dabei war ich so sicher, dass es mal wieder klappt! Es tut uns wirklich, wirklich leid, dass wir nicht früher da waren, aber es ist wirklich etwas dazwischengekommen, und deswegen auch dieser dicke Spiegeleifleck von heute Morgen auf meinem T-Shirt, ich wollte mich eigentlich umziehen, ich hatte nur keine Zeit mehr, aber na ja, wir wohnen ja ab morgen zusammen, da werdet ihr mich schon noch mal in sauberen Klamotten sehen. Aber geduscht hab ich, keine Sorge! Und außerdem seid ihr ja auch nicht mehr so taufrisch, guck mal, du hast da auch was auf deinem Pulli, ist das Marmelade? Oder Ketchup? Egal.« Ich schenkte den beiden ein Lächeln. »Also, was ich eigentlich sagen wollte: Hallo. Ich bin Lina.«
Ich spürte, wie Mats neben mir anfing zu kichern. Sein ganzer Körper bebte während seines Versuchs, nicht laut loszuprusten, und ich musste ihm meinen Ellbogen in die Seite rammen, damit er aufhörte. Außerdem wusste ich gar nicht, was er hatte. Ich meine, klar, ich hatte vielleicht ein bisschen viel geredet, aber schließlich musste irgendein Familienmitglied unseren Fauxpas wiedergutmachen.
Leider konnte ich so ganz spontan nicht sagen, ob es geklappt hatte. Die Zwillinge starrten mich nämlich einfach nur an – und sagten gar nichts.
Nach ein paar Sekunden des (zuerst beharrlichen, dann eher peinlichen) Schweigens versuchte Papa, die Situation ein bisschen aufzulockern.
»Na ja, also, ihr seht – Lina freut sich sehr, dass ihr wieder da seid. Wie wir alle übrigens! Wie war’s denn in der Businessklasse? Hat alles geklappt?« Papa hatte seine Beziehungen spielen lassen, so dass die Zwillinge ein Upgrade bekommen hatten, auch wenn sie dadurch zwei Tage später nach Hause gekommen waren als geplant. Mit dem Schulanfang morgen war das zwar etwas knapp, aber hey – Businessklasse! Das machte sicher den Stress wett.
Nur ganz ehrlich, wenn Vancouver wirklich die Stadt mit den glücklichsten Bewohnern der Welt sein soll (zumindest stand das neulich so in Papas Reisemagazin), hatte sie auf die Zwillinge nicht diesen Effekt gehabt, zumindest nicht nachhaltig. Die beiden sahen aus, als ob sie den ganzen Weg von Kanada hierher auf der Ladefläche eines Lasters verbringen mussten – die Haare zerzaust, die Augen rot, die Ringe drumherum tiefviolett, die Mundwinkel in steilem Winkel nach unten gezogen.
»Gebt es zu, ihr habt die ganzen zehn Stunden nur Filme geschaut«, sagte Mats lachend und schlug einem von beiden freundschaftlich auf die Schulter. Wer wer war, konnte ich beim besten Willen nicht sagen, denn sie hatten sich ja noch nicht mal vorgestellt.
Aber die Zwillinge zeigten weiterhin keine Reaktion.
»Bist du Vincent? Oder Arthur?«, fragte ich den Linken von beiden, der mich durch seinen dunkelbraunen Haarvorhang anstarrte. Vielleicht starrte er aber auch nur meine Sommersprossen an, es sind nämlich ganz schön viele, und auf meiner blassen Haut sehen sie ein bisschen so aus wie schwarzer Pfeffer. Oder meine Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen. Aber ich mochte irgendwie beides. Und bisher hatten sich noch alle daran gewöhnt.
Nachdem der nix sagte, probierte ich es mit dem anderen.
»Äh, und du bist …?«
Ich erntete einen mürrischen Blick. »Hundemüde. Könnten wir jetzt fahren, bitte?«
»Also, Papa, du hast es gehört. Hundemüde und der Schweiger wollen heim.«
Mats, der hinter mir stand, fing schon wieder an zu kichern.
»Du bist wohl eine ganz Schlaue, was?«, fragte mich Hundemüde und durchbohrte mich mit seinen grauen Augen.
Ich lächelte verbindlich und verkniff mir einen Konter. Ich wusste ja, dass Jungs manchmal wunderlich sind, aber diese beiden hier waren schon ziemlich speziell. Auch wenn ich mir vorstellen konnte, dass man sich nach so einem Interkontinentalflug matschig fühlen konnte. Wahrscheinlich sehnten sie sich einfach nach einer Dusche und etwas Ordentlichem zu essen. Deswegen wollte ich mal nicht so sein.
Papa nahm Hundemüde seinen überdimensionalen Rucksack ab und winkte ihm, ihm zu folgen. Der Schweiger klammerte sich weiterhin an seinem Gepäck fest und trug es, ohne zu murren – geschweige denn überhaupt sonst einem gesprochenen Wort –, zum Auto. Vielleicht hatte er Angst, dass Papa mit seiner schmutzigen Wäsche türmen würde.
»Bea kann es gar nicht abwarten, euch endlich zu sehen. Wenn wir nach Hause kommen, ist sie sicher schon zurück vom Termin mit ihrer Mutter.«
Das konnte ich mir nur zu gut vorstellen. Ein Termin mit Beas Mutter war auch nichts, was ein normal denkender und fühlender Mensch freiwillig in die Länge zog. Eine Stunde reichte da schon, um für die nächsten Wochen traumatisiert zu sein. Sagte Papa jedenfalls, ich hatte sie persönlich noch nicht kennengelernt.
Wir machten uns auf den Weg zurück ins Parkhaus, und Papa versuchte angestrengt, mit den Zwillingen ins Gespräch zu kommen. Was nicht leicht war, denn ihre Antworten fielen, soweit ich das mitbekam, ziemlich einsilbig aus. Armer Papa.
Während die drei vor uns gingen, nahm Mats mich kurz zur Seite und raunte mir ins Ohr: »17:3, Lina. Vielleicht soll es einfach doch nicht sein.«
»Du hast doch gesagt, dass ich es mit dem Glückbringen versuchen soll!«
Er zuckte entschuldigend mit den Schultern. »Alte Gewohnheit, schätze ich.«
Ich seufzte. Ich wollte es ja nicht zugeben – aber vielleicht hatte mein Bruder damit ausnahmsweise mal recht.
Mats’ und meine alte Gewohnheit ging auf einen Kindheitsspleen von mir zurück. Als ich klein war, hatte ich nämlich einen Tick. Während meine damalige beste Freundin Susu aus dem Kindergarten den ganzen Tag ihr imaginäres Zauberpony versorgte, war ich der Meinung, dass ich Glück bringen kann. Also, so richtig Wünsche erfüllen und so. Und meine Familie hatte mich darin sogar unterstützt! Na ja, zumindest hatten sie mich nicht ausgelacht. Das mochte daran liegen, dass meine Ururgroßmutter niemand anderes war als Gloria Petrus aus dem Dorf Himmelstor (heute ist das ein Vorort unserer Stadt). Gloria ist so eine Art Stadtlegende. Von ihr erzählen sich die Leute noch heute, dass sie vor vielen, vielen Jahren Herzenswünsche erfüllen konnte. Die Wünsche konnte man in einem Schließfach im Postamt hinterlegen. (Damals gab es noch keine E-Mails oder Computer oder Internet … ziemlich gruselige Vorstellung, ich bin ja so was von froh, in der heutigen Zeit zu leben!)
Durch ihren hübschen Namen, ihr einnehmendes Wesen und ihre spezielle Fähigkeit begannen immer mehr Leute, ihre Wünsche an ihr Postfach zu schicken, in der Hoffnung, dass Gloria sie erfüllen würde. Ob meine Ururgroßmutter das jedoch wirklich konnte, kann mir allerdings heute niemand mehr sagen. Viele behaupten, ja. Und weil die Geschichte so schön ist, möchte ich gerne daran glauben.
Nach ihrem Tod hörte das Briefeschreiben der Leute nach und nach auf. Bis vor etwa zehn Jahren ein Journalist auf die alte Stadtlegende stieß. Er recherchierte und fand heraus, dass das Postfach immer noch existierte. Seit seinem Artikel füllt sich das Fach wieder mit Briefen. Viele Kinder schreiben wieder ihre Weihnachtswünsche dorthin, weil sie denken, dass ihre Briefe dann direkt in der Himmelswerkstatt landen. Mama und ich beantworteten sie alle, in Gedenken an Ururgroßmutter Gloria. Einmal die Woche setzten wir uns gemeinsam hin und bastelten bei Kerzenschein und schöner Musik kleine Antwortkarten.
Ich dachte als Kind immer, dass ich diese besondere Gabe geerbt hatte. Und meine Eltern ließen mich in diesem Glauben, was ich aus heutiger Sicht sehr nett von ihnen fand. Nur Mats hat mich als Einziger immer aufgezogen, vor allem, weil ich als Sechsjährige so ein komisches Ritual hatte, von dem ich dachte, dass es beim Glückbringen helfen würde. Und das ich heute aus alter Gewohnheit wieder abgespult hatte.
Ja, ich hatte lange an mich geglaubt. Und in meiner Erinnerung hat es wirklich geklappt, ziemlich oft sogar! Aber jetzt, wo ich fünfzehn und damit fast erwachsen bin, hat mich die Realität eingeholt. Ich habe akzeptiert, dass es so was wie gezielte Wunscherfüllung nicht gibt. Alles nur Zufall oder Einbildung. Dass ich nichts Besonderes bin, keine Glücksbringerin, und schon gar nicht Wünsche erfüllen kann, seien es meine eigenen oder die von anderen.
Und trotzdem passiert es ab und an, dass es mit mir durchgeht und ich mein kleines Tänzchen aufführe, weil insgeheim doch noch ein Fitzelchen in mir glauben will, damit alles zum Besseren wenden zu können. Mein Bruder lauert nur so auf solche Gelegenheiten, ja, er stachelt mich sogar an, denn er ist besessen davon, mir zu beweisen, dass ich spinne. Deswegen diese Wette. Und auch wenn mir sonnenklar ist, dass ich haushoch verliere – ich sag nur 17:3!!! (wobei meine drei mickrigen Treffer leider Zufall waren) –, kann ich einfach noch nicht aufhören. Ja, ich weiß, ich bin inzwischen schon viel zu alt für solche Träumereien. Und doch ertappe ich mich manchmal bei dem Gedanken, dass es trotz allem ein bisschen schade ist.
Wir waren mittlerweile wieder im Parkhaus angekommen. Papa hat zwar ein großes Auto, aber wir alle hatten nicht an die überdimensionalen Reisetaschen der Jungs gedacht, die sich jetzt nicht nur im Kofferraum, sondern auch auf der dritten Sitzreihe stapelten.
Was bedeutete, dass ich mich auf die Rückbank zwischen die beiden fröhlichen Plaudertaschen quetschen musste. Hundemüde machte dabei seinem Namen alle Ehre. Kaum hatte Papa das Auto aus der Parklücke auf die Straße gelenkt, sackte sein Kopf schon an die Scheibe, er verlor jede Körperspannung und fing an, tief zu schnaufen.
Der Schweiger zu meiner linken Seite allerdings schien noch um einiges fitter zu sein. Kerzengerade saß er neben mir und starrte aus dem Fenster.
Es musste ein komisches Gefühl sein, nach einem Jahr Kanada wieder hier zu sein. Und noch komischer, dass sich in der Familie einiges ändern würde. Denn ab morgen wohnten wir alle zusammen.
Papa und die Mutter der Zwillinge, Bea von Bergen, hatten sich vor einem guten Jahr bei unserer Freundin Therese kennengelernt, der das österreichische Feinkostgeschäft um die Ecke gehört. Die beiden hatten beim Einkaufen gleichzeitig nach einem Glas mit steirischer Marillenmarmelade gegriffen, und – ja, es hört sich super kitschig an – nach drei Sekunden Blickkontakt war es um sie geschehen. Sie verliebten sich Hals über Kopf ineinander und sind praktisch seitdem zusammen. Bea schwört heute noch Stein und Bein, dass es nicht Papas gutes Aussehen war, das sie beeindruckt hatte. (Er kam damals nämlich gerade von der Arbeit und trug noch seine Pilotenuniform.) Nein, es war der Funke, der praktisch sofort übergesprungen ist – direkt von Papa über das Marmeladenglas bis zu Bea. Und so, wie Bea meinen Papa immer ansieht, glaube ich ihr.
An göttliches Schicksal, das sie zusammengeführt hat, glauben beide allerdings erst, seit sie herausgefunden haben, dass sie direkt nebeneinander wohnen. Zwar nicht im selben Haus, aber im benachbarten. Selbes Stockwerk, selbe Seite – und so würde morgen ein Bauunternehmen kommen, in die trennende Wand ein Loch schlagen und eine Tür einsetzen. Damit wäre dann das letzte Hindernis überwunden, und Bea, Papa, Vincent, Arthur, Mats und ich würden in einer riesigen zusammenhängenden Wohnung leben. Ich für meinen Teil freute mich sehr darauf, genau wie Mats, der sogar ab morgen mit den Zwillingen in eine Stufe gehen würde.
Aber was in Beas Söhnen vor sich ging, das konnte man wirklich nicht ansatzweise erahnen.
»Hast du Deutschland vermisst?«, fragte ich den Schweiger neben mir. Vielleicht konnte man ja mit gezielten Fragen irgendetwas aus ihm herauslocken.
Er zuckte mit den Schultern. »Nicht wirklich«, murmelte er. Zumindest sprechen konnte er.
»Ja, na ja, morgen geht ja auch schon wieder die Schule los, das ist natürlich blöd. Aber freust du dich nicht auf deine Freunde? Und auf Bea? Oder gibt man das nicht zu, wenn man cool sein will?«
Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Vielleicht, weil er mich schon wieder so strafend ansah, als ich seine Mutter erwähnt hatte.
»Ich mag sie sehr, übrigens.«
»Schön für dich«, murmelte er und drehte sich wieder Richtung Fenster. Seine Körpersprache verriet mir, dass er sich zumindest nicht auf das Zusammenleben mit seiner neuen Stiefschwester freute. Mehr oder weniger unauffällig versuchte er nämlich, von mir wegzurutschen, um mich nicht berühren zu müssen. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, hatte aber in diesem Moment auch keine Lust auf eine Diskussion über gutes Benehmen.
Ich glaubte sowieso nicht, dass sich so viel ändern würde, auch wenn der Mauerdurchbruch zwischen Papas und Beas Wohnung gemacht war. Schließlich behielt jeder sein eigenes Reich, aber dank der neuen Tür konnten wir uns in Zukunft wenigstens sparen, im Schlafanzug die Treppe runter, über den Gehweg und wieder zur anderen Tür hineingehen zu müssen, wenn wir zusammen frühstücken wollten.
Um das Schweigen im Auto zu unterbrechen, fing ich deswegen an, dem wachen Zwilling von den Bauarbeiten zu erzählen, ob er wollte oder nicht. Davon, wie das Bauunternehmen schon die Stelle rund um den Durchbruch vorbereitet hatte, und dass der Folienverschlag in unserem Flur aussah wie die schäbige Dusche damals auf dem Campingplatz an der Adria. In diesem Urlaub hatte mich erst eine Qualle erwischt und dann die Magen-Darm-Grippe der Nachbarskinder, mit denen ich immer unterwegs war.
Doch ich hätte genauso gut mit dem Gepäck hinter mir reden können – der Typ zeigte keinerlei Reaktion, antwortete nicht, ja, er schaute mich noch nicht mal an.
Also hielt ich irgendwann den Mund und atmete direkt auf, als Papa das Auto in der Straße vor unserem Haus parkte.
Und außer einem gemurmelten »Danke, bis später« brachten meine neuen Stiefbrüder auch nichts mehr über die Lippen, ehe sie mit ihren vollgestopften Taschen im Hauseingang verschwanden und uns drei auf dem Gehweg zurückließen.
»Die sind nett«, sagte ich.
»Das wird schon«, sagte Papa, dem mein sarkastischer Ton nicht entgangen war. »Lass die zwei sich mal ordentlich ausschlafen, dann sind sie zwei neue Menschen.«
Ja, zwei neue Menschen wären prima. Diese beiden hier fand ich nämlich nicht so prickelnd.
2
Der erste Tag unseres neuen Lebens begann am nächsten Morgen Punkt sieben Uhr früh, an einem Montag im September. Es war der erste Schultag – aber das war noch nicht mal ansatzweise so spannend wie das, was in unserer Wohnung passierte.
»Also, ich sach mal so, wenn ihr Kinder heute Nachmittag aus der Schule kommt, ist hier alles erledigt. Da könnt ihr dann hin und her gehen, wie ihr lustig seid. Ein Durchgang, der so aussieht, als ob er immer schon da gewesen wäre.«
Papa, Mats und ich standen im Flur unserer Altbauwohnung und schauten auf den gewaltigen Folienverschlag, den Herr Gieseke vom Bauunternehmen bereits letzte Woche aufgestellt hatte.
»Keine Sorge, ich hab auf den Holzboden dreifach Vlies gelecht, damit da nix passiert. Ich meine, wenn die Mauerbrocken zu groß sind und beim Rausschneiden runnerfallen, dann kann’s passieren, dass sie durch den Boden brechen und – zack! – auf dem Esstisch eurer Nachbarn unter euch liegen bleiben.«
Ich stellte mir unwillkürlich Frau Clements Gesichtsausdruck vor, wenn ihre geliebte Suppenterrine mit Bouillabaisse von einem zentnerschweren Mauerbrocken zerschmettert würde – mitsamt ihrer Zimmerdecke.
Papa hatte anscheinend das gleiche Bild vor Augen.
»Es macht uns wirklich nichts aus, wenn es länger dauert. Lieber, äh, nicht die Sache mit der Suppe.« Frau Clement (oder Madame Clement, wie wir sie nennen, schließlich kommt sie aus Frankreich) hat nämlich eine Schwäche für handbemaltes Porzellan aus Marseille. Viel handbemaltes Porzellan. Ihre komplette Wohnung sieht aus wie einer dieser Souvenirläden, in denen Mama immer etwas mitnimmt, weil sie meint, die Besitzer kämen anders nicht über die Runden angesichts des Plunders, den doch sonst niemand kaufen würde. Also, zumindest Madame Clement schien dort regelmäßig zuzuschlagen. Bis zum Alter von acht Jahren durften Mats und ich sie deshalb nicht besuchen. Papa meinte, dass der Versicherungsschutz unserer Haftpflicht da nicht mitgemacht hätte.
Herr Gieseke und sein schnauzbärtiger Kollege standen immer noch neben uns und beratschlagten jetzt über ihre Vorgehensweise. So einfach und unproblematisch, wie er das gerade angepriesen hatte, war es dann wohl doch nicht. Aber immerhin ging es auch um einen türhohen Ausschnitt in der Wand. Das fast meterdicke Mauerwerk musste dabei vorsichtig mit einer speziellen Säge geschnitten und dann scheibchenweise aus der Wand gelöst werden – damit eben die Sache mit den großen Felsbrocken und Madame Clements Suppe nicht passierte.
»Ich glaube, ich ruf mal den Mike an, damit er uns Verstärkung schickt«, sagte Herr Gieseke und verschwand mit seinem Telefon im Treppenhaus.
Vermutlich keine schlechte Idee, denn auch Papa nickte sofort ganz eifrig. Er war ein sehr friedliebender Typ und hatte gerne ein gutes Verhältnis zu seinen Nachbarn.
Herr Gieseke hatte den Auftrag für die Baumaßnahmen bekommen, weil er der Schwager von Kathrin aus dem zweiten Stock in Beas Haus war und da auch schon mal zwei Wohnungen miteinander verbunden hatte. Bea war mit ihr befreundet und hatte sich sofort die Adresse geben lassen, nachdem sie und Papa beschlossen hatten, die Sache mit der gemeinsamen Wohnung durchzuziehen.
Mats und ich fanden Papas Freundin cool. Ich glaube zwar, dass viele Leute aus unserem Bekanntenkreis für uns gehofft hatten, dass Mama und Papa wieder zueinanderfinden würden, aber Mats und ich sahen das nicht so. Bea passte langfristig gesehen viel besser zu Papa. Und Mama würde auch noch ihren Traumprinzen kennenlernen, da war ich mir sicher.
Meine Eltern hatten sich vor gut siebzehn Jahren bei einem Rucksackurlaub mitten in den peruanischen Anden kennengelernt. Ein paar gemeinsame Tage und Nächte ohne Strom und fließend Wasser auf einer Yakfarm hatten gereicht, dass sie sich drei Wochen später nach ihrer Rückkehr ihre erste gemeinsame Wohnung suchten. Ohne Yaks und die lästigen Bettflöhe von dort, dafür mit meinem Bruder Mats als Souvenir, der sich knappe neun Monate später in ihrem Einzimmerapartment einnistete.
Damals waren beide Mitte zwanzig und so verliebt ineinander, dass sie kaum Essen oder Schlaf brauchten (so erzählt Mama es jedenfalls immer). Sie genossen ihr Leben und ihre junge Liebe in vollen Zügen, und meinen Bruder schleppten sie einfach überallhin mit. Sogar in den Himalaya, wo ich im Jahr darauf entstanden bin. (Wenn man bedenkt, wie viel Angst ich vor großen Höhen oder vor dem Fliegen habe, erscheint es mir als reinste Ironie, dass der Grundstein für mein Leben irgendwo zwischen Kathmandu und dem Everest-Basislager gelegt wurde.)
Nach Mats’ und meinen Babyjahren allerdings wurde meinen Eltern klar, dass das bei ihnen mit der ewigen Liebe doch nicht so hinhauen würde. Sie trennten sich als Freunde, die sie noch heute sind. Mats und ich blieben bei unserer Mutter, während Papa nur fünf Minuten von uns eine andere Wohnung nahm, und wir sahen ihn so oft, dass es für uns Kinder am Ende keinen großen Unterschied machte, ob er bei uns übernachtete oder nicht. Papa und Mama waren immer da für uns, und weder damals noch heute fühle ich mich als Scheidungskind.
Vor über einem Jahr bekam Mama dann die Chance, für ihre Firma nach New York zu gehen – begrenzt auf zwei Jahre, dennoch würde in dieser Zeit ein ganzer Ozean zwischen uns liegen. Und obwohl ich gewusst hatte, dass ich sie unheimlich vermissen würde, überredeten Mats und ich sie, sich ihren Traum zu erfüllen und zu fliegen. Wir bleiben in der Zwischenzeit bei Papa, der ja nur um die Ecke wohnte, weshalb wir unser Leben praktisch nicht umstellen mussten. Papa fliegt Langstrecke, was bedeutet, dass er viel zu Hause ist, bis auf ein paar Tage im Monat, die er in L.A. oder Dubai oder Singapur oder sonst wo verbringt. Da ist dann Therese da, Mats’ und meine Patin, die sich um uns kümmert.
Unser Arrangement klappt wirklich gut, auch wenn Mama mir natürlich fehlt. Aber wir telefonieren und skypen so oft wie möglich, und es vergeht selten ein Tag, an dem wir uns nicht sprechen. Und schließlich ist Bea ja auch noch da. Die war heute Morgen allerdings noch gar nicht bei uns gewesen, im Gegensatz zu sonst. Wahrscheinlich hatte sie nebenan alle Hände voll zu tun, die Zwillinge aus dem Bett zu trommeln und sie in die Schule zu schicken. So müde, wie die beiden gestern Nachmittag gewesen waren, war das sicher kein leichter Job. Aber dafür hatte sie für heute Abend schon ein großes Abendessen angekündigt. Das erste gemeinsame Familienessen in der neuen, zusammenhängenden Wohnung.
Ich für meinen Teil freute mich darauf.
Während Herr Gieseke telefonierte und anschließend seine Maschinen verkabelte, holten Mats und ich unsere Müslischalen aus der Küche und setzten uns auf die Schuhbank im Flur, um ja nichts zu verpassen. Ich glaube, neugieriger als wir war nur Papa, der die ganze Zeit vor uns auf und ab tigerte. Für ihn war das Zusammenlegen der Wohnungen eine Riesensache, vor allem, weil jetzt auch die Zwillinge zurück waren. Obwohl sich alle einig waren, dass er für die beiden Sechzehnjährigen nicht einen auf Vater machen sollte, war er dennoch ein bisschen aufgeregt.
»Papa, entspann dich«, sagte Mats und schaufelte sich einen Löffel Haferflocken in den Mund. »Alles wird gut. Das wird toll, sogar Mama findet, dass wir den Durchbruch machen sollen.«
»Hm … aber was ist, wenn sie mich doch nicht mögen?« Papa schob die Hände in die Taschen seiner Cargohose und schaute in Richtung Folienverschlag.
»Wer denn, die Zwillinge? Was gibt’s da nicht zu mögen?«, fragte ich. »Im Urlaub fanden sie dich nett, und nach der Businessklasse hast du sowieso einen Stein bei denen im Brett, hat Bea gesagt. Das klappt schon. Solange Madame Clements Porzellan heil bleibt, ist alles klar. Oh, schau mal, da ist er ja wieder. Geht’s jetzt endlich los? Wird es sehr laut?«
Herr Gieseke war wieder im Flur aufgetaucht, in jeder Hand eine Kabeltrommel.
»Was die Stromversorgung angeht, sind Altbauten nicht so wirklich praktisch«, schnaufte er, »ich musste im Keller bei den Waschmaschinen kurz was umstecken, aber ich denke, jetzt geht es.«
Zusammen mit seinem schnauzbärtigen Kollegen machte er sich daran, die große Mauersäge anzuschließen.
»Bereit? Es könnte laut werden.«
»Kein Problem!«, riefen wir drei unisono zurück, und Gieseke nickte.
»Dann mal los.«
Er verschwand zusammen mit dem Schnauzbart hinter den Folien. Und dann wurde es wirklich laut. Wer immer in diesem Haus bis jetzt noch geschlafen hatte – jetzt war er definitiv wach.
Allerdings kamen die beiden nicht weit: Keine zwei Minuten später standen schon die ersten Nachbarn in unserer Tür. Und zwar nicht in Form von Madame Clement.
Bedauerlicherweise.
»Wie kommt ihr dazu, im Keller den DSL-Verteiler auszustecken?«, schrie Mandy Rauhe, die im Erdgeschoss zusammen mit ihrem Freund Ralf wohnt. Beide studieren Soziologie und sind erstaunlich viel zu Hause. Das weiß ich, weil beide ihre Schreibtische so aufgestellt haben, dass sie, wenn sie daran sitzen, genau aus dem Fenster sehen können. Jedes Mal, wenn man unten am Haus vorbeigeht, sieht man mindestens einen von beiden oder beide gleichzeitig hinausschauen. Vielleicht müssen sie das tun, um für ihr Studium zu recherchieren – sicher ist nur, dass sie alle Leute aus ihrer näheren Umgebung tagtäglich beobachten. Und das machen sie auch ganz ungeniert – so richtig mit Kissen auf der Fensterbank und so. Und wenn man sie dann grüßt oder zumindest winkt, gucken sie einen nur an wie Kühe auf der Weide, die beim Wiederkäuen erwischt wurden. Was ich persönlich ziemlich unhöflich finde, genau wie das Beobachten generell, und deswegen mag ich die beiden auch nicht besonders.
Wenn jemand allerdings deswegen mal was zu ihnen sagt, werden sie gleich fuchsteufelswild und beschweren sich, dass man sie nur nach ihrem Äußeren beurteilt und sowieso einfach generell Vorurteile gegen sie hätte.
Ich habe keine Vorurteile, mir ist es eigentlich total egal, wie jemand aussieht oder sich anzieht. Aber hingucken muss ich trotzdem immer, wenn ich Mandy oder Ralf sehe, Mats und ich haben nämlich mal nachgezählt: Sie haben beide zusammen neun Piercings an Mund und Nase, dreiundzwanzig Ohrringe und geschätzt drei Quadratmeter an Tattoos. Aber nicht so was Cooles wie bunte Blumenranken, sondern derbe Anker, Totenköpfe und Kreuze und so was alles, aber gut, das war ja eine Frage des persönlichen Geschmacks. Doch obwohl die beiden mit ihrem Äußeren wirklich auffallen und so anders sind als die meisten, sagt Papa immer, dass sie die größten Spießer seien, die er kenne.
Und der hässliche, braungemusterte Frotteebademantel und die Lammfellpantoffeln, die Mandy an diesem Morgen anhatte, gaben ihm da zumindest ein kleines bisschen recht.
»Wir brauchen das Internet!!!«, kreischte sie fast so laut wie eben noch die Mauersäge, und Herr Gieseke ging instinktiv einen Schritt rückwärts.
»Das Kabel im Keller war nicht beschriftet, also –«
»Wir, wir … müssen doch … lernen! Mit Internet! So eine Frechheit, man kann doch nicht einfach das DSL kappen! Ich, ich … habe ein Recht auf Internet!!!« Mandy kriegte sich überhaupt nicht mehr ein, und aus ihrem Mantelkragen krochen rote Flecken ihren Hals hinauf bis zu ihren silbernen Ohrsteckern.
»Ich glaube eher, die haben die ganze Nacht durchgezockt«, flüsterte Mats mir zu, der sich mit mir sicherheitshalber ein paar Schritte in Richtung Küche zurückgezogen hatte. »Wahrscheinlich waren die gerade beim letzten Level von ihrem Online-Ballerspiel, als der Gieseke den Stecker gezogen hat.« Er räusperte sich und sagte lauter: »Ihr Armen, müsst ihr wirklich schon so früh lernen?«
Die roten, glasigen Augen und der mörderische Blick, den Mandy Mats gerade zuwarf, sprachen Bände.
»Ja, ich überlege mir tatsächlich auch, ob ich überhaupt mal studieren soll«, überlegte ich laut, »es sieht bei Mandy so anstrengend aus. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist.«
»Ihr zwei da hinten haltet die Klappe!«, keifte sie jetzt und versuchte, mit einer furchteinflößenden Kopfbewegung ihre halblangen Haarsträhnen aus dem Gesicht zu werfen.
»Gute Ohren hat sie, das muss man ihr lassen«, sagte Mats kichernd, aber vorsichtshalber zog ich ihn am Ärmel ganz in unsere Küche, um aus Mandys Blickfeld zu verschwinden. Sie hatte nämlich gerade einen besorgniserregenden Blick auf den großen Vorschlaghammer der Baufirma geworfen.
Nur nix riskieren.
»Sagt mal, müsst ihr nicht in die Schule?«, fragte Papa, und ich warf einen Blick auf die Küchenuhr.
Mist!
»Viertel vor acht, Mats, mach schnell!!!«
Mein Bruder fluchte ebenfalls, pfefferte seine Müslischale in die Spüle und grapschte nach seinem Rucksack. Bevor wir loskonnten, mussten wir allerdings noch an Mandy vorbei, die dummerweise Verstärkung von Ralf bekommen hatte, der sich wie ein Bodyguard hinter ihr in unserer Wohnungstür aufgebaut hatte (aber deswegen nicht weniger müde aussah) und Papa und Herrn Gieseke weiterhin übel beschimpfte.
Papas Gesichtsausdruck nach zu schließen fand er das gar nicht lustig, aber ich wusste, dass er eigentlich den Hausfrieden wahren wollte, weswegen er die Beschwerden an sich abprallen ließ.
»Schaut auf eure Handys, ehe ihr in die Schule geht«, raunte er uns allerdings noch zu, »wenn ich in fünfzehn Minuten keine Nachricht geschrieben habe, haben sie uns wahrscheinlich gemeuchelt. Ruft dann die Polizei und kommt nicht mehr her, verstanden?« Er tat so, als ob er flüsterte, dabei konnte ich am Funkeln in seinen Augen sehen, dass die beiden Zocker-Zombies jedes Wort verstehen sollten.
»Alles klar, Papa!«, sagte Mats mit todernster Miene. »Am besten sollen sie gleich das SEK schicken, oder?«
»Ja, wäre das Beste. Also, falls wir uns nicht mehr sehen: Ich hab euch beide sehr lieb.« Er hustete theatralisch. »Es war so schön, euer Papa zu sein. Na ja, und falls doch: Bis später, schönen ersten Schultag!«
Laut lachend schoben Mats und ich uns an Mandy und Ralf vorbei und rannten die Treppe hinunter.
3
Mats und ich rasten wie zwei Irre durch die Straßen, ähnlich wie gestern am Flughafen. Unsere Schule lag nur zehn Minuten von der Königinstraße entfernt, in der wir wohnten, und heute schafften wir es dank des Sprints in fünf.
Trotzdem lag der Pausenhof ausgestorben vor uns, aber es war auch kurz vor acht. Alle hatten sich schon in Richtung ihrer Klassenzimmer getrollt, wo es den obligatorischen Kampf um die Sitzplätze geben würde, wie an jedem ersten Schultag. Ich keuchte, als ich hinter meinem Bruder die steinernen Treppenstufen hinaufrannte, und fluchte innerlich.
Was hatte ich mich eigentlich auf diesen Tag gefreut! Das durfte ich natürlich nicht so laut sagen, sonst würden meine Freunde mich für bekloppt halten, doch es war tatsächlich so. Am ersten Schultag war alles so frisch und unverbraucht: die brandneuen Hefte, die gespitzten Stifte, die ordentlichen Klassenzimmer … Ich für meinen Teil feierte immer so ganz für mich ein kleines Neujahrsfest. Alles neu, alles auf null. Wer wusste, was das Jahr bringen würde?
Außerdem war ab heute Schluss mit meinem Dasein in dem hässlichen, pseudomodernen Anbau, in dem die Fünft- bis Achtklässler untergebracht waren. Ab diesem Tag gehörte ich endlich zu den Großen. Wir bekamen einen Klassenraum im gediegenen Altbau, und die Pausen durften wir in Zukunft am Platz vor dem Gebäude verbringen und wurden nicht mehr auf dem kargen Innenhof tausendmal von wild rennenden Fünftklässlern angerempelt.
Obwohl ich so in Eile war, erfasste mich in diesem Moment große Vorfreude. So viele Möglichkeiten, so viel Neues, so viel – ach, es roch sogar ganz anders im Altbau, stellte ich fest, als ich neben Mats die geschwungene Steintreppe nach oben spurtete. Nicht mehr nach Kinderschulranzen, ranziger Milch und ungewaschenen Sporthosen, sondern nach Leder, Büchern, Coolness und Kaffee. Im zweiten Stock lagen im rechten Flügel die Klassenräume der Neunten und auf der anderen Seite die der Zehnten – also die von Mats, Vincent und Arthur, die in diesem Schuljahr sogar in die gleiche Klasse gehen würden. Aber natürlich waren die alle schon in ihren Zimmern, nur wir Hansson-Geschwister tanzten mal wieder aus der Reihe. Wobei Mats sich nicht sonderlich aufregte – das tat er nie, und damit kam er erstaunlich gut durchs Leben, denn es fügte sich alles sowieso irgendwie. Eine Eigenschaft, um die ich ihn manchmal beneidete.
Ich winkte ihm zu und rannte, als wir oben angekommen waren, sofort nach rechts zu unserem neuen Klassenzimmer.
Bitte, bitte, lass die Hempe noch nicht aufgeschlossen haben! Ich muss für Kim und mich einen guten Platz ergattern, ich hab’s versprochen!
Gute Plätze waren in der Schule das A und O. Die kamen noch vor guten Lehrern und sogar vor gutem Essen in der Cafeteria. Und da ich im Gegensatz zu meiner besten Freundin Kim kein Morgenmuffel bin und gut aus dem Bett komme, hatten wir seit Jahren die Abmachung, dass ich an Großkampftagen aka ersten Schultagen früh da sein würde. Das hatte auch immer super geklappt. Bis heute.
Doch an diesem Morgen hatte ich noch nicht mal einen Hauch von Glück. Die Tür zu meinem Klassenzimmer stand bereits weit offen, und fast alle anderen waren schon da.
Nur noch ein einziger Tisch war frei.
Der, der direkt in der ersten Reihe vor dem Lehrerpult stand.
Mist. Kim würde mich umbringen.
»Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?« Die Stimme meiner besten Freundin drang in mein Ohr, und als ich mich umdrehte, funkelte sie mich aus ihren dunklen Mandelaugen vorwurfsvoll an. »Ich hab mich auf dich verlassen!«
»Kimmi, es tut mir echt leid … bei uns war zu Hause die Hölle los. Mandy und Ralf waren da, im Frottee-Kampfanzug!«
Kim seufzte und zog mich zum freien Platz. »Ich wollte doch ans Fenster und an die Heizung. Jetzt denken alle, dass wir Streber sind.«
»Nein, jetzt denken alle, dass wir so cool sind, dass wir uns sogar einfach vors Lehrerpult setzen.«
»Ja, genau.« Sie rollte mit den Augen und warf ihr langes, pechschwarzes Haar in einer fließenden Bewegung über die Schulter. Kims Mutter ist aus Singapur und hat ihr jede Menge tolle Gene vererbt. »Vorbei die geflüsterten Unterhaltungen in der letzten Bankreihe, vorbei Zettelchen schreiben, vorbei –«
»Vorbei die Augen zusammenkneifen und Falten um die Augen bekommen, weil man von hinten fast nichts mehr sieht«, sagte ich, während ich mich rechts von ihr auf den Stuhl fallen ließ. »Sieh es doch mal positiv: So brauchst du wenigstens dieses Jahr noch keine Brille, weil du alles prima lesen können wirst.«
Kim seufzte. »Okay. Schön. Ich will wirklich keine Brille. Jetzt erzähl, was ist bei euch zu Hause los? Ist das Loch schon in der Wand?«
»Ja, die hatten schon angefangen, aber dann kam Mandy rauf, und –«
»Hey, habt ihr gehört?« Mein guter Freund Simon, der hinter uns saß, tippte mich an. »Die Hempe ist anscheinend in den Ferien überraschend weggezogen, wir kriegen einen anderen Klassenlehrer.«
Kim wirbelte herum. »Woher weißt du das?«
Simon zuckte mit den Schultern. »Von meiner Schwester aus der Elften. Und die hat’s vom Hausmeister gehört.«
Kim sah mich mit aufgerissenen Augen an. »Nein, das darf nicht sein, die Hempe war die netteste Lehrerin der Schule! Nicht dass wir noch den Rümmel bekommen – oder die Olbricht.«
Das wäre wirklich fatal. Herr Rümmel war vielleicht noch ganz nett, doch roch er ganz unangenehm nach nassem Hund, der Kette rauchte – Kim und ich würden hier vorne ersticken. Und Frau Olbricht war ungefähr hundert Jahre alt, hörte schwer und trug immer ihre Pullunder verkehrt herum, so dass der V-Ausschnitt nach hinten zeigte und man ständig daraufstarren musste.
Bitte, bitte, ich wünsche mir, dass wir nicht Frau Olbricht bekommen, und auch nicht Herrn Rümmel. Bitte, ein netter Klassenlehrer muss her!
»Lina, könntest du vielleicht da ein bisschen … du weißt schon«, flüsterte Kim mir ins Ohr, damit die anderen uns nicht hörten. Als meine beste Freundin war sie über meinen Kindheitstick natürlich informiert und fand überhaupt nichts Lächerliches daran. Ganz im Gegenteil. Genau wie Mama hatte sie mich immer ernst genommen und unterstützt, weil sie der Meinung war, dass ich ihr schon mindestens drei Wünsche erfolgreich erfüllt hatte. (Nummer eins: Reitstunden mit acht, Nummer zwei: eine abgesagte Reise zur Verwandtschaft mit zwölf, und Nummer drei, erst vor kurzem: Kennenlernen von Moritz aus der Zehnten. Und mit dem war sie dann tatsächlich vor ein paar Wochen zusammengekommen!)
»Grad eben erledigt«, flüsterte ich, und Kim nickte zufrieden. Ich hatte zwar nicht meinen Tanz aufgeführt, aber damals bei den Reitstunden hatte ich das auch nicht. Vielleicht klappte es ja diesmal! Gebannt schauten wir wie alle anderen zur Tür, und ich hielt die Luft an, als endlich jemand den Raum betrat.
»Oooh …«, entfuhr es der ganzen Klasse gleichzeitig, und unsere diesjährige Klassenlehrerin blieb stirnrunzelnd vor der Tafel stehen.
»Für diese freundliche Begrüßung gibt’s heute gleich schon mal Hausaufgaben auf!«, sagte sie und verzog ihren Mund zu einem gehässigen Lächeln.
Ich unterdrückte ein Stöhnen.
Das waren nicht Frau Olbricht und auch nicht Herr Rümmel.
Sondern – Frau Blum.
Und an die hatten wir alle nicht gedacht. Dabei war sie viel schlimmer als beide zusammen. Die Abiturienten letztes Jahr hatten einen Teil ihrer Abizeitung aufgezogen wie einen Horrorcomic, und sie hatte darin die Hauptperson gegeben.
Mit einem lauten Knall pfefferte sie ihre vollgepackten Fahrrad-Satteltaschen vor Kims und meiner Nase auf das Pult, und wir hüpften vor Schreck auf unseren Stühlen nach oben.
»Also gut, Leute, dann fangen wir mal an. Ich bin Frau Blum. Ihr habt sicher schon von mir gehört. Ich bin eure neue Klassenlehrerin, und ihr habt bei mir Deutsch und Geschichte. Und« – sie fletschte ein Gebiss wie ein Hai – »Latein. Weil dieses Jahr so wenig Lehrer da sind, haben wir drei Fächer miteinander. Super, oder?«
Ihre Zahnreihen glänzten im Licht der grellen Deckenlampe, und ich schluckte.
Das lief ja mal … gar nicht gut.
Kim warf mir einen unglücklichen Blick zu, aber ich konnte nur mit den Schultern zucken. So viel zu dem Wunsch: Ein netter Klassenlehrer muss her.
Ich hatte also Frau Blum in Latein, Deutsch und Geschichte. Frau Olbricht in Erdkunde. Herrn Rümmel in Englisch. War Klassensprecherin geworden (weil sonst niemand wollte, und ich hatte die bleierne Stille um mich herum nicht mehr ertragen und mich gemeldet), Verwalterin der Klassenkasse (siehe oben) und verantwortlich für den riesigen Philodendron, der sich durch das gesamte Klassenzimmer schlängelte (weil – ja, genau – sonst niemand wollte). Meine Bilanz für das neue Schuljahr lief ganz klar ins Minus. Und das, obwohl ich mir so wünschte, dass der Tag nach dem unerfreulichen Start besser werden würde!
»Und dann auch noch Sport am Freitag in der zweiten und dritten Stunde! Dann bin ich den Rest des Tages völlig verschwitzt und zerzaust, das ist doch eine Zumutung!«, ereiferte sich meine beste Freundin, als wir in der Mittagspause in Richtung Cafeteria gingen.
Immerhin hier konnte ich sie beruhigen. Ich kannte keinen Menschen, der so wenig verschwitzt und zerzaust war wie Kim. Bei ihr saß jedes Haar tipptopp, sie schwitzte, wenn überhaupt, nur unsichtbar, roch nie und hatte so kleine Poren, dass man sie nur mit der Lupe sehen konnte.
»Und dann noch bei der Temme! Die wird uns auch den ganzen Winter draußen über den Platz scheuchen!«
Ja, die Sportlehrerin war ebenfalls nicht meine Wunschkandidatin, auch da war mein Versuch gescheitert, etwas zu bewirken. Und mit jedem Tiefschlag an diesem Vormittag sickerte in mir die Gewissheit weiter durch, dass es einfach nicht sein sollte. Dass ich wirklich null Einfluss auf meine Umwelt hatte. Ich wurde von meinen Mitschülern sogar mitfühlend angesehen, weil ich so ein Pech hatte, und bekam in der Pause Schokoriegel zugesteckt.
Also:
Wünsche erfüllen? Niemals.
Glück bringen? Fehlanzeige.
Stattdessen war ich viel zu gutmütig und ließ mir lauter doofe Jobs aufs Auge drücken, weil ich mal wieder nicht Nein sagen konnte.
So beschloss ich, mich den wirklich wichtigen Dingen des Lebens zu widmen und alles andere erst mal zu vergessen.
»Hm, hier riecht es sogar viel besser als in der Unterstufenkantine!«, sagte ich, als Kim und ich uns in der Mittagspause durch die vollen Gänge bis zur Cafeteria drängten.
In der Kantine im Altbau ging es deutlich gesitteter zu als in unserer früheren Mensa im Unterstufenbau. Nicht mehr so viel Schubsen, dafür mehr zu gucken und …
»Ravioli!«, rief ich erfreut.
Kim und ich reihten uns in die Schlange ein, um uns eine Riesenportion geben zu lassen.
Dieser Ort war ebenfalls einer der Gründe, warum ich mich auf die neunte Klasse gefreut hatte. Anstelle des riesigen, höllisch lauten Speisesaals drüben im Anbau hatte diese Kantine hier richtig Atmosphäre. Von der Essensausgabe aus ging man in einen breiten Flur, von dem nebeneinander insgesamt fünf kleinere Säle mit Tischen und Stühlen abzweigten, wo wir sitzen konnten.
Jeder Saal hatte an der Seite Flügeltüren, die auf eine gepflegte Terrasse hinausführten, die im Sommer ein ganz toller Ort für die Mittagspausen war. Gleich hinter der Terrasse erstreckte sich das dichte Grün des Botanischen Gartens, der direkt an unsere Schule grenzte, so dass man völlig vergessen konnte, dass man sich in einer Großstadt befand.
Jetzt im Herbst allerdings waren wir auf die Innenräume angewiesen – und wenig später wurde uns auch klar, was mit dem Wort gemütlich einherging: verdammt klein, wenn die Hälfte der Mittel- und Oberstufe auf einmal essen wollte.
Kim und ich versuchten unser Glück im ersten Speisesaal. Vor Jahren hatte mal eine Klasse hier die Aufgabe gehabt, unterschiedliche Bezeichnungen für die Räume zu finden und entsprechendes Informationsmaterial auszuhängen. Thema waren die Pioniere der Luftfahrt – es gab einen Gebrüder-Wright-Raum, einen Lindbergh-Raum und so, aber der Lehrer, dem dieses Projekt am Herzen gelegen hatte, war mittlerweile nicht mehr an der Schule, und niemand hatte sich seit dem engagierten Start weiter darum gekümmert.
Außer ein paar Schülern, die das Fliegereithema etwas anders interpretiert hatten.
Heute gab es daher die Räume mit den Namen Orion, Enterprise, Galactica, Millennium Falcon und Tardis. (Wobei der Tardis wirklich winzig war, aber das war das Gefährt von Doctor Who