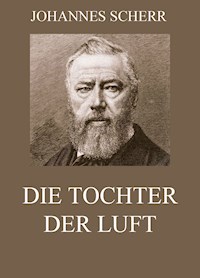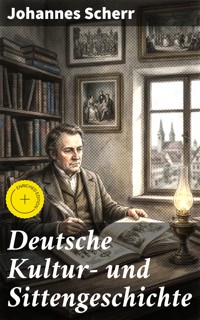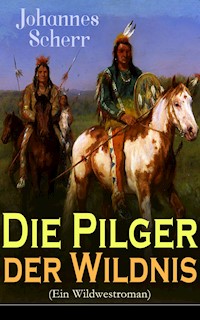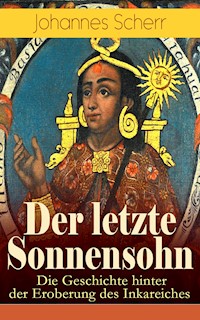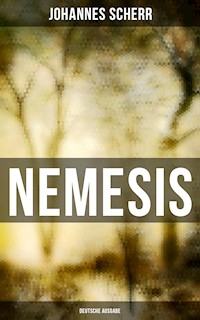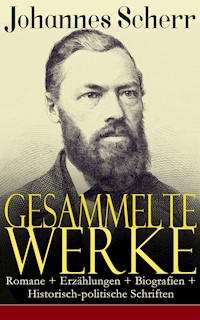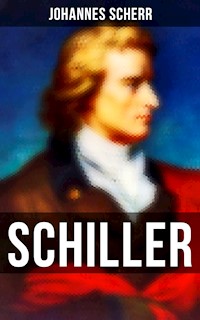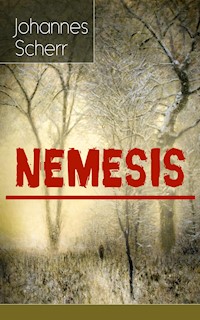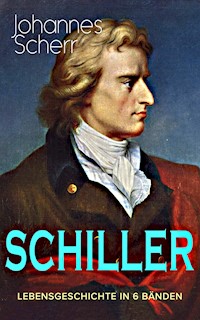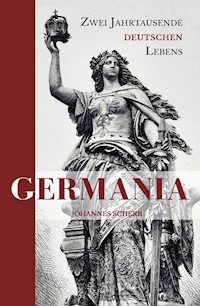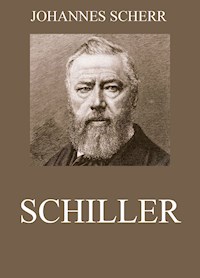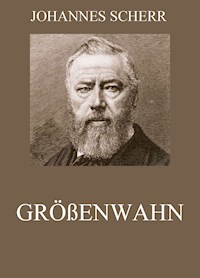1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In "Goethe" untersucht Johannes Scherr das vielschichtige Leben und Werk eines der bedeutendsten deutschen Dichter und Denker der Klassik. Mit einem eloquenten und analytischen Schreibstil gelingt es Scherr, Goethes literarische Entwicklung und seinen Einfluss auf die europäische Kultur tiefgründig zu erfassen. Indem er Goethes Werken, von seinen frühen Gedichten bis hin zu seinen philosophischen Schriften, einen breiten historischen Kontext verleiht, vermittelt Scherr ein eindrucksvolles Bild des Dichters, der in seiner Zeit sowohl Vorreiter als auch Rebell war. Die differenzierte Betrachtung von Goethes persönlichen Erfahrungen und deren Einfluss auf sein Schreiben sind besonders hervorzuheben. Johannes Scherr, ein renommierter Literaturwissenschaftler und Zeitgenosse der deutschen Romantik, bringt in diesem Werk seine umfassenden Kenntnisse und seine Leidenschaft für die deutsche Literatur ein. Seine tiefgehenden Forschungen über Goethe wurden durch seine eigene künstlerische Sensibilität und die turbulente politische Landschaft seiner Zeit geprägt. Scherr strebt an, die Komplexität von Goethes Charakter und dessen literarisches Erbe greifbar zu machen, was die Lektüre besonders fesselnd macht. "Goethe" ist ein unverzichtbares Werk für jeden, der sich für die deutsche Literatur und die kulturelle Identität des 18. Jahrhunderts interessiert. Scherr gelingt es, Leser sowohl einzuführen als auch herauszufordern, indem er die universelle Relevanz von Goethes Gedanken in einer sich wandelnden Welt aufzeigt. Dieses Buch bietet nicht nur eine Einführung in Goethes Werk, sondern auch einen tiefen Einblick in die Seele eines Künstlers, dessen Ideen und Emotionen bis heute nachhallen. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Goethe
Inhaltsverzeichnis
Goethe
„Räthin[2], er lebt![2q]“
Dieses Zurufswort sprach in froherregtem Großmutterton eine „schöne, hagere, immer weißgekleidete“ Greisin zu ihrer achtzehnjährigen Schwiegertochter, welche bleich und erschöpft in ihren Kissen ruhte, jetzt aber die dunkelbraunen Augen mutterfreudig aufschlug und ihrem neununddreißigjährigen Eheherrn, der gefaßt und „geradlinig“ wie ein richtiger Reichsstadt[6]bürger, aber nicht theilnahmlos an ihrem Bette stand, die Hand drückte.
Das geschah am 28. August 1749 in der altfränkisch getäfelten Schlafstube eines alterthümlichen Bürgerhauses „im Hirschgraben[3]“ zu Frankfurt am Main. Der Nachhall vom Mittagsstundenschlag der Domuhr[5] zitterte noch in der Luft. Die Gestirne blickten günstig: die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau, und Jupiter und Venus sahen freundlich auf sie.
Drei Tage und Nächte hatte die junge schöne Mutter in harten Wehen gerungen[3q]. Es galt aber auch einen Löwen zur Welt zu bringen, einen rechten Mannlöwen: den Johann Wolfgang Goethe. Als der Junge endlich erschien, gab er kein Lebenszeichen und war „ganz schwarz, wie aus Zorn, daß ihn die Noth aus dem eingeborenen Wohnort getrieben“. Da legte man den armen Wurm, aus welchem der größte Mann seiner Nation werden sollte, in einen sogenannten „Fleischnarden[4]“ und bähete ihm die Herzgrube mit warmem Wein. Das bekam ihm gut und ermunterte seine Lunge zum Athmen. Das Kind that die Augen auf – große, dunkelbraune, strahlende wie die mütterlichen – und wimmerte das Licht an wie der allergewöhnlichste neugeborene Sterbliche. Denn
„Wenn wir geboren werden, weinen wir[4q], Daß wir die große Narrenbühne Welt Beschreiten müssen“ –
steht ja geschrieben beim menschengeschickekundigsten Seher. Aber die einundachtzigjährige Großmutter Cornelia trat an das Lager der Wöchnerin mit der frohen Botschaft: „Räthin, er lebt!“ und die Eltern freuten sich, jedes in seiner Art: der Vater, Johann Kaspar, würdevoll und stillvergnügt, wie es einem kaiserlichen Titular-Rath[7] geziemte, und die Mutter Katharina Elisabeth hellauf in Begeisterung. Das ist ja das größte Wunder in dieser unserer wunderlichen Welt, daß Väter und Mütter immerfort und immerfort in Freude einander die Hände drücken, wenn ihnen gesagt wird: „der Junge lebt!“ oder „das Mädchen athmet!“ nicht bedenkend, daß dieses „lebt“ oder „athmet“ nur ein dunkles Räthsel ist, welches die Gegenwart der Zukunft aufgiebt und dessen Auflösung selten Glück, zumeist aber Leid, Schmerz, Enttäuschung, Ergebung oder Verzweiflung heißt.
Doch ob der Mittagsstunde jenes Augusttages standen, wie gesagt, glückverheißende Sterne. Es war, als wäre am Himmel Freude über das, was in dem alten Hause „im Hirschgraben“ in der alten Mainstadt vor sich ging. Auf Erden merkte man weiter nichts davon. Kein Zinkenist blies es vom Thurme, keine Glocke läutete es, keine Kanone donnerte es in das Land, daß ein Prinz, so recht ein kaiserlicher Kronprinz aus dem Reiche der Geister in’s irdische Dasein herabgeboren sei. Nur das innerhalb der Wände des niedrigen Zimmers verklingende großmütterliche Jubelwort: „Er lebt!“ weissagte unbewußt, daß Einer gekommen, der nie sterben würde, so lange es Menschenlippen gäbe, seinen Namen voll Ehrfurcht und Liebe zu nennen.
Der Genius wird nicht in Purpur geboren[5q]. Ein makedonischer Alexander und ein preußischer Fritz sind Ausnahmen, welche nur die Regel bestätigen. Einer der sinnvollsten Züge der christlichen Mythologie ist der, daß dem auf Golgatha gekreuzigten Propheten eine Stallkrippe zur Wiege gedient habe. Alles wahrhaft Große, Zukunftbereitende, am Räthselbau der Menschheit wirksam Schaffende hat seinen Ursprung im Volke. Von da unten steigen die eigentlichen Heldenrollenspieler auf die Bühne des ungeheuren Passionsspiels „Weltgeschichte“. Da unten mischen sich geheimnißvoll die Urstoffe und arbeiten die ewigen Kräfte, welche den Weltzusammenhang, von welchem kein Wissender etwas Rechtes weiß, bedingen und bestimmen. Aber freilich, Volk und Pöbel sind zweierlei, obwohl die Wahnpropheten unserer Tage beide mitsammen vermengen oder vielmehr jenes zu diesem verderben, herabwürdigen und vergemeinern möchten. Aus dem Pöbel ist noch nie und nirgends ein wirklich großer Mann hervorgegangen, aus dem Volke sind die größten alle gekommen. Der Pöbel ist die sociale Krankheit, das Volk die nationale Gesundheit[6q]. In irgend einem Bauernhause oder in irgend einer Werkstatt zeugt der elementare, gesunde, ewig frische Volksgeist einen embryonischen Genius, welcher Generationen hindurch in der Verborgenheit gezeitigt wird, bis er dann plötzlich hervortritt in vollendet schöner Erscheinungsform, um der Stolz seiner eigenen Zeit und die Freude und der Trost aller Zeiten zu sein, ein Halbgott, welchen sein irdischer Urahn, so er ihn sehen könnte, nur mit scheuem Staunen betrachten würde und nicht zu fassen, nicht zu begreifen vermöchte.
Wie hätte der Hans Christian Goethe, der so um 1655 herum zu Artern im Thüringerlande unter den Schlägen seines Hufschmiedhammers den Amboß dröhnen machte, wie hätte er es sich träumen lassen sollen, daß dermaleinst sein dunkler Name, von seinem Urenkel getragen, den Erdball umfliegen werde, daß vor diesem Namen alle gesitteten Völker vom Aufgang bis zum Niedergang huldigend sich neigen würden? Auch des thüringischen Hufschmieds Sohn Friedrich Georg konnte, als er um das Jahr 1684 mit Scheere und Bügeleisen im Felleisen durch das Bockenheimer Thor bescheidentlich in Frankfurt einging und die wegmüden Wanderburschenfüße über den Roßplatz schleppte, nicht ahnen, daß gerade da dereinst seinem Enkel ein Denkmal von Stein und Erz aufgerichtet werden würde. Ein fixer, gewitzter Schneidergesell übrigens, dieser Fritz Görge Goethe! Ein Mann von Welt so zu sagen. Hatte sie wenigstens gesehen, die „Welt“, und zwar mit offenen Augen und Ohren. War das dazumalen schon bedenklich wurmstichig gewordene heilige römische Reich deutscher Nation auf- und abgewandert, war auch „im Frankreich drein gewes’t“, jahrelang sogar. Aber als sein Bestes brachte er jedoch von seiner Wanderschaft die Gabe, die große Gabe mit, Mädchen- und Frauenaugen ein Wohlgefallen zu sein. Bringt das bekanntlich einen Mann vorwärts[7q]. Zunächst in der Gunst der muthmaßlich hübschen – die Frankfurterinnen, wie die Mainzerinnen sind so ziemlich alle hübsch, wenigstens hübsch: denn viele sind schön – Tochter seines Meisters Lutz, der ehr- und tugendsamen Jungfrau Anna Elisabeth, welche im Frühjahr von 1687 seine Ehefrau wurde und ihrem Gatten, welcher von der Stadt das Bürgerrecht und von der löblichen Schneiderzunft die Meisterschaft erlangt hatte, das „Geschäft“ ihres Vaters mit in den Haushalt brachte. Im Verlaufe der Zeit brachte sie ihm auch fünf Söhne, die uns aber weiter nichts angehen. Im Jahre 1700 starb sie und der Wittwer betrauerte sie nahezu fünf Jahre lang. Hätte er sie bis zu seinem eigenen Lebensende betrauert, so würde er seine Mission, der Großvater des größten deutschen Dichters zu werden, verfehlt haben, aus welcher Thatsache die Moral zu ziehen, daß es mitunter gut und rathsam, der Wittwertrauer Schranken zu setzen.
Der Meister von der Scheere und Nadel muß als ein nahezu Fünfziger noch immer ein liebenswürdiger Mann gewesen sein, und das fand die reiche, hübsche Wittwe Cornelia Schellhorn, Besitzerin des Gasthauses „zum Weidenhof“, auch heraus. Er hinwiederum, Friedrich Georg Goethe, nahm, nicht faul, das Heirathsglück zum zweiten Mal resolut beim Stirnhaar und hatte es nicht zu bereuen. Fünfundzwanzig Jahre hindurch lebte der vom Schneider zum Gastwirth Gewordene mit Frau Cornelia in glücklicher Ehe und hochbejahrt ist er 1730 gestorben. Seine Gattin hatte ihm drei Kinder geboren, von denen aber die beiden älteren noch vor dem Vater zu Grabe gegangen. Das dritte war der im Jahre 1710 zur Welt gekommene Johann Kaspar Goethe, der Erbe des mütterlichen Vermögens, wie er später beim Tode seines Halbbruders Hermann Jakob Goethe auch die Lutz’sche Hinterlassenschaft einheimsete.
Selber ein strebsamer Mann, hielt der Vater Friedrich Georg darauf, daß auch sein Sohn ein Strebender würde. Allein erst im Enkel sollte der Keim Goethe’scher Strebsamkeit vollschön aufgehen. Der gute Johann Kaspar – es ist erwähnenswerth, daß auch Schiller’s Vater gerade so geheißen hat – stand zwar, nachdem er ausgewachsen, sechs Fuß hoch in seinen Schnallenschuhen, reichte jedoch an Geist, Gaben und Charakter über das liebe Durchschnittsmittelmaß nicht hinweg. Er brachte es demzufolge allerdings nicht weiter als bis zum Bildungsphilister, wie er sein soll, war aber im Uebrigen ein vortrefflicher Mann und Familienvater. Er sollte ein „Studirter“ werden, empfing auf dem Gymnasium zu Coburg eine tüchtige humanistische Vorbildung, lag hierauf zu Leipzig dem Studium der Jurisprudenz ob, holte sich in Gießen den Doctortitel und that dann beim Reichskammergericht in Wetzlar Freiwilligendienst, um sich in die juristische Prax[16q]is einzuschießen. Er ließ diese jedoch links liegen, bildete mittelst Reisen in Holland, Frankreich und Italien seinen Kunstsinn aus, erwarb sich, um doch etwas zu heißen, den Titel eines kaiserlichen Raths, lebte fortan der Mehrung und Ordnung seiner Sammlungen von Kunstwerken und Raritäten, sowie allerhand gravitätisch-dilettantisch betriebenen Studien und wagte am 20. August 1748 den gescheitesten und glücklichsten Wurf seines Lebens, indem er am genannten Tage die siebenzehn und ein halbes Jahr junge Katharina Elisabeth Textor, des Schultheißen Johann Wolfgang Textor Töchterlein, als seine Räthin heimführte.
Durch diese Heirath war der Hufschmiedsenkel und Schneiderssohn in die ersten Kreise reichsstädtischen Bürgerthums eingeführt und er blieb sich all’ sein Lebenlang dieser seiner Stellung wohlbewußt. Ein stattlicher, steilaufgerichteter, rauchfleischtrockener, steifleinener Herr, aber eigentlich grundgut und durch und durch ehrenhaft. Von nicht gemeinem Wissen und voll Hochachtung vor Kunst und Kenntniß, liebte er in allen Sachen die Ordnung um ihrer selbst willen und behandelte Alles und Jedes mit jener zähen und, so zu sagen, sohlledernen Ernsthaftigkeit, welche, weil sie das Kleinste wie das Größte mit demselben Maßstabe mißt, leicht zur Pedanterei wird. Seine Vorsorge für das Wohl seiner Kinder – es blieb ihm von drei Söhnen nur der erstgeborene und die 1750 zur Welt gekommene Tochter Cornelia – nahm er so ernst und gewissenhaft wie alles andere. Er hat ihren frühesten Unterricht selber besorgt, den späteren geleitet. Augenscheinlich war auch ihm jener pädagogische Tik angeflogen, welcher in der Zeit, wo die Rousseau[8], Basedow[9], Salzmann und Campe[10] pädagogisirten und phantasierten, so vielen Zeitgenossen eigen gewesen ist. Er hatte aber zum Erzieher nicht das Zeug, obzwar es irrthümlich und unrecht ist, ihm vorzuwerfen, er sei zu streng oder gar zu hart gegen seine Kinder gewesen. Seines Sohnes Jugendgeschichte, wie dieser selbst sie erzählt hat, beweist ja schlagend das Gegentheil. Der Dichter gestand auch zu, daß er vom Vater nicht nur „die Statur“, sondern auch „des Lebens ernstes Führen“ habe; aber im Uebrigen hat er demselben keineswegs volle Gerechtigkeit, geschweige Billigkeit widerfahren lassen. Die Natur will und heischt, daß die Söhne mehr den Müttern anhangen[10q]. Die Väter sind bekanntlich für die Herren Söhne zumeist nur da, um das Geld zu beschaffen zum Studiren oder auch zum Nichtstudiren, zum Schulden bezahlen, zum Heirathen etc. Glücklich der Vater, dem die Liebe einer Tochter Trost bietet für das Leid, welches Söhne ihm anthun. Goethe’s Freunde haben dessen Vater höchst ungerecht beurtheilt, wie denn, nachdem der wackere Herr im Mai von 1782 gestorben, der Herzog Karl August in seinem burschikosen Kraftstil an Merck schrieb: „Der Alte ist ja nun abgestrichen und Goethe’s Mutter kann endlich Luft schöpfen.“
Die Mutter Goethe’s hat sich fürwahr das „Luftschöpfen“ auch bei Lebzeiten des „Alten“ keineswegs verleiden oder gar nehmen lassen. Aber das ist richtig, die Katharina Elisabeth, die Frau „Aja“, wie sie im Freundeskreise ihres Sohnes hieß – (nach der Schwester Karl’s des Großen, der Mutter der Haimonskinder; aja, provençalisch aya, gleichbedeutend mit dem althochdeutschen eiga, das ist Besitzerin?) – ja, die Frau Aja war eben so sehr Poesie wie ihr Eheherr Prosa. Diese, die Prosa, ist in einem Haushalt nicht nur auch nöthig, sondern sie ist unumgänglich. Sie ist das Fundament, auf welchem Hauswesen und Familie, als das sehr Wirkliche, Ernstliche und Sorgenschwere, was sie sind, sich ausbauen müssen. Aber Heil dem Manne, in dessen Haus und Heim die Poesie in Gestalt einer Frau, wie Goethe’s Mutter eine gewesen, heitere Anmuth und anmuthige Heiterkeit bringt! Das ist ein Sonnenstrahl, welcher häusliches Gewölle, das ja nirgends ausbleibt, siegreich zertheilt und verscheucht. Unzählige Ehen werden rein nur darum zu unglücklichen, weil den Augen und Lippen der Frau jenes Lächeln abgeht, das die Unmuthsfalten, welche das „feindliche Leben“ auf des Mannes Stirne ansammelt, wegzuwischen vermag. Frauen, welche die köstliche Gabe besitzen, frohes Behagen um sich zu verbreiten und das bischen Leben schön und lieb zu gestalten, mögen dieselbe sorgsamst pflegen; denn das ist mehr als ein Talent, es ist geradezu eine Tugend.
Die Frau Aja hat unzweifelhaft etwas Geniales an und in sich[8q]. Der wesentlich idealistische Hang und Drang des achtzehnten Jahrhunderts ist in ihr mächtig gewesen. Es war Lyrik, Goethe’sche Lyrik in ihr. Ein kräftiger Hauch auch von Humor umwittert ihre ganze Erscheinung. Sie besaß jene „Frohnatur“, welche mitsammt der „Lust zu fabuliren“ von ihr überkommen zu haben der Sohn dankbar bekannte. Aus einem Kinde fast übergangslos zur Mutter geworden, wurde sie mit ihrem Wolfgang wieder zum Kinde, zur Spielgenossin, zur Camerädin ihres Jungen. – („Ich und mein Wolfgang,“ hat sie später einmal geäußert, „haben halt immer verträglich zusammengehalten; das machte, weil wir beide jung und nicht gar soweit wie der Wolfgang und sein Vater auseinander gewesen sind“). Die junge Frau mit dem liebebedürftigen Herzen hatte jetzt etwas, was sie lieben konnte, und sie hat den Sohn grenzenlos geliebt von seinem ersten bis zu ihrem letzten Athemzug, geliebt mit einer selbstlosen, großsinnigen Liebe, welche den Neid und die Eifersucht nicht kannte, sondern dem Sohne den reichen Schatz von Liebe, welchen Mädchen und Frauen ihm entgegengetragen, von ganzem Herzen gönnte. Deutschland und die Welt haben vollauf Ursache, der Mutter Goethe’s ehrfurchtsvollen Dank zu zollen. Was sie dem Sohne gewesen und gegeben, ist unberechenbar. Ueberall in seinen besten Vollbringungen stößt man auf die Spur von seiner Mutter und von ihrer Liebe zu ihm.
Bei allem Phantasiereichthum war sie nichts weniger als eine Phantastin. Sie wußte das Leben geschickt zu fassen und praktisch zu führen. Eine kluge, wissende, thätige Hausfrau, wie man sie nur wünschen mag, und dabei doch offenen Sinnes für alles Höhere und Höchste, voll genialer Anschauung und mutterwitzigen Verständnisses, immer wohlaufgelegt, allzeit hülfebereit mit Rath und That. „Ich thu’ alles gleich frisch von der Hand weg“ – schrieb sie einmal – „das Unangenehme immer zuerst, und verschlucke den Teufel (nach dem weisen Rathe des Gevatters Wieland), ohne ihn erst lange zu begucken. Liegt dann alles wieder in den alten Falten, ist alles Unebene wieder glatt, dann biete ich dem Trotz, der mich in gutem Humor übertreffen wollte.“ Und ein andermal: „Fröhlichkeit ist die Mutter aller Tugenden[9q]. Wenn man zufrieden und froh ist, so wünscht man alle Menschen vergnügt und heiter zu sehen und trägt alles in seinem Wirkungskreise dazu bei.“ Wie sie sich hier ausließ, so zeigte sich auch ihre Leiblichkeit: die schlank aufgebaute Gestalt, voll Beweglichkeit und doch würdevoll im Auftreten, die schöngewölbte freie Stirne, die großen Braunaugen mit dem offenen Blick, das schalkhafte Mienenspiel um die Mundwinkel, der wohlwollend heitere Ausdruck des ganzen guten und lieben Gesichts. Ihr seelisches Portrait hat sie in einem Briefe vom Jahre 1785 also gezeichnet: „Ich habe die Gnade von Gott, daß noch keine Menschenseele mißvergnügt von mir weggegangen ist, weß Standes, Alters und Geschlechtes sie auch gewesen. Ich habe die Menschen sehr lieb und das fühlt Alt und Jung, gehe ohne Prätension durch die Welt und das behagt allen Erdensöhnen und -Töchtern, bemoralisire Niemanden, suche immer die gute Seite auszuspähen, überlasse die schlimmen dem, der die Menschen schuf und der es am besten versteht, die Ecken abzuschleifen, und bei dieser Methode befinde ich mich wohl, glücklich und vergnügt.“ Und so blieb sie, die Gebresten des Alters tapfer niederkämpfend, bis zuletzt, bis zu ihrem Todestag, dem 13. September von 1808. Nachdem der Arzt auf das bestimmte Verlangen der Kranken ihr die Scheidestunde zum voraus angezeigt hatte, ordnete sie für Bestattung alles mit größter Pünktlichkeit, bestimmte die Weinsorten, welche zum „Leichenschmause“ aufgestellt werden sollten, und schärfte der Köchin ein, ja nicht zu wenig Rosinen in die Kuchen zu thun. Sie habe das all ihr Lebtrag nicht leiden können und würde sich noch im Grabe darüber ärgern. Einer nicht unglaubhaften Legende zufolge hat ihr treuer Lebensbegleiter, Tröster Humor, sie auch im Sterben nicht verlassen. Am Morgen ihres Todestages lief von einer befreundeten Familie, welche die Krankheit der Frau Rath für unbedenklich und rasch vorübergehend halten mochte, eine Einladung ein, worauf die Sterbende als letzte Offenbarung ihrer „Frohnatur“ zurücksagen ließ: „die Frau Rath kann nit kommen, sie hat alleweile zu sterben“ …
So war Goethe’s Herkunft, so waren seine Eltern, so wurde er geboren. In glücklichen Verhältnissen, nicht zu hoch und nicht zu niedrig, als der Sohn eines ehrenfesten und hablichen Hauses, in dessen Räumen die hagere Noth und die bleiche Sorge nicht umschlich, als das Kind eines sorgsamen Vaters und einer herzlichen Mutter, jeglichen Bildungsmittels gewiß, von frühauf der Erfüllung aller billigen Wünsche sicher. Wolfgang’s, des Einzigen, Jugend, Bildungsgang und Eintritt in die thätige Welt waren so von den Umständen begünstigt, daß man unschwer vermuthen könnte, sein großer Bruder im Geiste, Schiller, habe die Strophe:
„Wie leicht ward er dahingetragen Was war dem Glücklichen zu schwer? Wie tanzte um des Lebens Wagen Die lustige Begleitung her!“
im unwillkürlich vergleichenden Hinblick auf den Contrast zwischen Goethe’s leichtem Emporfliegen und seinem eigenen mühseligen Emporklimmen gedacht und geschrieben. Ja, der Sohn der Frau Aja war ein glücklicher Mensch, war es bis zuletzt[11q]. Freilich hat er in einer trüben Stunde seiner alten Tage gesagt: „So ich alles von wirklichem und reinem Glück in meinem Leben zusammenrechne, kommen höchstens vier Wochen heraus.“ Aber vier Wochen wirklichen und reinen Glückes in einem Menschenleben sind viel, sehr viel! Es giebt wahrlich der Menschen genug, mehr als genug, welche, wenn sie Alles zusammenzählen, keine vier Tage, keine vier Stunden herausbringen.
Laßt uns nun zunächst zusehen, wie unser glückliches Augustkind von 1749 zum Knaben und Jüngling aufwuchs und wie der Genius in ihm zuerst leise die Fittige zu rühren anhob.
Als, auf des Daseins Gipfel angelangt, der sechzigjährige Goethe seine Erinnerungen niederzuschreiben unternahm, da gestaltete sich das Buch derselben „Aus meinem Leben“ unter seiner schaffenden Hand zu einem Kunstwerke, welchem er feinfühlig den Titel „Dichtung und Wahrheit“ vorsetzte. Er wollte damit andeuten, daß diese Geschichte seiner Jugend – denn das Buch reicht bekanntlich nur bis zur Uebersiedelung des Dichters nach Weimar – blos im dichterischen Sinne eine wahrhafte sei. Damit traf er das Richtige. Ueber diese Denkwürdigkeiten ist
„Aus Morgenduft gewebt und Sonnenklarheit, der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit“