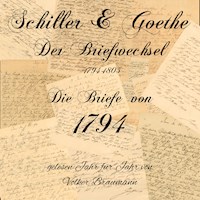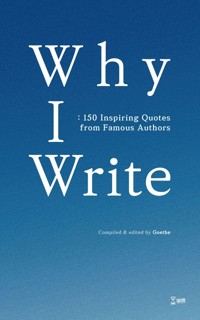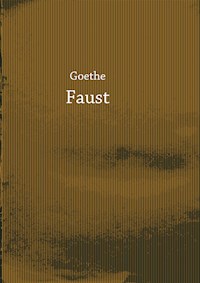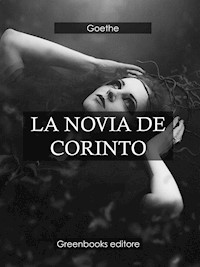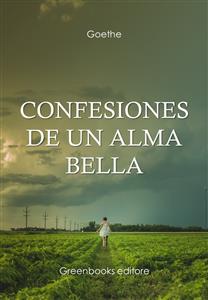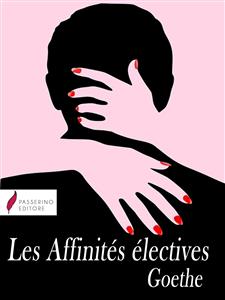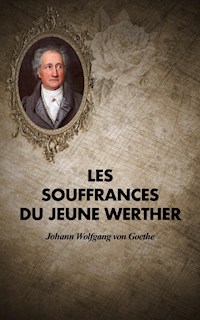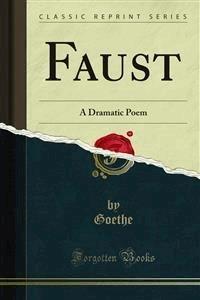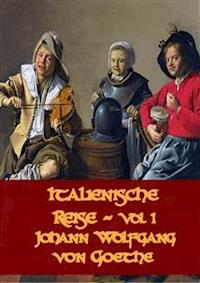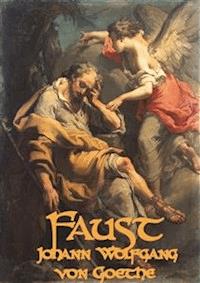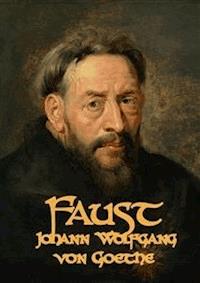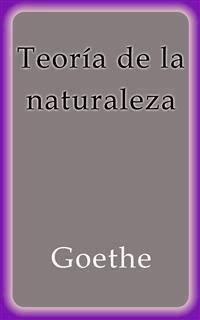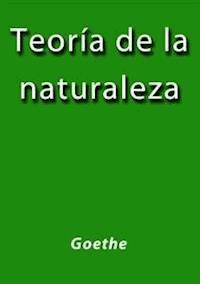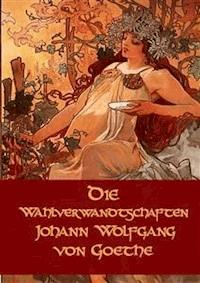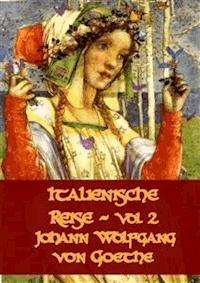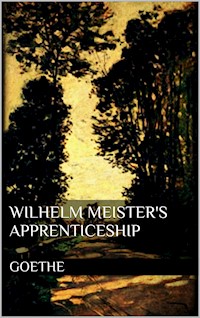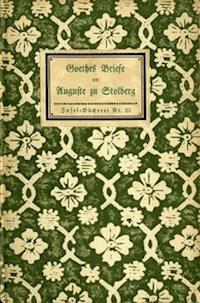
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 84
Ähnliche
Anmerkungen zur Transkription:
Schreibweise und Interpunktion wurden bis auf wenige Druckfehler beibehalten. Eine Liste der vorgenommenen Änderungen befindet sich am Ende des Textes.
Die Großbuchstaben I und J werden im Original nicht unterschieden.
Im Original gesperrt gedruckter Text wird hier kursiv dargestellt. Antiqua wird ohne Serifen wiedergegeben.
Goethes BriefeanAuguste zu Stolberg
Einleitung des Herausgebers
»Der Liebe Sehnsucht fordert Gegenwart.« — Goethe, mit jedem Pulsschlage seiner Empfindung nach greifbarer Gegenständlichkeit, nach sinnenfälliger Wirklichkeit drängend, ist zu versichern nicht müde geworden, daß persönliche Bekanntschaft erforderlich sei, »das Siegel eigentlich auf jedes wahre sittliche Verhältnis zu drücken.« Doch auch er hat einmal geglaubt, mit Augen der Sehnsucht den fernenden Nebel durchdringen zu können, der ihm ein leiblich nie geschautes Antlitz verbarg, mit Armen der Freundschaft hinüberreichen zu können über eine Kluft, die keine unmittelbare Begegnung überbrückte. In jener bedeutsamen Zeit deutscher Geistesentwicklung ist das gewesen, da unsere Literatur, wiedergeboren aus dem Schoße frisch erwachten Naturgefühles, aufbrausend im »Sturm und Drang« erneuerter Jugendfülle, alle suchenden Seelen in gleichen Bann schlug, da Goethe, der diese neue Literatur mitgeschaffen, jung wie sie, voll leidenschaftlichen Verlangens, einstimmende Herzen von Nähen und Weiten forderte.
»Sturm und Drang« — an dem ergreifendsten Erzeugnis dieser aufgewühlten Epoche, an den »Leiden des jungen Werthers« hatte sich Auguste Luise Gräfin zu Stolberg-Stolberg entzündet, als sie im Januar 1775 an den ihr fremden Dichter den ersten Brief richtete. Geboren am 7. Januar 1753, Sprößling eines uralten niederdeutschen Geschlechtes, lebte sie »still und bewegt« ein unscheinbares reiches Leben; das südliche Holstein, die dänische Insel Seeland, die Niederungen der Elbmündung sind mit ihrem Wechsel von Wiese und Buchenwald, von Moor und Ackerfläche, von schäumender Meeresbrandung und kosendem Landsee der begränzte Schauplatz dieses weiten Daseins gewesen. Gustchens Vater, Graf Christian Günther, war seit 1756 Hofmarschall der Königin-Witwe Sophia Magdalena in Kopenhagen; als er 1765 starb, hatte er jedes seiner zahlreichen Kinder für alle Folgezeit gefestigt in dem ihm eigenen Sinne lauterer Frömmigkeit und frohen Bekennermutes. Die Mutter (gest. 1773), eine harmonische Natur, den »schönen Seelen« des Pietismus verwandt, mit regsamer Empfindung und Kraft der Phantasie begabt, ward den Ihren gemütvolle Erweckerin einer entschiedenen Neigung und Fähigkeit zur Dichtkunst, und dieser allgemeine poetische Geist vertiefte und verklärte sich an Wesen und Werk des Messias-Dichters Klopstock, der, 1751 nach Dänemark berufen, in vertrautester Freundschaft zur Familie stand. Klopstock ist der Leitstern geblieben, nach dem die Stolberge ihr Leben und Dichten gerichtet haben; nach seinem Muster hat Gustchens ältere Schwester Katharina ihr biblisches Drama »Moses« verfaßt. Und auch Bruder Friedrich Leopold, dessen schöner ausdauernder Enthusiasmus sich die Liebe jugendlicher Mitstrebenden wie die Anerkennung kritischer Nachwelt erwerben durfte, ist der früh eingesogenen Bewunderung Klopstocks niemals untreu geworden, ob er gleich voll Selbstgefühls sein Zögling nicht hat heißen mögen, den schlichten Ton singbaren Liedes jeder volltönenden Odenform vorgezogen hat und, von dem Wehen des »Sturmes und Dranges« ergriffen, einzig im eigenen Bewußtsein, in der sich selbst verbürgenden Dichterkraft Maß und Richtschnur seines Schaffens hat erkennen wollen.
»Sturm und Drang« — wohl müßte es reizvoll sein, diese mächtige Bewegung sich in empfindsamer Mädchenseele bewähren zu sehen, aber die Briefe Gustchens, die uns solchen Anblick bieten könnten, sind den Flammen zum Opfer gefallen, denen Goethe 1797 die Dokumente aller seiner persönlichen Beziehungen überantwortet hat. Dafür zeigen uns seine eigenen Antworten vom Jahre 1775 das Schauspiel der jungen Zeit in seiner erhabensten Gestalt. Wie machtvoll weht uns aus diesen Zeilen, die mit strudelnder Feder »hingewühlt« sind, der feurige Atem des Dichtergenius entgegen, der das Mysterium der Welt und des eigenen Herzens zu lösen ringt, der die Wirrsale des Daseins, das Wonne und Schmerz zugleich ist, in künstlerischen Formen zu bändigen strebt! Wie wechselt in diesem klopfenden Busen, der Himmel und Hölle nebeneinander umschließt, die Flut der tiefsten Empfindung; aus lichter Klarheit und Götternähe ins Dunkel der Erdennot hinabgestürzt, auftauchend aus Kleinmut und Verzweiflung zu hoffnungfreudiger Zuversicht auf die eingeborene Kraft und das waltende Schicksal, ergreift dieses Gemüt jeden neuen Zustand mit ungestümer Leidenschaft. Dem Überschwang des Gefühls versagt sich das sonst so gefügige Wort; in bedeutungschwerem Stammeln, halben abgebrochenen Lauten einer erschütterten Vollnatur macht sich der Sturm des Innern Luft. »Ich bin wie ein klein Kind«, ein Kind, das, hingegeben jedem Augenblick, sich in lallenden Tönen überstürzt, um von Leiden und Freuden sich zu entlasten, die das Herz erdrücken möchten. So hatte auch Werther einst gerufen: »O was ich ein Kind bin!« Und wie hier die »Leiden des jungen Werthers«, so klingen andere Dichtungen dieser reichen Epoche an anderen Stellen unserer Briefe an. »Ich will Ihnen keinen Namen geben, denn was sind Namen gegen das unmittelbare Gefühl«, dieses erste Wort Goethes an Gustchen ist wahrhaft wesensverwandt jenem Faustischen Bekenntnis: »Nenn's Glück! Herz! Liebe! Gott! Ich habe keinen Namen Dafür!«
»Faust« steigt auf aus unseren Briefen; unmittelbar in die Werkstatt des Dichters wird uns ein Einblick erlaubt, wenn wir auf die Umschreibung des »Rattenliedes« stoßen. Und neben »Faust« steht »Stella«, das kühne »Schauspiel für Liebende«, herausgeboren aus dem seligschmerzlichen Verhältnis zu Lili Schönemann. Lili — das ist der Gegenstand der Frankfurter Briefe. Wir sehen das unlösbare Geflecht von Qual und Entzücken, in dem sich Goethe verfangen hat. Das blütenjunge Mädchen, vollkommen schön und liebenswürdig, in kindlicher Harmlosigkeit sich des Zaubers erfreuend, der von ihr ausgeht, und wiederum fähig und bereit, dem Geliebten Familie und Heimat aufzuopfern, erhebt ihn mit der Kraft ihrer innigen Neigung zur Höhe überirdischen Glückes, und eine finstere Gewalt zerrt ihn unbarmherzig hinab in den Abgrund innerlicher Verstörtheit: das Grauen vor der Alltäglichkeit, der er sich überliefern soll, die Furcht vor dem platten Nachbar- und Gevatterwesen, der Widerwillen gegen das spießbürgerliche Getriebe, die leere Selbstgefälligkeit eines verrottenden Gemeinwesens. Hin und her gerissen zwischen Liebe und Freiheitssehnen, findet Goethe keinen Standpunkt zu ruhiger Erwägung, sein Groll kehrt sich gegen die Braut, die des unseligen Zwiespaltes unschuldige Ursache ist, er plagt sie mit abweisender Kälte und büßt sein Unrecht in bittern Selbstvorwürfen, er übergibt sich dem Strudel gesellschaftlicher Vergnügungen, um die innere Unruhe zu übertäuben. So geht das herzbeklemmende Schauspiel dem unausweichlichen Ende entgegen: »Lili sieben Worte gesagt«. Mit der grandiosen Unbefangenheit des Genies läßt er seinen Schmerz auf dem heiligsten Vorgang aller Geschichte als auf einem Gleichnis eigenen Erlebens haften: seine Liebe ist es, die er ans Kreuz geheftet hat, die das Haupt senkt und spricht: Es ist vollbracht.
Getreuen Bericht dieser traurig-süßen Bräutigamszeit hat Goethe dem unbekannten Mädchen abgestattet; aber immer aufs neue bricht die Klage durch, daß er das Letzte, Tiefste, Geheimste nur von Mund zu Munde sagen könne. So ist er denn also schon damals der bittern Wahrheit inne geworden, daß aller Seelenkraft zum Trotz die persönliche Gegenwart ganz allein ein wahres Verhältnis zu bestimmen und zu befestigen vermögend sei, und doch bleibt er noch unerschöpflich in der Erfindung von Mitteln, das Getrennte wirksam zu vereinigen. Von Tag um Tag, von Stunde um Stunde gibt er Rechenschaft, um sich über alle Fernen hinweg ganz darzustellen; er bittet: »Schreiben Sie doch auch immer die Daten«, weil er die lange Zeit hinwegtilgen zu können hofft, die Gustchens Briefe haben reisen müssen, er borgt Hilfe von seiner Zeichenkunst und gibt der Freundin ein Bild seiner Stube — jener Stube, die seine Seufzer um Lili gehört, seinen »Faust«, seine »Stella« hat entstehen sehen. Aber »Sturm und Drang« legt sich zur Ruhe, Goethe reift fester Männlichkeit entgegen, die nur in unmittelbarer Gegenständlichkeit wesen und wirken mag, und in demselben Maße, wie ihm volle Realität alles Seins zur Lebensbedingung wird, welkt das hastig emporgetriebene Verhältnis zu Gustchen Stolberg ab.
Die einzige Gelegenheit, die sich ihm geboten hat, die Vertraute seiner Frankfurter Leiden persönlich kennen zu lernen, hat Goethe versäumt, als er im Dezember 1775 ihre Brüder, entgegen dem ursprünglichen Plane, allein von Weimar abreisen ließ. Der herzogliche Freund hielt ihn damals fest, und sie, die nun auf länger denn ein Jahrzehnt seines heißen Verlangens unerreichbarer Pol sein sollte, Charlotte v. Stein. Nur selten wird Charlottens Name genannt in den Briefen, die Gustchen noch aus Weimar erhalten hat, der Einfluß ihres stetig-milden Wesens ist jedoch nicht zu verkennen. Wie viel ruhiger der Ton, wie viel gleichmäßiger Bericht und Erzählung, wie viel gedämpfter der Ausdruck neuen Leides, dessen Ursache im Dunkel bleibt! Die zahlreichen Gedankenstriche, die, wie Erdrisse einen heißen Boden zerklüften, die fiebernden Frankfurter Briefe durchsetzten, kommen seltener und seltener aus ruhig fortlaufender Feder. Wie erfrischender Frühwind eines herrlichen Sommermorgens weht es heran, wie ein Wipfelgruß aus dem geliebten Garten am Park. Alle seine früheren Geliebten habe sie beerbt, hat Goethe der teuern Frau gestanden; sie ist auch in Gustchen Stolbergs Besitzrecht eingetreten, als verstehende Frauenseele die Beichten eines umgetriebenen Dichterherzens entgegenzunehmen. Hier war die lebendige Hand, die sich kühlend auf die erhitzte Stirne legen konnte, Fülle der Wirklichkeit, Kraft der Gegenwart — da mußte Gustchens Bild zu leerem Schemen verblassen.
Und noch einmal, nach einem Menschenalter voll wechselnden Schicksals, ist Gustchen ungerufen vor den Stummgewordenen hingetreten, um in eindringlichem Bekehrungsversuch zu erweisen, wie nahe ihrem liebevollen Herzen der Freund der Jugend geblieben sei. Kein Mephistopheles begrinse das Vertrauen dieser guten Seele, die, ihres Glaubens voll, sich heilig quält, ihn, der ihr einst so viel von seinem tiefsten Selbst geschenkt, verloren halten zu sollen! Goethes Antwort, ernst und würdig, ist das erhabenste Bekenntnis seiner reinen Weltfrömmigkeit. Mehr als einmal ist er das Ziel eifriger Christianisierungslust