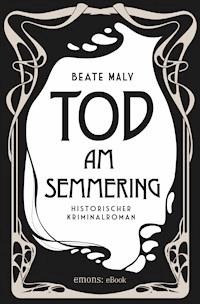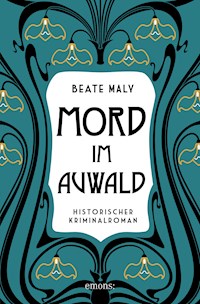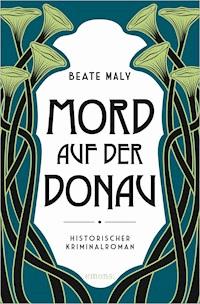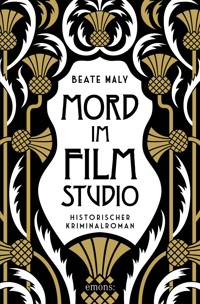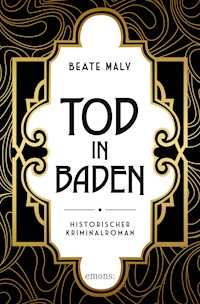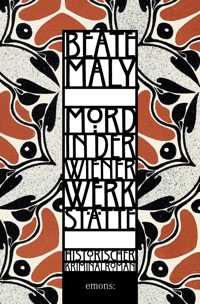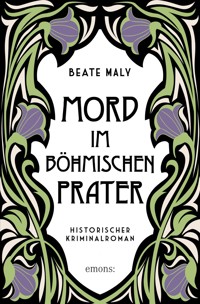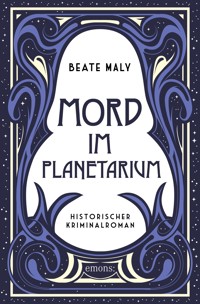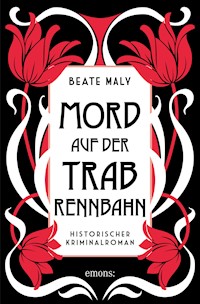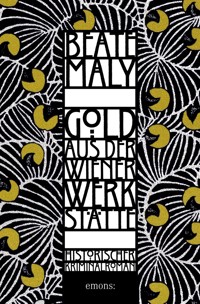
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Liliane Feiglas und May von Krause
- Sprache: Deutsch
Wien, 1906: In einem Hotel wird die Leiche einer Prostituierten aufgefunden. Der auffällige Schmuck der jungen Frau führt Ermittler Max von Krause erneut zur Wiener Werkstätte, wo er Lili Feigl wiedertrifft. Als Lili auf eigene Faust nach dem Käufer des Schmucks sucht, stößt sie auf ein Netz aus Lügen und Intrigen, das bis in die höchsten Kreise Wiens reicht. Gemeinsam versuchen sie, den Täter zu entlarven, doch die Zeit scheint gegen sie zu spielen, denn schon bald geschieht ein weiterer Mord... "Gold aus der Wiener Werkstätte" von Beate Maly enthüllt die dunkle Seite des historischen Wien. Der Kriminalroman besticht durch tiefgründige Charaktere, eine spannende Handlung und lebendige Einblicke in die Wiener Gesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts. Ein Muss für Fans historischer Krimis und starker Ermittlerinnen. Band 2 der Reihe »Lili Feigl und Max von Krause«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2025 Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Wikimedia Commons/public domain, Koloman Moser
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Uta Rupprecht
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-239-0
Historischer Kriminalroman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Der Zweck der Kunst besteht darin, die Fragen offenzulegen, die durch die Antworten verborgen wurden.
James Baldwin
1
Wien, 1906 – Zirkusgasse, Hotel Kaiserkrone
Ein kühler Windstoß blähte den schweren dunkelroten Samtvorhang auf und ließ den Stoff gegen die cremefarbene Tapetenwand schlagen. Eine filigrane Vase auf der Kommode fiel klirrend zu Boden. Erschrocken zuckte Constanze zusammen, ging in die Hocke und beugte sich über das Malheur. Sie bemerkte erleichtert, dass das geblümte Porzellan noch ganz war. Nur ein Wasserfleck am Teppich zeugte von dem Missgeschick.
Constanze steckte die Rose zurück in die Vase und stellte sie wieder auf die Kommode. Die Blume ließ traurig den Kopf hängen, der Stiel war geknickt. Die Rose würde ihr das Hotel nicht in Rechnung stellen, mit der Vase hätte es sich anders verhalten.
Fröstelnd zog Constanze den Morgenmantel aus hellblauer Seide enger um ihren schmalen Körper. Der dünne Stoff wärmte sie nur notdürftig. Es blieb ihr nichts anderes übrig, sie musste das Fenster schließen. Widerwillig zog sie die Flügel zu. Ein beklemmendes Gefühl machte sich in ihr breit. Jahrelang hatte sie hinter fest verschlossenen Fenstern gearbeitet und wie eine Gefangene gelebt. Immer noch saß die Angst tief in ihr, sie hasste geschlossene Fenster. Auch wenn die Tortur im Salon von Regine Riehl hinter ihr lag, so waren die Erinnerungen an die Zeit noch so präsent, als wäre es gestern gewesen. Ganze fünf Jahre hatte sie für die gewissenlose, eiskalte Bordellbesitzerin geschuftet, die die Körper junger Frauen ausgebeutet hatte. Im letzten Herbst war Constanze wie durch ein Wunder die Flucht gelungen.
Ihr eigener Vater hatte sie im zarten Alter von sechzehn an Riehl verkauft. Constanze war nicht die Einzige gewesen, die von der Familie wie billiger Tand verscherbelt worden war. Ihre ersten Fluchtversuche waren kläglich gescheitert, aber immer wieder hatte sie den Plan gefasst, aus dem Gefängnis auszubrechen.
Einmal waren die Qual und der Hunger so groß gewesen, dass sie und die Rosi, mit der sie sich ein Bett geteilt hatte, ein Bettlaken zerrissen und sich damit aus dem Fenster im dritten Stock abgeseilt hatten. Natürlich war das Laken gerissen, und Rosi hatte sich bei dem Sturz drei Rippen und den Oberschenkel gebrochen. Frau Riehl hatte keinen Arzt gerufen, und nach drei Wochen war Rosi an den Folgen des Unfalls gestorben und in einem Armengrab verscharrt worden. Weder Constanze noch die anderen Mädchen hatten von ihr Abschied nehmen dürfen.
Letzten Monat war Constanze am Zentralfriedhof gewesen, um eine Blume auf das Grab zu legen, auf dem nicht einmal Rosis Name stand. Vielleicht lag sie gar nicht darin. Es war, als hätte es sie nie gegeben. Constanze selbst hatte sich bei dem Fluchtversuch den Knöchel gebrochen. An kalten Tagen schmerzte er so heftig, dass sie kaum auftreten konnte, ein bisschen humpelte sie immer. Einer ihrer Freier hatte lachend gemeint: »Musst eh nicht herumlaufen, es reicht, wennst im Bett liegst.«
Das entsprach der Wahrheit, die Männer, die Constanze besuchten, sahen sie am liebsten in der Horizontalen. Sie verkaufte ihren Körper immer noch, aber jetzt behielt sie das Geld, das ihr zugesteckt wurde, selbst. Und wenn alles gut ging, konnte sie schon bald einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Sie hielt ihre Kreuzer zusammen und sparte auf eine bessere Zukunft.
Sie spähte aus dem Fenster. Ein Fiaker fuhr vor und hielt vor dem Eingang des Hotels Kaiserkrone. Ein junges Paar stieg aus. Es war nicht der Mann, den Constanze erwartete. Auch er würde mit der Kutsche kommen, dessen war sie sicher. Er ging niemals zu Fuß, dazu war er zu vornehm, ein wohlhabender Herr der feinen Gesellschaft. Er besaß Geld wie Heu. Zwar zahlte dieser Freier nicht besser als die anderen, dafür machte er Constanze regelmäßig kostbare Geschenke. Die Kette, die sie um den Hals trug, stammte von ihm. Er hatte das wertvolle Stück in der Wiener Werkstätte anfertigen lassen. Es war das erste Mal in Constanzes Leben, dass sie etwas so Wertvolles ihr Eigen nennen konnte.
In der Vergangenheit hatte sie alle Geschenke an Regine Riehl abgeben müssen. Einmal hatte sie versucht, Schokolade unter der Matratze zu verstecken, aber Riehl hatte die Süßigkeiten entdeckt. Zur Strafe hatte Constanze eine Woche lang bei den Mahlzeiten nur die halbe Ration bekommen. Bevor sie so mager wurde, dass die Freier sie abstoßend fanden, durfte sie wieder essen.
Aus der Zeitung hatte Constanze erfahren, dass der Bordellbesitzerin seit zwei Wochen der Prozess gemacht wurde. Einige der gefangenen Mädchen hatten sie anzeigen können. Constanze bewunderte die Frauen, die jetzt ebenfalls auf der Anklagebank hockten, weil man ihnen keinen Glauben schenkte. Sie mussten sich den unangenehmen Fragen und peinlichen Blicken der Reporter und schaulustigen Wiener aussetzen in der Hoffnung, dass ihnen Gerechtigkeit widerfuhr. Aber wer glaubte schon einem Freimadel? Constanze selbst wollte mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Zu groß war ihre Angst vor dem Gefängnis.
Nachdem ihr die Flucht gelungen war, hatte sie sich geschworen, diese böse Weibsperson für immer zu meiden. Nie wieder wollte sie ihre hässliche Visage sehen, ihre hasserfüllten, boshaften Augen, aus denen eiskalte Habgier blitzte. Nur zu gut konnte Constanze sich vorstellen, dass die Riehl ungestraft davonkommen würde und die Mädchen hinter Gittern landeten. Dabei wäre nur das Gegenteil gerecht.
Den Glauben an Gerechtigkeit hatte Constanze schon als Kind verloren, auch an einen Gott konnte sie nicht glauben. Ihrem Freier, der gleich kommen würde, hätte sie das aber nie gestanden. Er betete und bekreuzigte sich jedes Mal. Vielleicht war das der Grund, warum sein bestes Stück nie groß genug wurde, um einsatzfähig zu sein? Constanze musste sich stets etwas anderes einfallen lassen, um ihn dennoch bei Laune zu halten und bezahlt zu werden.
Ein weiterer Fiaker hielt vor dem Hotel, diesmal stiegen zwei ältere Damen aus. Sie trugen kostbare Kleider mit ausladenden Turnüren. Auf dem Kopf hatten sie breite Hüte, die mit Schleiern und Federn geschmückt waren. Hätte Constanze ausreichend Geld, würde sie auch solche Hüte tragen, dann könnte sie ihr Gesicht vor der Welt verbergen. Sie lebte in der ständigen Angst, jemand könnte sie entdecken und in ihr eines der Mädchen aus dem Salon Riehl erkennen.
Langsam wandte sie sich vom Fenster ab und ging zum Spiegel. Ihr Blick fiel auf die goldene Kette um ihren Hals. Das Medaillon war atemberaubend schön. Auf einer doppelt gewickelten Kette befand sich ein quadratischer Anhänger, auf dem sich verschnörkelte Weinreben rankten. Dunkelgrüne Edelsteine bildeten das Zentrum, sie sahen aus wie saftig glänzende Trauben. Sobald ihr Verehrer da war, würde sie den Morgenmantel ausziehen und sich ihm nur mit dem Schmuckstück präsentieren. Wenn alles nach Plan lief, würde er ihr nach diesem nachmittäglichen Treffen die dazu passenden Ohrringe schenken. Versprochen hatte er sie ihr schon beim letzten Mal.
Angeblich hatte ihr Freier nicht nur Ohrringe, sondern auch ein Armband, eine Brosche und eine Haarspange für Constanze in Auftrag gegeben. Beim Gedanken an die weiteren Geschenke stieg eine kribbelnde Vorfreude in ihr auf. Wenn sie den Schmuck in ein paar Wochen verkaufte, konnte sie mit dem, was sie dafür bekam, ordentliche Kleider erstehen, ihre Schulden bei ihrer Vermieterin begleichen und sich nach einer Anstellung in einer Fabrik oder als Küchenhilfe umsehen. Dort verdiente sie weniger, aber es würde ihr Geld vom Schmuckverkauf übrig bleiben. Und damit käme sie gut über die Runden.
Constanze war sparsam und bescheiden. Sie war ohne Mutter aufgewachsen, ihr Vater war Kutscher gewesen. Vor zwei Jahren hatte sie erfahren, dass er sich zu Tode gesoffen hatte. Constanze hatte seinen Tod nicht beweint. Er war ihr gleichgültig gewesen.
Voller Hoffnung auf ein besseres Leben fasste sie nach dem Anhänger und strich mit dem Zeigefinger über die glatten Edelsteine. Sie wünschte, der Nachmittag wäre bereits vorbei und alles nach Plan gelaufen. Wenn der Mann sich über sein eigenes Versagen ärgerte, reagierte er mit Schlägen. Er zählte nicht zu den freundlichen Kunden. Letzte Woche hatte sie drei Tage lang nicht schmerzfrei sitzen können und musste ihren Hals unter einem hohen Kragen verstecken. Die Druckstellen waren ihr peinlich gewesen.
Brutale Freier waren nichts Ungewöhnliches. In Riehls Salon hatten sie und die anderen Mädchen weitaus ausgefallenere Wünsche erfüllen müssen. Wer sich geweigert hatte, war von Riehl mit der Peitsche zurück ins Zimmer geprügelt worden, nur um dort noch mehr Schläge zu kassieren.
Aber nicht alle Männer waren brutal gewesen. Es hatte auch nette Freier gegeben.
Wieder ratterten die Räder einer Kutsche über das Kopfsteinpflaster, die Hufe eines Pferdes klapperten. Constanze zog den Vorhang ein Stück zur Seite. Diesmal war es der erwartete Besucher. Noch einmal schaute sie in den Spiegel. Sie zupfte zwei ihrer dunklen Locken aus der hochgesteckten Frisur und ließ sie kokett in die Stirn fallen. Geschickt biss sie auf die Unterlippe, um mehr Farbe darauf zu zaubern, kniff sich in die Wangen. Gerade als sie sich einen Tupfer des teuren Veilchenparfüms, das ihr ein anderer Kunde geschenkt hatte, hinter die Ohren tupfen wollte, klopfte es an der Tür. In ein paar Stunden würde Constanze ihrem Traum vom Leben ohne Prostitution einen Schritt oder zumindest um ein Schmuckstück näher sein.
Rasch ging sie zur Tür und presste die Zähne zusammen, um nicht zu humpeln. Sie würde sich eine sitzende Arbeit suchen müssen, vielleicht an einer Nähmaschine. Die Vorstellung war schön.
2
Ratzengrund, Wohnung der Feigls
Mit zitternden Händen griff Franz Feigl nach einem frisch gespitzten Kohlestift und setzte zu einer Linie an. Doch statt einem geraden Strich landete eine unruhige, stark verwackelte Linie auf dem ausgefransten Papier.
»Himmel, Arsch und Zwirn!« Fluchend warf er den Stift vor sich auf die Tischplatte. Er rollte zum Rand und fiel auf den Boden.
»Weder der Stift noch der Tisch können was dafür, dass du säufst!«, schimpfte Liliane Feigl, ging in die Knie und hob den Stift auf. Bestimmt war die Mine gebrochen.
Nach ihrem Arbeitstag in der Wiener Werkstätte fühlte sie sich erschöpft und müde. Wie immer hatte sie für ihren Vater Essensreste aus der Werkstatt mitgebracht. Die Künstlerinnen versorgten sich selbst mit köstlichen Speisen, die nie ganz aufgegessen wurden. Lili, die als Putzfrau auch für die kleine Küche in der Werkstätte zuständig war, hatte die Aufgabe, die Reste zu entsorgen. Was sie nur allzu gern tat. Bevor sie ihre Stelle in der Werkstätte angetreten hatte, war Hunger ihr ständiger Begleiter gewesen. Damit war seit ein paar Monaten Schluss. Einer der vielen Vorteile ihres geregelten Arbeitsalltags.
»Ich habe seit drei Tagen nichts getrunken«, verteidigte sich Franz Feigl finster.
»Und davor warst du monatelang im Dauerrausch.« Lili schob Papier und Stift zur Seite, stellte ihren Korb auf dem wackeligen Tisch ab und holte eine zusammengeschnürte karierte Stoffserviette heraus. In dem windschiefen Regal neben dem Spülbecken – eigentlich ein verbeulter Kübel – fasste sie nach einem abgeschlagenen Teller, dann entfaltete sie die Serviette. Zwei duftende Fleischlaberl kamen zum Vorschein. Beide legte sie auf den Teller und schob ihn zu ihrem Vater.
»Hier«, sagte sie. »Du musst was essen. Die Laberl sind köstlich. Helene hat sie gemacht.«
Helene Gabler war Lilis Lieblingskollegin. Sie war eine der wenigen, die nicht nur von Lilis Talent als Künstlerin wussten, sondern auch versuchten, sie zu fördern. Leider mit nur mäßigem Erfolg. Sowohl Koloman Moser als auch Josef Hoffmann sahen es nicht gern, wenn eine Putzfrau bei den edlen Designs der Wiener Werkstätte Hand anlegte. Obwohl Lilis Entwürfe mitunter besser waren als die der ausgebildeten Künstlerinnen.
In der Habsburgermonarchie war es Frauen nach wie vor untersagt, Kunst zu studieren, da es als unmoralisch galt, wenn sie nackte Körper zeichneten oder malten. Sie durften lediglich eine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule absolvieren. Danach war die Wiener Werkstätte einer der wenigen Orte, wo auch Frauen sich künstlerisch entfalten konnten. Aber selbst hier blieben ihnen bestimmte Gebiete verwehrt. Architektur und Möbeldesign waren den Männern vorbehalten, Frauen durften sich an Alltagsgegenständen, Stoff und Kleidung versuchen. Lili war von ihrem Vater, einem alkoholsüchtigen Künstler, der von seinen Arbeiten nicht leben konnte und sich daher mit dem Fälschen von Dokumenten über Wasser hielt, schon sehr früh in die Welt der Kunst eingeführt worden. Bereits im zarten Alter von fünf Jahren hatte sie zugesehen, wie Franz Feigl nackte Frauen malte. Und Lili hatte ihn nicht nur bei der Arbeit beobachtet, sondern auch so lange gebettelt, bis sie selbst den Stift führen durfte. Ihr Vater hatte sie in unterschiedlichen Maltechniken unterrichtet und ihr alles beigebracht, was er wusste und konnte. Mittlerweile übertraf Lili ihren Vater längst, und zwar im Fälschen ebenso wie im Malen. Ihre Stempelmarken sahen den echten zum Verwechseln ähnlich, und ihre Porträts waren Bilder, die nicht nur das Aussehen der Modelle, sondern auch deren Charakterzüge wiedergaben. Außerdem war Lili dabei, eine sehr persönliche Pinselstrichführung zu entwickeln, die ihre Bilder einzigartig machte. Leider würde die Welt niemals von ihrem Talent erfahren. In den Augen ihrer Mitmenschen war sie bloß eine Putzfrau.
»Ich hab keinen Hunger«, sagte Franz Feigl. Er schob den Teller von sich weg.
»Papa, du musst essen!«, beharrte Lili. Sie klang jetzt weniger streng, dafür umso besorgter. Ihr Vater hatte in den letzten Wochen noch weiter abgenommen und war nur noch ein Schatten seiner selbst. Die grauen, unrasierten Wangen waren eingefallen, die Augen lagen in tiefen dunklen Höhlen.
»Hier!« Erneut stellte sie die Fleischlaberl vor ihn hin. Außerdem holte sie ein Stück frisches Brot aus dem Korb sowie eine Salzgurke, die in Zeitungspapier eingewickelt war. Lili wusste, wie sehr ihr Vater diese Gurken liebte. »Nur ein paar Bissen«, bettelte sie.
Seufzend griff Franz nach der Gurke und biss ab. Er kaute so lange und umständlich daran, als handele es sich um ein mehrere Tage altes Brot. Als die Gurke verzehrt war, nahm er auch vom Fleischlaberl einen Bissen. Ein bisschen Farbe kehrte auf seine Wangen zurück.
»Na bitte, geht ja«, meinte Lili zufrieden.
»Vorhin war der rote Pepi da«, sagte er leise, ohne Lili anzusehen. Den Blick hielt er auf seine zitternden Hände gerichtet. Lili wusste auch so, was das bedeutete. Der rote Pepi war der Schuldeneintreiber von Dragan Zardic, einem Beisel- und Bordellbesitzer am Spittelberg. Den Spitznamen verdankte er seinem roten Vollbart. Franz Feigl ging regelmäßig in das »Goldene Vogerl« und verspielte und versoff Geld, das er nicht besaß.
»Wie viel ist es diesmal?«, fragte Lili.
Franz schwieg schuldbewusst.
»Wie viel?«, wiederholte Lili.
»Mehr, als wir haben«, gab Franz zu.
»Das heißt nicht viel. Denn wir haben nichts«, sagte Lili. »Ich habe meinen Lohn der Vermieterin gegeben.«
»Alles?«, fragte Franz entsetzt und hob nun doch den Kopf. Offenbar hatte er gehofft, dass Lili die paar Münzen, die sie in der Wiener Werkstätte verdiente, ihm überlassen würde.
»Ja«, log Lili. In Wahrheit hatte sie die Miete noch nicht beglichen, doch das würde sie ihrem Vater nicht verraten. Mizzi Horvath, die Eigentümerin des windschiefen Hauses am Ratzengrund, in dem Lili und ihr Vater seit Jahren wohnten, hatte wiederholt gedroht, sie beide rauszuwerfen, wenn sie nicht rechtzeitig bezahlten. Bisher hatte sie ihre Drohung noch nie wahr gemacht. Aber Lili wollte es nicht darauf ankommen lassen. So viele Menschen in Wien lebten auf der Straße oder in der Kanalisation, sie wollte weder das eine noch das andere. Ein Dach über dem Kopf, und war es noch so schäbig, war besser als jeder Schlafplatz unter der Brücke. Morgen in der Früh würde sie das Geld, das sie in den Falten ihres Unterrocks versteckt hatte, der Horvath bringen.
Lili warf einen Blick auf das Papier, das sie vorhin zur Seite geschoben hatte. Woran arbeitete ihr Vater? Vielleicht konnte sie ihm helfen? Neugierig zog sie die Blätter zu sich und erstarrte mitten in der Bewegung. Der Name Oskar Hecht stach ihr ins Auge.
»Was ist das?«, fragte sie tonlos. Ihr Herz setzte für einen Moment aus.
»Ein Ausweis«, sagte Franz seelenruhig. »Wenn Oskar entlassen wird, braucht er neue Dokumente.«
»Ich will diesen Mann nie wiedersehen!« Lili nahm die Hand von dem Papier, so als könnte allein der Name ihre Fingerkuppen verbrennen. »Das weißt du, Papa.«
»Oskar wird uns aus dem Schlamassel helfen«, erwiderte Franz voller Überzeugung. »Er kennt die richtigen Leute. Sobald er wieder auf freiem Fuß ist, sind die mageren Zeiten vorbei.«
»Oskar kennt Leute, die uns hinter Gitter bringen, genau wie sie es mit ihm gemacht haben.«
»Es war ein unglücklicher Zufall, dass er aufgeflogen ist. So einen Fehler macht er nicht noch einmal«, widersprach Franz.
Lili stützte sich mit beiden Händen auf der Tischplatte ab. »Ich habe eine ordentliche Arbeit. Wenn du nicht saufen und spielen würdest, hätten wir ausreichend Geld. Ich will Oskar nie wiedersehen.«
»Ach, Lili. Er wusste nicht, was er tat. Er war betrunken, als das passierte. Gib deinem Herzen einen Ruck, verzeih ihm …«
»Nein!« Lilis Stimme wurde ungewohnt laut. »Nie wieder. Hast du mich verstanden?« Sie nahm das Papier in die Hand und zerriss es in viele kleine Teile. Dann nahm sie die Fetzen, ging zum verbeulten Ofen, öffnete mit einem Haken das winzige Türchen und warf die Papierstücke in die Glut, wo sie augenblicklich Feuer fingen. Sie sah zu, wie sich das Papier kräuselte und schließlich zu Asche zerfiel.
»Sollte Oskar Hecht hier auftauchen, bin ich weg«, sagte sie grimmig.
»Es hat eine Zeit gegeben, da hast du ihn –«
Lili fiel ihrem Vater ungehalten ins Wort. »Das ist vorbei. Es war ein großer Fehler, ich war jung und dumm und unerfahren und –«
»Schon gut!« Beschwichtigend hob Franz Feigl beide Hände. »Ich habe dich verstanden.«
»Gut!«, sagte Lili.
»Das bedeutet aber, dass wir ein finanzielles Problem haben.«
»Wie viel, Papa?«
Niedergeschlagen zuckte Franz Feigl die Schultern und schwieg beharrlich.
»Hast du weitergemalt?« Lili kannte die Antwort auch so. Hätte Franz Feigl mit Ölfarben gearbeitet, würde sie es riechen. Lili liebte den Duft von Bindemittel, Ei und Farbe.
Sie schob den Vorhang zu dem Verschlag, in dem ihr Bett stand, zur Seite. Seit Tagen lehnten dort mehrere Leinwände. Dragan Zardic hatte ihrem Vater ein großzügiges Angebot gemacht. Er würde ihm die Schulden erlassen, wenn er zwei Bilder für ihn malte. Das war jedoch schon vor Wochen gewesen. Seither hatte Franz Feigl noch mehr Schulden gemacht und nichts gemalt.
Niedergeschlagen hob Franz die zitternden Hände. »Ich kann nicht«, sagte er traurig.
»Dann werde ich die Bilder fertig malen«, meinte Lili. »Misch mir die Farben an.« Sie sah ihren Vater streng an. »Das kannst du auch mit zitternden Händen.«
»Denkst du, du kannst nackte Frauen malen?«
»Warum nicht?«
Franz Feigls Gesicht hellte sich auf. »Du bist die Beste.«
»Ich weiß.« Lili ging zur Wand, wo zwei Schürzen hingen. Sie waren mit Farbspritzern übersät. Als sie die Bänder in ihrem Rücken zu einer Masche gebunden hatte, zeigte sie erneut zum Fleischlaberl. »Und bitte iss dein Abendessen auf.« Sie klang wie eine Mutter, die ihr ungezogenes Kind ans Aufessen erinnerte.
Bereitwillig griff Franz nach einem der Laberl und stopfte sich die Hälfte davon in den Mund. Kauend und schluckend stand er auf, ging zum Regal mit den Farbdosen. Trotz seiner zitternden Hände leerte er mit der Sicherheit jahrelanger Erfahrung Farbpigmente auf eine Steinplatte, mischte Wasser und Ei dazu und zog einen rund geschliffenen Stein, den Läufer, immer und immer wieder darüber. So lange, bis die winzigen Farbteilchen mit dem Bindemittel vermischt waren und eine geschmeidige, leuchtende Malfarbe ergaben. Er arbeitete langsamer als früher, aber immer noch präzise.
Franz Feigl mischte seine Farben mit einer jahrhundertealten Technik. Als Lili ein Kind gewesen war, hatte er immer wieder gesagt: »Was für Leonardo da Vinci gut war, sollte auch für uns passen.« Niemand traf Farbtöne besser als er. Lili notierte jeden seiner zitternden Handgriffe in ihrem Gedächtnis. Mit einem Mal war ihre Müdigkeit verschwunden. Das hier war es, was ihre Sorgen vertrieb und ihr das Gefühl gab, lebendig zu sein.
3
Alser Straße, Palais von Krause
Seit Minuten war das Ticken der Standuhr das einzige Geräusch im Esszimmer der Wohnung im dritten Stock des Palais von Krause. Noch vor zwanzig Jahren war das gesamte Gebäude im Besitz der Familie gewesen. Doch dann hatte Gottfried von Krause riesige Waldgebiete, zwei Zinshäuser und den Rest des Palais durch Spekulationen verloren. Als das Vermögen weg war, hatte er das Zeitliche gesegnet und seine Witwe und den gemeinsamen Sohn mit einem Haufen Schulden zurückgelassen. Mittlerweile waren alle Verbindlichkeiten getilgt, und übrig geblieben war eine Wohnung in einer der vornehmsten Gegenden Wiens. Stattliche vierhundert Quadratmeter teilte sich Max von Krause mit seiner Mutter Adele und Hedwig, der einzigen Hausangestellten, die noch für sie arbeitete. Dass ihr Schicksal weitaus schlimmer hätte ausfallen können, tröstete Adele von Krause nicht. Auch dass ein paar Straßenzüge weiter siebenköpfige Familien auf Zimmer, Küche hausen mussten, war ihr egal. Von Kindheit an waren Reichtum und Einfluss für sie selbstverständlich gewesen, den finanziellen Abstieg wollte sie nicht akzeptieren. Und so gelang es ihr, trotz geschrumpften Wohlstands ihren Einfluss in der Wiener Gesellschaft nicht zu verlieren. Nach wie vor gehörte sie zu den wenigen alleinstehenden Frauen Wiens, die bei keiner wichtigen Veranstaltung fehlen durften. Ihre Beliebtheit war Adele von Krauses Attraktivität und ihrem Charme geschuldet. Lud man sie zu einem Kultursalon, einer Soiree oder einer Tanzveranstaltung ein, konnte man sicher sein, dass der Abend ein Erfolg wurde. Niemand verstand es besser als sie, Menschen zusammenzuführen und zu unterhalten.
Ihr Sohn Max von Krause saß ihr nun gegenüber und musterte seine Mutter. Wie immer war sie tadellos gekleidet, perfekt frisiert und dezent geschminkt. Ihre Körperhaltung war trotz ihrer Schmerzen in den Gelenken und starken Rheumas kerzengerade. Niemals würde sie Schwäche zeigen.
»Du hast wieder einmal nichts gegessen«, tadelte sie ihren Sohn.
»Bröselkarfiol gehört nicht zu meinen Lieblingsgerichten.«
Dreimal pro Woche gab es dieses Armeleuteessen im Palais, gekochten Karfiol, den man in angerösteten Semmelbröseln wälzte. Allein vom Geruch wurde Max übel. Seine Mutter sparte beim Essen und gab das Geld, das ihr zur Verfügung stand, lieber im Café Français aus oder für einen Fiaker, wenn sie eine ihrer Freundinnen besuchen wollte.
Mit gerümpfter Nase schob Max den Teller von sich.
»Würdest du einer Arbeit nachgehen, die deiner Ausbildung entspricht, dann könnte Hedwig etwas anderes für uns kochen.«
Da war er wieder, der Vorwurf, den Adele von Krause in regelmäßigen Abständen aussprach. Sie konnte und wollte nicht verstehen, warum Max Polizeiagent war, wo er als Jurist doch genauso gut in einer Rechtsanwaltskanzlei arbeiten oder Notar werden könnte. Stattdessen quälte er sich Tag für Tag mit primitiven Kriminellen und einem völlig unqualifizierten Vorgesetzten herum, der die Stelle eines Oberkommissars nur deshalb innehatte, weil sein Schwiegervater der Schwager des Polizeipräsidenten war.
»Was ich tue, ist von großer Wichtigkeit«, sagte Max bestimmt. »Ich sorge Tag für Tag dafür, dass Wien eine sichere Stadt ist, in der man sich angstfrei bewegen kann!« Seit er sich zurückerinnern konnte, war Polizeiagent sein Traumberuf gewesen. Schon als kleiner Junge hatte er die Männer des Kaisers bewundert, die Verbrecher zur Strecke brachten. Max ahnte, dass sein Sinn für Gerechtigkeit etwas mit der Unehrlichkeit seines Vaters zu tun hatte. Doch darüber mit seiner Mutter zu sprechen hätte bloß alte Wunden aufgerissen.
»Ha, dass ich nicht lache!« Adele von Krause faltete die feine Stoffserviette und legte sie zur Seite. Auch sie hatte kaum etwas vom Gemüse auf ihrem Teller gegessen. »Wien wird niemals eine sichere Stadt werden. Es ist ein Moloch, eine Ansammlung von Kriminellen. Aus allen fünfzehn Kronländern kommen sie zu uns, in der Hoffnung auf Wohlstand. Und wenn sie ihn durch brave Arbeit nicht kriegen, dann fangen sie zu stehlen an.«
Max verdrehte die Augen. Immer wieder führte er mit seiner Mutter diese Diskussion. Sie war fest davon überzeugt, dass Menschen aus Galizien, Böhmen und Mähren, aus Serbien und Kroatien das Verbrechen nach Wien brachten. Es mochte ja stimmen, dass so mancher Taschendieb oder Kleinkriminelle nur gebrochen Deutsch sprach, aber die wirklichen Verbrecher, jene, die sich an der Not der ungebildeten Menschen bereicherten, waren Leute aus den höheren Schichten der Gesellschaft. Fabrikbesitzer, die ihre Arbeiter für einen Hungerlohn schuften ließen, Miethausbesitzer, die für feuchte, schimmlige Löcher viel Geld verlangten, oder Bordellbesitzer, die mit Mädchenhandel reich wurden. Gerade eben hielt ein Prozess Wien in Atem. Angeklagt war eine gewisse Regine Riehl, die als angesehene Bürgerin galt und in ihrem Bordell junge Prostituierte wie Gefangene gehalten hatte. Wenn auch nur die Hälfte dessen stimmte, was die Mädchen erzählten, würde man einem ganzen Ring von Menschenhändlern das Handwerk legen müssen.
»Da du von deinen aberwitzigen Ideen niemals ablassen wirst, habe ich beschlossen, selbst dafür zu sorgen, dass wir wieder zu den finanziellen Mitteln gelangen, die uns zustehen.«
Erstaunt hob Max die schwarzen Augenbrauen. Sie hatten die gleiche Farbe wie sein dichtes, struppiges Haar und passten zu den dunkelbraunen Augen.
»Willst du etwa reich heiraten?«, fragte er amüsiert.
»Ich nicht«, sagte seine Mutter kopfschüttelnd. »Für derlei Abenteuer bin ich reichlich zu alt.«
»Seit wann fühlst du dich für irgendetwas zu alt?« Erst letzte Woche hatte seine Mutter eine Landpartie auf den Tivoli mitgemacht und dort fröhlich das Tanzbein geschwungen.
»Na, ich werde doch nicht noch einmal zusehen, wie mein Gatte sich in fremden Betten vergnügt. Davon habe ich nach der Ehe mit deinem Vater genug.«
»Nicht alle Ehemänner betrügen ihre Frauen«, widersprach Max, auch wenn er seine Mutter verstehen konnte. Es gab kaum eine Frau in Wien, in deren Bett Gottfried von Krause nicht gelegen hatte. Max wollte sich nicht ausmalen, wie viele Halbgeschwister er hatte, von denen er nichts wusste.
»Die halbwegs Attraktiven tun es«, entgegnete Adele von Krause. »Nein danke, von der Ehe habe ich genug.« Seit dem Tod ihres Ehemanns genoss sie die Freiheiten, die ihr das Dasein als Witwe bescherte. »Aber es wird höchste Zeit, dass du selbst in den heiligen Stand der Ehe eintrittst und dafür sorgst, dass der Name von Krause nicht ausstirbt.« Bei diesen Worten richtete sie ihren Zeigefinger auf Max. Der verschluckte sich an dem winzigen Brösel, das noch in seiner Kehle steckte, und musste husten.
»Nimm einen Schluck Wasser!« Adele von Krause schob ihm Krug und Glas entgegen. Doch Max winkte ab. Er hatte das Brösel weggehustet und richtete sich mit geröteten Wangen wieder auf.
»Es kann dich wohl kaum überraschen, dass ich diesen Wunsch äußere«, fuhr seine Mutter unbeirrt fort. »Du hast die dreißig überschritten.«
»Ja und? Es gibt Männer, die werden mit fünfzig noch Vater.«
»Mach dich nicht lächerlich, Max. Du wirst doch nicht als Tattergreis mit Stock deinem Kind hinterherlaufen wollen.« Adele verzog den Mund. »Außerdem möchte ich noch zu meinen Lebzeiten Großmutter werden. Das wirst du mir wohl nicht verwehren.«
»Du hast noch viele Jahre vor dir.«
Adele winkte ungeduldig ab. »Keine Widerrede. Ich habe bereits mehrere junge Damen im Visier.«
Fassungslos starrte Max seine Mutter an. »Du hast was?«
»Im Moment kommen drei in die engere Wahl«, erklärte Adele so seelenruhig, als würde sie eben die Zutaten eines Rezepts aufzählen. »Katharina von Bernstein, ihr Vater ist Bankier. Gertrude Rothenberg, sie stammt aus einer Unternehmerfamilie, den Rothenbergs gehören mehrere Kaufhäuser und Fabriken in und rund um Wien. Und Sibille von Aehrenthal.« Adeles Gesicht hellte sich auf. Offenbar war diese junge Dame in ihren Augen die ideale Schwiegertochter.
»Die Tochter des Außenministers?« Max glaubte, sich verhört zu haben.
»Ebendie«, bestätigte Adele. »Die Familie hat Geld wie Heu, trotzdem ist es nicht einfach, fünf Töchter standesgemäß unter die Haube zu bringen. Sibille ist die jüngste der jungen Damen. Niemals würde Aehrenthal einen einfachen Kommissar als Schwiegersohn akzeptieren.«
Es fiel Max schwer, der Logik seiner Mutter zu folgen. Von seinem Adelstitel abgesehen, war er ein einfacher Kommissar.
»Der Außenminister würde dafür sorgen, dass du die Karriereleiter hinaufpurzelst. Und zwar gleich um mehrere Stufen.« Zufrieden rieb sich Adele die Hände. »Auf diese Weise wären zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.« Sie schien von ihrer Idee begeistert.
»Vergiss es!« Ungehalten schnitt Max seiner Mutter das Wort ab. Genau in diesem Moment klopfte es an der Wohnungstür.
Es dauerte ein wenig, bis Hedwig öffnete, die Haushälterin war nicht mehr die Jüngste. Alle ihre Bewegungen waren langsam und bedächtig. Als sie ein paar Minuten später mit einem jungen Mann im Schlepptau ins Esszimmer kam, war Max erstaunt und erleichtert zugleich. Es war der Polizeidiener Carel Novak. Der fleißige junge Mann war noch nie zu Max nach Hause gekommen, es musste sich also um eine äußerst dringende Angelegenheit handeln. Eine, die keinen Aufschub duldete und Max die Fortführung dieser unerfreulichen Unterhaltung ersparte.
»Guten Abend!« Carel knüllte seine Stoffmütze zusammen und schaute verlegen zu Boden. »Ich bitt um Entschuldigung. Aber es ist ein Verbrechen passiert, bei dem wir Sie brauchen. Der Oberkommissar Sobotka hat mich geschickt.«
»Dieser aufgeblasene, lächerliche Zwerg!«, schnaufte Adele von Krause verärgert. »Was bildet er sich ein? Soll er doch einmal selbst sein Hinterteil erheben und nach Verbrechern suchen. Ständig lässt er andere arbeiten und streicht dann die Lorbeeren ein.«
Erstaunt ob der beleidigenden Worte hob Carel den Kopf und errötete.
Max tat so, als hätte er die Bemerkung seiner Mutter nicht gehört. Ohne Bedauern stand er auf.
»Mutter, du entschuldigst mich. Die Pflicht ruft.«
War es verwerflich, Erleichterung zu verspüren, weil ein Verbrechen verübt worden war? Schnell, bevor seine Mutter noch weitere Beschimpfungen von sich geben konnte, verließ er das Speisezimmer und eilte förmlich aus dem Palais.
Verdattert folgte ihm Carel.
4
Zirkusgasse, Hotel Kaiserkrone
Max winkte einen Fiaker herbei und kletterte ins Wageninnere. »Zirkusgasse 3!«, rief er dem Mann am Kutschbock zu. Der sah ihn mit glasigen Augen an, tippte mit dem Zeigefinger auf seine Melone, straffte die Zügel, und schon setzten sich die Pferde mit einem heftigen Ruck in Bewegung. Ratternd holperten die Räder des Wagens über das Kopfsteinpflaster auf dem Weg zum Ring.
»Carel, erzähl mir, was du über den Mord weißt.« Max wollte die Fahrt nutzen, um nicht unvorbereitet zum Tatort zu gelangen.
»Wir haben eine Rohrpost vom Telegrafenamt in der Leopoldstadt bekommen«, sagte Carel.
»Eine Rohrpost?«, fragte Max überrascht. Diese Art der Kommunikation wurde nur noch äußerst selten verwendet. Sie war so veraltet wie der Sprechtrichter am Stephansdom, der direkt mit der Feuerwache Am Hof verbunden war.
»Der Hoteldirektor Markus Fellner hat darauf bestanden. Er will, dass es so wenig Aufsehen wie möglich gibt und der Vorfall geheim bleibt. Deshalb wollte er wohl auch kein Telegramm schicken.«
»Und was schreibt der Direktor in seiner Nachricht?« Der Fiaker bog so rasant in eine Seitengasse ein, dass Max und Carel gegen die Wand des Wagens rutschten. »Bitte etwas vorsichtiger!«, rief Max durch das Fenster zum Kutscher. Der schien ihn nicht zu hören, denn die Kutsche fuhr nicht langsamer.
»Dass es in seinem Hotel einen bedauerlichen Vorfall mit einer Toten gegeben habe und er umgehend die Unterstützung erfahrener Beamter brauche, die den Fall mit der notwendigen Diskretion behandeln.«
»So hat er es formuliert?«, fragte Max. »Erfahrene Beamte, die diskret arbeiten?«
Carel zuckte mit den Schultern. Wieder rumpelte der Wagen, diesmal rutschte der Diener auf die andere Seite der gepolsterten Bank. »Zumindest hat das der Oberkommissar gesagt.«
»Du hast die Nachricht nicht selbst gesehen?«
»Natürlich nicht. Sie ging direkt zum Oberkommissar Sobotka.«
»Wissen wir irgendetwas über die Art des Verbrechens? Wurde jemand ermordet? Oder gab es bloß einen bedauerlichen Unfall, für den jemand verantwortlich gemacht wird?«
»Ich weiß nicht mehr, als ich Ihnen gerade gesagt habe.« Hilflos hob Carel die Hände. Er verlor dabei das Gleichgewicht und rutschte auf Max zu. In letzter Sekunde konnte er sich abstützen und wieder zurücklehnen.
»Der Fiaker ist eine Gefahr für seine Gäste und alle Fußgänger«, raunte Max leise. Laut rief er zum Fahrer vor: »Entweder Sie drosseln das Tempo, oder ich sorge dafür, dass Sie Ihre Lizenz verlieren!«
Jetzt reagierte der Fiaker. »Die Kiwarei hat in Wien ganz andere Sorgn.« Er sprach mit Zungenschlag.
»Ich bin von der Polizei«, sagte Max finster.
Der Fiaker drehte sich zu ihm um, und jetzt schrie Max den Mann regelrecht an. »Schauen Sie gefälligst nach vorne. Ich will noch ein paar Jahre leben.«
Sofort drosselte der Mann das Tempo so dramatisch, dass Max und Carel zu Fuß schneller vorangekommen wären.
»Soviel ich weiß, ist Markus Fellner mit dem Oberkommissar verwandt«, sagte Carel.
»Ach, daher weht der Wind! Freunderlwirtschaft!« Max konnte seine Verärgerung nicht verbergen. Sobotka war nicht nur eingebildet und präpotent, sondern schreckte auch vor Korruption nicht zurück. Außerdem war er altmodisch und verweigerte bei den Ermittlungen hartnäckig den Einsatz neuester technischer Errungenschaften. Ignorant lehnte er den Einsatz von Fotografien und die Spurensuche mittels Fingerabdrücken ab. Und seine Skrupellosigkeit wuchs von Monat zu Monat. Immer wenn er sich bei einem Fall einen persönlichen Vorteil versprach, machte er seinen Mitarbeitern Druck. Aber bei Verbrechen an unbedeutenden Opfern aus der Unterschicht konnte es schon mal passieren, dass er einen noch unbearbeiteten Akt als erledigt abstempelte und zur Seite legte. »Interessiert ohnehin niemanden, wer so ein Stubenmädchen erschlagen hat. Sie wird wohl frech gewesen sein oder sich der unerlaubten Prostitution hingegeben haben.« Noch wagte er es nicht, solche Aussagen Max gegenüber zu tätigen. Doch es war wohl nur eine Frage der Zeit. Bei Carel nahm er sich kein Blatt vor den Mund. Sobotka wähnte sich in einer absolut sicheren Position. Mit der schützenden Hand des Polizeipräsidenten über sich konnte er sich so manchen Fauxpas erlauben.
»Na, dann lassen wir uns überraschen«, meinte Max. »Mal sehen, was uns gleich erwartet.«
Schon wenige Straßenzüge weiter hielt die Kutsche an. Max kletterte aus dem Wagen und beglich den Fahrpreis. Kurz überlegte er, ob er den Mann nach seiner Lizenz fragen und ihm noch einmal drohen sollte, aber dann ließ er es bleiben; schließlich hatte der Fiaker sie sicher in die Zirkusgasse gebracht und dafür ein moderates Fahrgeld verlangt.
Sie standen vor einem vierstöckigen Gebäude. Im Erdgeschoss gewährten große, rundbogenförmige Fenster Einblick in einen hell erleuchteten Speisesaal und ein Café. In den Fenstern der oberen Etagen schützten Vorhänge die Gäste vor neugierigen Blicken. Das Hotel war im Zuge der Weltausstellung errichtet und eröffnet worden. Es gehörte zu den besseren, aber nicht den teuersten Adressen der Stadt. Dennoch musste man über eine gewisse Summe verfügen, wenn man sich hier ein Zimmer leistete.
Max und Carel gingen auf den Eingang zu. Ein junger Bursche, der stramm wie ein Soldat neben der Tür stand, verneigte sich unterwürfig vor ihnen und öffnete rasch die Tür für sie.
»Haben die Herrschaften Gepäck dabei?«
»Wir sind von der Polizei.«
Augenblicklich duckte sich der Bursche und zog den Kopf ein. Er legte den Finger auf den Mund. »Der Herr Direktor würde Sie bitten, Ihre Profession nicht laut zu nennen.«
Max spürte, wie er zunehmend ungehalten wurde. Schweigend ging er an dem Burschen vorbei. Das Foyer des Hotels war luxuriös ausgestattet, beigefarbene Samttapeten lieferten einen dezenten Untergrund für goldgerahmte Spiegel und Ölgemälde. Die Spiegel ließen die Halle größer erscheinen, als sie tatsächlich war. Von der Decke hing ein eindrucksvoller Lüster, unzählige geschliffene Glassteine reflektierten das Licht der Gaslampen. Der Boden war mit einem weinroten Teppich ausgelegt, der jegliches Schrittgeräusch schluckte. Aus dem angrenzenden Speisesaal tönten das Klappern von Geschirr und leises Stimmengewirr.
Kaum standen sie vor dem Tresen der Rezeption, eilte der Mann dahinter nach vorne und begrüßte sie. Auch er trug eine dunkelgrüne Uniform wie der Page an der Tür. Doch der Schnitt seines Fracks war deutlich vornehmer. Auf einem goldenen Schild an seiner Brust war sein Name zu lesen: »Herr Leopold«.
»Sie müssen Herr von Krause sein«, sagte er schnell, »wir haben Sie bereits erwartet. Darf ich Sie in den zweiten Stock führen?« Herr Leopold gab Max keine Gelegenheit, nach dem Grund seiner Anwesenheit zu fragen, sondern winkte ihn und Carel über die breite Treppe weiter. Die Gäste im Speisesaal nahmen von den beiden keinerlei Notiz. Sie sahen aus wie ganz normale Hotelgäste, die in ihr Zimmer geführt wurden.
»Was ist passiert?«
»Sie werden es gleich sehen!« Herr Leopold flüsterte. »Ich muss Sie aber warnen. Das ist nix für schwache Nerven.«
Im zweiten Stockwerk angekommen, nahm der Rezeptionist den Gang nach rechts. Auch hier sorgte ein roter Teppich für leise Schritte, und am Ende des Korridors stand eine Kommode mit einem üppigen Herbstblumenstrauß, der ein süßliches Aroma verströmte. Herr Leopold holte einen Schlüsselbund aus seiner Hosentasche und sperrte auf. Völlig geräuschlos öffnete sich die Tür. Die Scharniere waren gut geölt.
Herr Leopold sah über die Schulter hinter sich den Gang entlang. Er war leer, was ihn sichtlich erleichterte.
»Bitte sehr!« Er ließ Max und Carel den Vortritt.
Es überraschte Max nicht, dass bereits jemand vor ihm hier war. Dr. Böhm, der Polizeiarzt, kniete am Boden neben dem Bett, auf dem eine nackte Frau in blutdurchtränkten Laken lag. Sie hing rücklings und kopfüber in unnatürlicher Haltung über den Bettrand. Ihr dunkles Haar war offen und berührte den Boden. Die Frage, ob sie noch am Leben war, erübrigte sich.
Als Dr. Böhm Max erblickte, stand er auf und begrüßte ihn. Der Polizeiarzt war ein älterer Herr mit grauem Haar und einem Backenbart, wie der Kaiser ihn trug. Auf der Nase hatte er eine kleine Metallbrille. Seit Max bei der Polizei arbeitete, war es Dr. Böhm bis auf ein paar wenige Ausnahmen gelungen, immer vor ihm am Ort des Verbrechens zu sein. Meist hatte er die Leiche bei Max’ Eintreffen bereits untersucht gehabt und jede Menge seiner eigenen Fingerabdrücke hinterlassen.
Umso überraschter war Max, dass der Arzt heute Handschuhe trug. Er wirkte, als würde ihn dieser Fall weitaus mehr mitnehmen als die meisten bisher. Jede Farbe war aus seinem Gesicht gewichen.
»In all den Jahren habe ich so etwas noch nie gesehen«, sagte Dr. Böhm leise. »Hier war ein Teufel am Werk.«
»Guten Tag«, sagte Max. »Freut mich, dass Sie Handschuhe anhaben.«
Dr. Böhm sah auf seine Hände. Er wirkte irritiert, so als hätte er erst jetzt bemerkt, dass er sie nicht ausgezogen hatte. Schließlich sagte er: »Ich will mir von Ihnen nicht wieder einen Vortrag halten lassen, ich würde Spuren zerstören. Schon gar nicht bei diesem grauenvollen Verbrechen.«
»Das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Danke!«
Dr. Böhm wandte sich zur Toten um. »Wer immer dieses Verbrechen begangen hat, er muss einen kranken Verstand haben. Kein gesunder Mensch ist zu so einer Tat in der Lage.«
Max streifte selbst dünne Handschuhe über, die er stets in der Sakkotasche bei sich trug, und machte einen Schritt auf das Bett zu. Ihm stockte der Atem. Als Kommissar war er an Bluttaten gewöhnt, und in den letzten Jahren hatte er so manch hässliche Leiche gesehen, aber etwas derart Brutales war auch für ihn neu.
»Oh mein Gott«, flüsterte er. Der Bauch der Toten wies ein bizarres Muster an Stich- und Schnittwunden auf. Jemand hatte sich viel Mühe gegeben und den Körper als makabre Leinwand missbraucht. Auch das Gesicht und die Kehle waren mit einem Messer entstellt worden. »War die Arme noch am Leben, als man sie so zugerichtet hat?« Max musste sich zwingen, auf den Leichnam zu schauen. Sein Instinkt riet ihm, sich abzuwenden.
»Ich fürchte, ja«, sagte Dr. Böhm. »Wäre sie tot gewesen, hätte sie wohl nicht mehr geblutet.« Er wies auf das dunkelrote Laken. Der Teppich war ebenfalls durchtränkt, das Blut war vom Bett auf den Boden getropft.
»Wer tut einer Frau so etwas an?«, fragte Carel entsetzt. Auch der Polizeidiener hatte einen derart grausamen Tatort noch nie gesehen.
»Ein Irrer«, sagte Max überzeugt. Er sah sich im Zimmer um. Ein seltsamer Geruch hing in der Luft.
»Riechen Sie das?«, fragte er und trat zum Fenster, wo der seltsame Gestank herzukommen schien.
»Es ist der Geruch der Hölle«, flüsterte Carel bedrückt. Max hatte ihn noch nie so verstört gesehen. Er richtete seinen Blick auf das weiß gestrichene Fensterbrett, auf dem sich dunkler Staub befand. Max bückte sich, um daran zu schnuppern. »Eine Schwefelmischung«, sagte er.
»Der Gestank ist mir auch aufgefallen«, gab Dr. Böhm zu. »Sie haben recht, es ist Schwefel. Deshalb auch die Assoziation mit der Hölle.«
Nun betrat ein weiterer Herr den Raum. Er war klein und untersetzt und trug einen eleganten Anzug aus teurem Stoff. In seiner Westentasche steckte ein Monokel. Max schätzte ihn auf Mitte vierzig. An den Schläfen ergraute sein Haar, am Hinterkopf war es nur noch schütter. Er wirkte nervös. Mit fahrigen Bewegungen schloss er die Tür hinter sich.
»Guten Abend«, sagte er. Seine Stimme klang schrill. »Mein Name ist Markus Fellner. Ich bin der Hoteldirektor.«
Max trat auf ihn zu, streifte den Handschuh wieder ab und reichte ihm die Hand. Die Finger des Direktors waren eiskalt und feucht. Max sah unweigerlich kleine Fische vor seinem inneren Auge. »Kommissar Max von Krause. Ich bin kaiserlicher Polizeiagent.«
»Ich weiß, wer Sie sind, Oberkommissar Sobotka hat Sie angekündigt und versichert, dass Sie diese unerfreuliche Angelegenheit mit der notwendigen Diskretion behandeln werden.« Er vermied es, auf die Tote am Bett zu schauen.
Max ging nicht auf die Bemerkung ein. Stattdessen holte er ein Notizbuch aus seinem Sakko und schlug es auf.
»Wer hat die Tote gefunden und wann? Wie heißt die Frau, war sie öfter hier zu Gast? Kannten Sie sie?«
»Die Frau ist mir völlig unbekannt. Sie ist heute Morgen allein angereist und hat sich als Constanze Brühl ausgegeben. Mein Mitarbeiter hat ihren Ausweis gesehen.«
»Frau Brühl hat sich ein Doppelzimmer genommen?« Max wies auf das breite Bett.
Ohne hinzuschauen, nickte der Direktor. »Sie erwartete ihren Ehemann, er sollte am Nachmittag eintreffen. Falls er hier war, haben wir ihn nicht kommen sehen. Entweder ist er unbemerkt an der Rezeption vorbeigegangen, oder er hat den Personaleingang ins Hotel genommen. Dieser befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes.«
»Ist es üblich, dass Gäste über die Hintertür ins Haus kommen?«, fragte Max.
»Hin und wieder bevorzugen Stammgäste die Hintertreppe. Wenn sie aus der Innenstadt kommen, ersparen sie sich so ein paar Schritte.«
»War Herr Brühl ein Stammgast?«
»Nein. Wir haben den Mann in unserem Hotel noch nie als Gast begrüßen dürfen.«
»Woher könnte er dann den Hintereingang gekannt haben?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen, und ich weiß auch nicht, ob er es war, der dieses …«, er machte eine Pause und verschluckte ein Wort, »… angerichtet hat.«