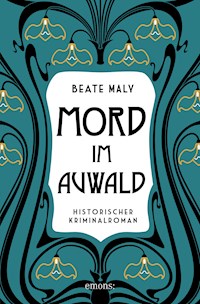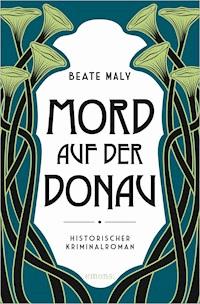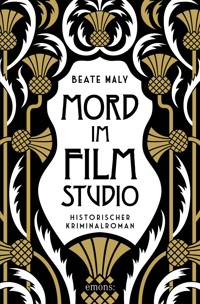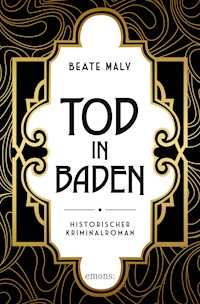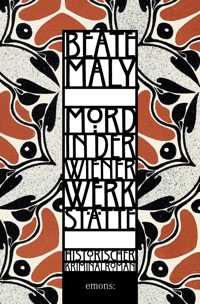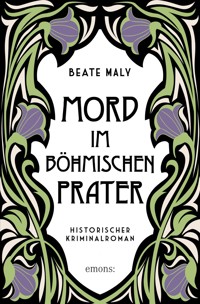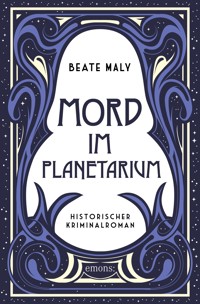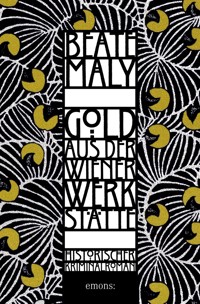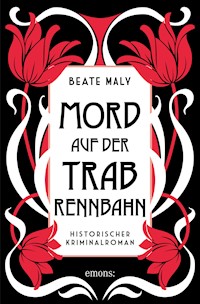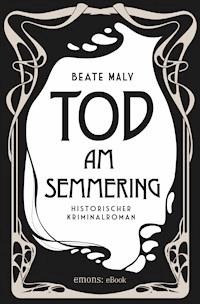
9,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ernestine Kirsch und Anton Böck
- Sprache: Deutsch
Tödlicher Tango im Schneesturm – Auftakt der erfolgreichen Ernestine-und-Anton-Reihe 1922. Im Grandhotel Panhans am Semmering trifft sich die feine Gesellschaft zu einem wohltätigen Tanzkurs. Doch die festliche Stimmung kippt, als ein Gast vergiftet zusammenbricht. Ein Schneesturm schneidet das Hotel von der Außenwelt ab: keine Polizei, kein Entkommen – auch nicht für den Mörder. Die pensionierte Lehrerin Ernestine Kirsch beginnt gemeinsam mit ihrem treuen Begleiter Anton Böck zu ermitteln. Hinter der mondänen Fassade stoßen sie auf wohlgehütete Geheimnisse, alte Rechnungen – und ein Verbrechen, das weit über einen einzelnen Mord hinausgeht. Entdecken Sie mit »Tod am Semmering« den Auftakt der Erfolgsreihe von Bestseller-Autorin Beate Maly – ein klassischer Whodunit mit Charme, nostalgischer 1920er-Jahre-Atmosphäre und einem Ermittlerduo zum Verlieben. Für alle Fans von Wohlfühlkrimis im Stil von Agatha Christie. Band 1 der Reihe »Ernestine Kirsch und Anton Böck«. Alle Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Beate Maly wurde 1970 in Wien geboren, wo sie bis heute mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt. Zum Schreiben kam sie vor rund zwanzig Jahren. Zuerst verfasste sie Kinderbücher und pädagogische Fachbücher. Seit rund zehn Jahren widmet sie sich dem historischen Roman und liefert mit »Tod am Semmering« ihren ersten Kriminalroman.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827
©2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: shutterstock.com/Lunetskaya Umschlaggestaltung: Nina Schäfer Lektorat: Christine Derrer eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-120-8 Historischer Kriminalroman Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Die Gegenwart kann man nicht genießen, ohne sie zu verstehen, und nicht verstehen, ohne die Vergangenheit zu kennen.
Sigmund Freud
PROLOG
Isonzotal, Herbst 1917
Hell und verheißungsvoll kämpfte sich die Sonne durch das milchige Weiß des Morgennebels. Ihr Licht hatte die kräftigen Orangetöne des Sommers verloren, und mit jedem Tag wich die erbarmungslose Hitze der letzten Wochen einer sanften, angenehmen Wärme.
Nun lösten sich nach und nach die Nebelschwaden auf, und ein weiterer wolkenloser Herbsttag kündigte sich an. Einer jener Tage, die zum Spielen im Freien einluden und wie dazu geschaffen waren, ein letztes Mal die Zehen in den eiskalten Gebirgsbach zu stecken, der über schroffe Felswände schoss und im Tal den Isonzo speiste.
An einem Tag wie heute konnte man einfach nicht im Dorf bleiben. Mutter musste verstehen, dass Mario mit seinem Bruder zum Fluss lief. Die Staumauer aus grauen Granitsteinen war immer noch nicht fertig. Morgen würde es vielleicht schon regnen, und dann wäre der Sommer für dieses Jahr ein für alle Mal vorbei. Tage wie diesen durfte man nicht verschwenden. Sie waren ein Geschenk, ein letztes Aufbegehren des Sommers, bevor Kälte, Nieselregen und schließlich Schnee ihn endgültig für die nächsten sieben Monate ablösten.
Wenn Mutter nichts von ihrem heimlichen Ausflug erfuhr, konnte sie nicht schimpfen. Sie hatte einfach zu viel Angst. Ja, es war Krieg, und die feindliche Armee hockte hinter einem der Berggipfel, die neben ihrem Dorf steil in den Himmel aufragten. Aber die fremden Männer in den grauen schmutzigen Uniformen waren auch nur Menschen und keine Ungeheuer, wie Großmutter es ihnen versuchte einzureden. Die Soldaten waren Männer wie Vater, sie dienten bloß einer Armee auf der anderen Seite der Berge. Diese Männer waren genauso abgemagert und müde wie die Italiener, und in ihren Augen lagen Heimweh und Schmerz. Mario wusste es, denn er hatte sie gesehen. Letzte Woche war er einer Gruppe Österreicher begegnet. Zuerst hatte er davonlaufen wollen, aber dann war er stehen geblieben. Einer der Männer hatte ihn zu sich gewunken und Mario eine Haselnusswaffel geschenkt. Sie war in rosarotes Papier, das eine riesige Kirche zierte, eingewickelt gewesen, und sie hatte besser geschmeckt als alle Süßigkeiten, die Mario je gegessen hatte. Wer Haselnusswaffeln verschenkte, schoss auf keine Kinder. Mutter und Großmutter hatten unrecht. Ein Grund mehr, diesen Vormittag zu nutzen.
»Komm schnell!« Mario boxte seinen Bruder in den Oberarm. »Wir haben nicht viel Zeit. Wenn Mutter vom Dorf zurück ist, müssen wir auch wieder da sein, sonst stellt sie Fragen und dann gibt’s Ärger, und den wollen wir doch nicht. Oder?«
Francesco schüttelte ernst den Kopf. Er war zwei Jahre jünger als sein Bruder, hatte hellblonde Locken und ein pausbackiges Gesicht. An manchen Tagen war Mario davon überzeugt, dass Gott bei der Geburt seines Bruders eigentlich einen kleinen Engel hatte erschaffen wollen. Aber irgendetwas war schiefgelaufen, und dann war Francesco auf die Welt gekommen. Er sah aus wie eine jener Figuren, die den Altar der Dorfkirche flankierten, aber er hatte den Willen eines kleinen Teufels, und wenn er sich etwas in den hübschen Kopf setzte, versuchte er es mit allen Mitteln durchzusetzen. Mit Marios Vorschlag war er auf jeden Fall einverstanden.
Die Kinder warfen einen letzten Blick in den Stall. Im niedrigen Holzverschlag kaute die Ziege friedlich am frischen Heu. Die Hühner hockten auf ihren Stangen, und dort, wo sonst die Kühe standen, war der Platz leer. Die beiden Tiere würden erst am Abend wieder zurückkommen. Es war alles, wie es sein sollte. Auch im Haus war es still, die Großmutter arbeitete in der Küche. Es roch sauer nach Brotteig. Heute war Backtag. Die alte Frau würde den ganzen Vormittag vor dem Ofen verbringen und kein einziges Mal nach ihren Enkelsöhnen schauen.
Einen besseren Zeitpunkt konnte es nicht geben. Auf ein vereinbartes Zeichen liefen sie los, barfuß über die taunasse Wiese vor dem Hof. Die Wassertropfen waren kalt, und die Grashalme kitzelten zwischen den Zehen. Es war ein herrliches, befreiendes Gefühl, und mit jedem Schritt, den sie sich vom Hof entfernten, wuchs die Vorfreude auf den Fluss.
Mario sprang über einen der Felsbrocken, die in unregelmäßigen Abständen in der Wiese lagen. Er landete auf weichem Moos und lief weiter. Bereits von Weitem konnte er das Gurgeln und Glucksen des Wassers hören, und aus lauter Vorfreude auf das glitzernde Türkisblau beschleunigte er sein Tempo. Zu spät bemerkte er, dass Francesco ihm nicht mehr folgte. Er musste irgendwo stehen geblieben sein. Merkwürdig, das tat er sonst nie. Im Gegenteil, meistens überholte Francesco ihn, weil er ebenso schnell rennen und klettern konnte wie die Gämsen, die sie manchmal in den Felswänden beobachteten.
Mario hielt an, drehte sich um und suchte nach dem Bruder. Er legte seine Hand schützend über die Augen und blinzelte gegen die Sonne, die nun vollständig aufgegangen war.
»Francesco?« Seine Stimme klang unnatürlich laut und schreckte einen Vogel im Gebüsch neben ihm auf. Aber nichts rührte sich.
»Francesco, wo bist du?«
Verärgert stampfte Mario mit dem Fuß auf. Manchmal war Francesco wirklich anstrengend. Konnte er nicht einfach tun, was man ihm sagte? Es war doch nicht so schwer, hinter ihm herzulaufen. Widerwillig ging Mario ein paar Schritte zurück, wieder den Hang hinauf, dabei wollte er viel lieber hinunterlaufen. In der Ferne konnte er das nicht mehr ganz weiße Hemd seines Bruders erkennen. Es blitzte in der hellen Morgensonne vor den Bäumen auf der Waldlichtung auf. Francesco war in die völlig falsche Richtung gelaufen. Was hatte er sich dabei nur gedacht? Nun hockte er am Boden und stocherte mit einem Stock in einem Gegenstand herum, den Mario nicht erkennen konnte. Vielleicht hatte er ein totes Tier gefunden, vielleicht einen alten Eimer oder Kanister.
Mario wollte sehen, worum es sich handelte, und lief los. Deutlich langsamer als zuvor, denn der Weg führte nun steil bergauf. Vor einem Felsbrocken machte er kurz Halt, und genau in dem Moment hörte er die Explosion. Der Knall war so heftig und laut, dass die Erde unter ihm bebte und die Bäume ins Wanken gerieten. Als der entsetzliche Lärm nachließ, hielt ein hoher, surrender Ton in Marios Ohren an. Sicher war er nun taub und würde es für den Rest seines Lebens bleiben. Erschrocken blieb er stehen, presste seine Handflächen fest gegen die Ohren. Wo war Francesco? Dort, wo er eben noch gehockt hatte, lag nur noch ein Teil von ihm im blutverschmierten Gras. Francescos Hemd war nun nicht mehr weiß, es war dunkelrot. Ein weiterer Teil seines Bruders lag unter einem abgeernteten Holunderbusch, sein Bein neben einer Fichte.
Rauch stieg vom Boden auf und mit ihm ein entsetzlicher, stechender Gestank. Unfähig, sich Francesco zu nähern, blieb Mario wie angewurzelt stehen. Er musste husten. Es war, als verätzte jeder Atemzug seine Lungen. Er schnappte nach Luft, griff sich an den Hals. Ihm wurde schlecht. Das Surren in seinen Ohren wurde wieder lauter. Atmen, ich muss atmen, dachte er verzweifelt. Aber es ging nicht. Seine Kehle war wie zugeschnürt, so als würde jemand ein Seil um seinen Hals legen und beide Enden fest zuziehen. Was würde Mutter sagen, wenn sie sähe, was passiert war? Sie würde ihm die Schuld geben, und sie würde ihn hassen. Die Bilder vor seinen Augen verschwammen. Langsam ging er in die Knie, sackte kraftlos zusammen und hockte sich ins immer noch feuchte Gras. Mit den Fingern krallte er sich in den Halmen fest.
Aufstehen, dachte er. Ich muss aufstehen und Francesco von dort wegholen. Aber er konnte nicht, er war wie gelähmt.
Die Rauchwolke, die vom Unglücksort ausging, senkte sich nun über die Wiese und hüllte Mario in einen hellen Nebel. Das Rauschen in seinen Ohren wurde unerträglich, ihm wurde schwarz vor Augen, und er legte den Kopf ins Gras. Es sollte nach Erde riechen, aber das tat es nicht. Alles stank süßlich faul, wie kaputtes, feuchtes Heu. Es war der Tod, der so roch. Vor seinem inneren Auge sah er das Bild seines Bruders. Francesco hatte das Antlitz eines Engels verloren, sein Gesicht war bloß noch ein zerfetzter Klumpen aus Fleisch und Blut. Mario sah seine Mutter weinen. Vielleicht würde sie nie wieder damit aufhören. Er wollte auch weinen. Die Tränen saßen hinter seinen Augen, salzig und schwer, aber es fehlte ihm die Kraft, sie zu vergießen. Endlich umhüllte ihn weiche, erlösende Dunkelheit, und die schrecklichen Bilder verschwanden für immer.
EINS
Semmering, 1922
»Schade, dass wir die Landschaft nicht sehen können. Es heißt, dass man vom Zug aus einen atemberaubenden Ausblick auf die Berge hat.« Ernestine Kirsch, Lehrerin im Ruhestand, hielt ihr Gesicht so dicht an die Scheiben des Waggonfensters, dass ihr Atem sie beschlug und ihre spitze Nase darin einen Abdruck hinterließ. »Nicht einmal die Umrisse eines Berges. Nichts außer Dunkelheit«, seufzte sie enttäuscht und ließ sich in den weich gepolsterten weinroten Sitz des Erste-Klasse-Waggons plumpsen.
Trotz ihrer neunundfünfzig Jahre war sie eine neugierige und unternehmungslustige Frau geblieben. Weder die entbehrungsreichen Jahre des Krieges noch die schwere Lungenkrankheit, die sie kurz danach für Monate ans Bett gefesselt hatte und für ihre frühzeitige Pensionierung verantwortlich war, hatten ihre Lebenslust schmälern können. Jeder Tag war ein neues Abenteuer, dem sie voller Freude entgegenblickte, wie die Kinder, die sie jahrelang unterrichtet hatte.
»Sie werden noch genug Möglichkeiten haben, sich am Panorama der Berge zu erfreuen«, meinte Anton Böck. Er schaute aus dem Fenster, wo helle Flocken in rasend schnellem Tempo an den Scheiben vorbeizogen und sich am unteren Rand des Fensters in einer dicken Schicht sammelten. Er konnte immer noch nicht fassen, dass er gerade mit der Südbahn, die vor dem Krieg noch Franz-Josefs-Bahn geheißen hatte, in Richtung Semmering unterwegs war, um dort in einem Luxushotel an einem Tangotanzkurs teilzunehmen. Er, der zwei linke Füße hatte, wenn es ums Tanzen ging, einen Walzer von einer Polka nicht unterscheiden konnte und sich sein ganzes Leben lang vor dem Tanzen gedrückt hatte.
Schuld an seinem Entschluss war Ernestine. Sie war die außergewöhnlichste Frau, der Anton in den letzten dreißig Jahren begegnet war. So lange war es nun schon her, dass seine Frau bei der Geburt ihrer einzigen Tochter gestorben war. Ernestines Talent, Menschen zu begeistern, und der plumpen Überrumpelung seiner Tochter und seiner Enkeltochter hatte er es zu verdanken, dass er nun zwei Tage lang seinen alten, steifen Körper zu argentinischen Rhythmen bewegen musste. Noch vor einer Woche hätte er jeden ausgelacht, der ihm davon erzählt hätte. Immer noch war ihm nicht ganz klar, wie es den drei Frauen gelungen war, ihn zu dieser unseligen Unternehmung zu überreden. Anton lehnte sich zurück, verschränkte die Arme vor der Brust, schloss die Augen und ließ den Nachmittag in seiner Apotheke noch einmal Revue passieren.
Es war einer jener eiskalten grauen Januartage gewesen, die man am liebsten mit einem guten Buch und einer Tasse Tee hinter dem Ofen verbrachte. Aber statt einen ruhigen Nachmittag zu genießen, hatte Anton in seiner Apotheke gestanden, die er seit vielen Jahren gemeinsam mit seiner Tochter Heide führte. Heide war im vorletzten Kriegsjahr schwanger und in den letzten Kriegstagen Witwe geworden. Nun war sie, wie viele andere junge Frauen, eine Mutter, die ihr Kind ohne Vater großziehen musste. An diesem Nachmittag war sie mit Rosa, Antons geliebter Enkeltochter, beim Friseur gewesen. Anton hatte allein im Verkaufsraum gearbeitet. Er hatte Unmengen von Lutschtabletten und Hustensaft verkauft, was in dieser Jahreszeit ganz normal war. Dabei hatte er nicht bemerkt, dass es draußen bereits dunkel geworden war. Als er auf seine alte Wanduhr schaute, stellte er überrascht fest, dass es kurz vor sechs war und er bald Feierabend machen konnte. Aber dann öffnete sich noch einmal die Eingangstür. Wie immer läutete die helle Glocke, und Ernestine Kirsch, seine Untermieterin, trat mit rosigen Wangen und Begeisterung in den Augen ein. Ungefragt nahm Anton die Dose mit den Pfefferminzbonbons vom Regal, öffnete sie, leerte die weißen Bonbons auf seine präzise Apothekerwaage und füllte zehn Dekagramm in eines der gestreiften Papiersäckchen, die er seit Kriegsende von einem befreundeten Papierwarenhersteller bezog. Seit fünfzehn Jahren wohnte Ernestine in der kleinen Mansardenwohnung über seiner Apotheke, und genauso lang kaufte sie bei ihm Pfefferminzbonbons. Bis auf die Zeit ihrer Lungenkrankheit konnte Anton sich nicht daran erinnern, dass sie jemals etwas anderes gekauft hätte.
Ernestine zog ihre braunen Lederhandschuhe aus, nahm ihren kleinen gefütterten Hut ab und legte beides auf die hölzerne Theke vor sich. Ihre gelockte Kurzhaarfrisur stand ihr wirr vom Kopf ab, aber so etwas kümmerte die pensionierte Lehrerin nicht.
»Sie können sich nicht vorstellen, was mir gerade passiert ist«, sagte sie aufgeregt. Ihre hellblauen Augen strahlten ihn an, und wie immer, wenn sie das taten, fühlte Anton, wie sein Herz eine Spur schneller schlug. So als hätte es vergessen, dass es mit seinen sechzig Jahren zu alt für romantische Schwärmereien war.
»Sie wissen doch, dass ich die Kinder des Süßwarenherstellers Rosenstein unterrichte«, sagte Ernestine.
Natürlich wusste Anton davon. Die winzige Pension, die Ernestine vom Staat bekam, reichte kaum für die Miete, die sie ihm jeden Monat bezahlte, auch wenn er bloß eine lächerlich kleine Summe verlangte. Deshalb verdiente sie Geld mit Nachhilfestunden.
Bevor Anton die Dose mit den Bonbons wieder verschloss, hielt er sie Ernestine entgegen. Sie griff dankend hinein, steckte ein weißes Bonbon in den Mund und redete etwas undeutlicher weiter.
»Das Ehepaar hat eine Einladung zu einem Tangotanzkurs erhalten, der unter dem Motto ›Wir tanzen für die gute Sache‹ steht. Ein Teil der Einnahmen soll einer Wohltätigkeitseinrichtung zugutekommen, die Kriegswaisen unterstützt.«
Anton hatte davon gehört. Die Bankierswitwe Rosalia Schwarz hatte die Veranstaltung organisiert. Sie war bekannt für ihr soziales Engagement, das sie jedoch immer mit eigenen Interessen und guter Unterhaltung kombinierte.
»Frau Rosenstein hat sich gestern den Knöchel gebrochen und liegt jetzt mit einem dicken Verband im Bett.«
»Die Arme«, sagte Anton mitfühlend. Er selbst hatte sich als Kind das Schienbein gebrochen und wochenlang furchtbare Schmerzen gelitten.
»Ja, das ist traurig.« Ernestine nickte. Aber ihre empathischen Worte passten so ganz und gar nicht zu ihrem glücklichen Gesichtsausdruck. Sie hatte noch mehr zu erzählen. »Damit die Karten nicht verfallen, hat Frau Rosenstein sie mir geschenkt.«
Vertraulich beugte sie sich über die Theke. Ihr Atem roch nach Pfefferminz. »Herr Rosenstein ist über die Entwicklung nicht unglücklich. Er wollte nicht an dem Tanzkurs teilnehmen und wirkte richtig erleichtert, als er mir die Karten überreichte.«
Falls Ernestine Unverständnis und Betroffenheit erwartete, musste Anton sie enttäuschen. Er konnte den Mann sehr gut verstehen. Wer wollte schon freiwillig ein ganzes Wochenende tanzen? Doch er bemühte sich, seine Gefühle zu verbergen, und schwieg.
»Zwei der berühmtesten Tanzlehrer aus Argentinien reisen an. Ist das nicht wunderbar?«
»Hm.«
Offenbar entging Ernestine die steile Falte auf seiner Stirn, denn sie fuhr unbeirrt fort: »Jetzt habe ich diese wertvollen Karten für ein luxuriöses Wochenende im feinsten Hotel in den Bergen und brauche einen Tanzpartner.«
»Ich bin sicher, Sie werden jemanden finden«, sagte Anton voller Zuversicht. Er sah sich selbst nicht als potenziellen Tanzpartner. Nie im Leben hätte er gedacht, dass sie ihn meinen könnte.
Aber genau in dem Moment betraten Heide und Rosa den Verkaufsraum. Wieder ertönte die Glocke. Die beiden hatten die letzten Sätze mitgehört.
»Papa, das ist doch eine wunderbare Gelegenheit für einen Urlaub im Schnee«, sagte Heide. Sie schüttelte den gefrorenen Regen von ihrem Mantel und nahm den Hut ab. In den letzten zwei Jahren hatte sie einen Teil ihrer Traurigkeit abgelegt und ihre alte Lebensfreude wiedergefunden. Sie war eine sehr attraktive Frau mit dem dichtesten blonden Haar, das Anton je gesehen hatte.
Rosa und sie glichen sich wie ein Ei dem anderen. Auch Rosa hatte eine wilde blonde Mähne, die selbst die allerkräftigsten Haarspangen nicht bändigen konnten. Mit jedem Tag, den Rosa älter wurde, wuchsen ihre Neugier und ihre Energie. Beides hatte eine ansteckende Wirkung auf alle, die sich in ihrer Nähe aufhielten.
»Opa, lernst du dort tanzen?«, fragte die Fünfjährige, umarmte Anton und versuchte ihn dazu zu bewegen, sich mit ihr zu drehen.
»Nun ja. Ich weiß nicht…«
»Wir haben hier alles im Griff. Du brauchst dir keine Gedanken um die Apotheke zu machen und kannst einfach nur ausspannen«, erklärte Heide.
Anton runzelte die Stirn. Hatte er eben etwas überhört? Soweit er sich erinnern konnte, hatte Ernestine ihn nicht gefragt, ob er sie begleiten wollte. Außerdem passten die Worte »tanzen« und »ausspannen« nicht zusammen. Sie schlossen einander aus.
Nun schlüpfte Heide aus ihrem Mantel. »Das Panhans ist berühmt für gutes Essen. Angeblich kocht dort einer der berühmtesten Köche Europas. Er hat jahrelang in Paris gelebt und versteht sich auf die Haute Cuisine. Der Tanzkurs findet doch im Panhans statt? Habe ich recht, Fräulein Kirsch?«
Sie nahm auch ihrer Tochter den Mantel ab und trug nun beide Kleidungsstücke zur Garderobe im hinteren Teil der Apotheke. Als sie zurückkehrte, blinzelte sie Ernestine verschwörerisch zu. Wieder hatte Anton das Gefühl, etwas verpasst zu haben.
»Ja, das stimmt«, sagte Ernestine rasch. »Der Koch im Hotel Panhans am Semmering soll wahre Wunder in der Küche vollbringen. Jeden Abend bereitet er ein fünfgängiges Menü zu und kredenzt die erlesensten Weine.«
Es war kein Geheimnis, dass Anton ein leidenschaftlicher Koch und Genießer war. Anzusehen war es ihm nicht. Er war sein ganzes Leben lang groß und hager gewesen. Seit über dreißig Jahren passten ihm dieselben Hosen und Hemden. Zum Leidwesen seiner Tochter, die ihn gern in moderneren Kleidungsstücken gesehen hätte.
»Fräulein Kirsch«, begann er etwas unbehaglich. »Sie suchen einen Tanzpartner, und ich muss Ihnen gestehen, ich kann nicht tanzen.«
»Niemand dort kann Tango tanzen«, beruhigte ihn Ernestine. »Es ist ein Anfängerkurs. Alle nehmen daran teil, um den Tanz kennenzulernen.«
»Opa, tanzt du dann auch mit mir?«
Anton sah seine Enkeltochter an. Die hüpfte aufgeregt auf und ab und fand die Vorstellung eines tanzenden Großvaters ganz wundervoll. Offenbar fegte sie in ihrer Phantasie mit ihm bereits zu exotischen Klängen übers Tanzparkett.
»Fräulein Kirsch, nehmen Sie meinen Opa mit auf den Semmering?«
Eine Stimme in Antons Kopf schrie laut und alarmiert: Nein! Doch eine andere sagte mindestens genauso laut und hartnäckig: Das ist die Gelegenheit. Wann wirst du jemals wieder von einer Frau wie Ernestine Kirsch zu einem gemeinsamen Wochenende eingeladen? Aber hatte sie ihn überhaupt gefragt?
»Natürlich nehme ich deinen Opa mit!«, sagte Ernestine bestimmt.
Damit war die Sache wohl ausgemacht.
Sie beugte sich noch weiter über die Theke und ergriff voller Begeisterung seine Hand.
Wieder schlug Antons Herz einen ungewohnten, aber nicht unangenehmen Rhythmus, und mit einem Mal fand er die Aussicht, ein Wochenende lang Tango zu tanzen, gar nicht mehr so schrecklich.
»Wie schön, Papa, das Wochenende wird dir gefallen«, sagte Heide. »Wir helfen dir beim Packen. Du brauchst einen guten Anzug und ein Paar ordentliche Tanzschuhe.«
»Ich habe einen guten Anzug.«
Heide verdrehte die Augen und versicherte Ernestine: »Keine Sorge, Fräulein Kirsch. Rosa und ich werden das Packen übernehmen.«
»Ich kann gut allein packen«, wehrte sich Anton.
Aber da hatten die drei Frauen schon beschlossen, dass Heide in den nächsten Tagen einen Termin beim Schneidermeister Fritsch ausmachte.
»Du brauchst zwei neue Hemden.«
Anton schüttelte empört den Kopf, jedoch ohne Erfolg.
Zwei Tage später war er gemeinsam mit Heide, Rosa und Ernestine im Ankleideraum von Meister Fritsch gestanden und hatte nicht nur zwei Hemden, sondern auch einen sündhaft teuren Anzug bestellt.
Dieser Besuch lag nun zwei Wochen zurück, und die Kleidungsstücke befanden sich ordentlich zusammengefaltet in seinem Koffer, der in der Gepäckablage über ihnen lag.
Das Rattern eines Geschirrwagens holte ihn aus seinem Halbschlaf und seinen Erinnerungen zurück in den Waggon. Etwas benommen rappelte er sich auf. Ein rundlicher Mann schob einen niedrigen Wagen vor sich her. Darauf befanden sich mehrere silberne Kannen und Becher aus teurem Porzellan.
»Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«, fragte er höflich. Dabei verrutschte die steife Mütze seiner weinroten Bahnuniform, die noch aus der Zeit vor dem Krieg stammte. Man hatte bloß das kleine Wappen an der Stirnseite der Mütze ausgetauscht: Statt des Doppeladlers der Monarchie zierte jetzt der einköpfige Greifvogel der Republik den Beamten der Südbahn.
Anton nahm den Geruch von Kaffee wahr.
»Eine Tasse heiße Schokolade mit einer Prise Zimt und reichlich Zucker für mich«, bestellte Ernestine.
»Für mich auch, bitte«, sagte Anton.
Kurz darauf hielt Anton eine dampfende Tasse mit der cremigsten Trinkschokolade in der Hand, die er je probiert hatte. Reisen im Waggon der ersten Klasse war purer Luxus.
»Habe ich Ihnen je von meiner Verletzung am linken Knie erzählt?«, fragte Anton vorsichtig. »Seit gestern spüre ich sie wieder. Es muss mit dem Wetterumschwung zu tun haben.« Um seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen, griff er an sein Knie.
»Nein, das haben Sie nicht, und ich hoffe sehr, dass die Verletzung Sie beim Tanzen nicht behindern wird«, sagte Ernestine mit dem Ton einer Lehrerin, die sofort erkannte, wenn ein Schüler sich vor etwas drücken wollte. Ihre rechte Augenbraue rutschte amüsiert nach oben, sie verkniff sich ein Lächeln.
»Ja, das hoffe ich auch«, murmelte Anton verlegen. Ernestine hatte ihn durchschaut. Zwar stimmte es, dass er eine alte Knieverletzung hatte, aber sie beeinträchtigte ihn nur, wenn er auf allen vieren krabbelte. Er musste sich etwas Besseres einfallen lassen. Leider blieb ihm nicht mehr viel Zeit.
Seufzend holte er die alte, verbeulte Taschenuhr seines Vaters aus der Brusttasche und klappte sie auf. »Wenn der Zug pünktlich ist, erreichen wir in wenigen Minuten Gloggnitz.« Noch während die Uhr wieder zuschnappte, verlangsamte die Lokomotive ihr Tempo und blieb wenig später stehen.
Kaum, dass das monotone Rattern der Räder über den Gleisen verstummte, hielt Ernestine ihr Gesicht wieder dicht an die Scheiben. »Wo ist der Bahnhof?«
»Ich denke, das ist der Bahnhof.« Anton zeigte auf ein winziges Häuschen, das im wilden Schneetreiben nur schwer auszumachen war. Aus kleinen Fenstern drang Licht, und über einer Tür hing eine Gaslaterne, die im Wind hin und her schaukelte. Vom Zug lief ein untersetzter Bahnbeamter zu dem Häuschen, ergriff die Laterne und öffnete die Tür. Drei vermummte Gestalten traten heraus.
»Ob das auch Gäste sind, die zum Panhans wollen?«, fragte Ernestine neugierig.
Anton hob die Schultern, was Ernestine aber nicht sehen konnte, da sie sich den Hals verrenkte und beobachtete, wie die drei Passagiere zum Zug liefen und rasch in einen der Waggons kletterten. Ein schweres, metallenes Geräusch verriet, dass die Tür hinter ihnen wieder zugeworfen wurde. Wenig später erklang ein schrilles Pfeifen, und schon setzte der Zug sich wieder schnaufend und ratternd in Bewegung. Trotz geschlossener Fenster drang der Geruch nach Kohle ins Abteil. Bevor Ernestine eine weitere Frage über die neuen Fahrgäste stellen konnte, öffnete sich die Tür zu ihrem Abteil, und die drei Passagiere, die eben noch zum Zug gelaufen waren, standen nun vor ihnen.
»Gestatten, dass wir uns zu Ihnen setzen, aber dies sind die letzten Plätze im Waggon der ersten Klasse. Es scheint, als wäre halb Wien auf dem Weg zum Semmering.« Der Mann klopfte sich ein paar Schneeflocken von seinem teuren, schweren Pelzmantel und schlüpfte umständlich heraus. Er hängte ihn auf, bevor er auch den beiden Damen aus ihren Pelzmänteln half.
Zu spät bemerkte Anton, dass sein Verhalten unhöflich war, denn statt aufzustehen und behilflich zu sein, war er sitzen geblieben und hatte auf den mächtigen Schnurrbart des Mitreisenden gestarrt. Er war goldbraun und an den Enden zu kleinen runden Schnecken zusammengerollt. Wie lange der Mann wohl vor dem Spiegel gestanden hatte, um dieses kleine Kunstwerk zu erschaffen?
So als hätte Ernestine Antons Gedanken gelesen, stieß sie ihn sanft mit der Spitze ihres Fußes an und schüttelte leicht den Kopf. Ihre Lippen zuckten kaum merkbar, und sie wirkte amüsiert, gleichzeitig aber auch mahnend.
Wieder sah Anton die Lehrerin in ihr. Sicher korrigierte sie ihre Schüler auf die gleiche Weise.
Bei den Frauen handelte es sich ganz offensichtlich um Mutter und Tochter, denn die beiden glichen einander auf verblüffende Weise. Sie hatten dieselbe klassische Nase, hohe Wangenknochen und ungewöhnlich große dunkelbraune Augen mit langen Wimpern. Doch während die junge Frau offen und freundlich grüßte, wirkte ihre Mutter verschlossen. Vielleicht war sie auch bloß schüchtern. Beide Frauen hatten moderne, wadenlange Kleider an, deren Röcke kurz unter der Brust ansetzten und fließend den Körper umspielten. Während die Mutter eine goldene Kette mit einer aufklappbaren Uhr um den Hals trug, schmückte die Tochter eine lange Perlenkette, die auf Höhe ihrer Brust nach letzter Mode geknotet war.
»Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Fritz Zuckerberg, und das hier sind meine Frau Helene und meine Tochter Clara.«
Clara Zuckerberg lächelte gewinnend, während ihre Mutter bloß nickte und dann unbeteiligt zur Seite schaute.
Zuckerberg ließ sich neben Ernestine in den gepolsterten Sitz fallen.
»Sehr erfreut«, sagte Anton und stellte sich selbst und Ernestine vor.
»Fahren Sie auch auf den Semmering, oder geht es weiter in den Süden nach Triest? Dort ist es jetzt sicher freundlicher. Am Meer ist das Klima immer wärmer«, sagte Zuckerberg. Er faltete selbstgefällig seine Hände vor seinem mächtigen Bauch. Auf seinem Zeigefinger prangte ein dicker Goldring mit einem auffällig großen roten Edelstein. Vielleicht ein Rubin. Offenbar hatte der Mann Gefallen daran, seinen Reichtum zur Schau zu stellen.
»Wir fahren ins Panhans«, informierte ihn Ernestine. Sie rückte näher zum Fenster, um neben dem mächtigen Mann halbwegs bequem sitzen zu können. Seine Frau und seine Tochter hatten neben Anton Platz genommen.
»So ein Zufall«, sagte Clara Zuckerberg erfreut. »Wir fahren auch dorthin. Nehmen Sie ebenfalls an dem Tangotanzkurs teil?«
»Ja, das tun wir. Sie etwa auch?«
»Ja.«
»Ich habe Ihre Namen nicht auf der Teilnehmerliste gesehen«, meinte Zuckerberg, und Ernestine erzählte ihm rasch, wie sie zu den Karten gekommen war.
»Ach so, Sie sind die Lehrerin der drei Rosenstein-Kinder.« Er musterte sie vom Scheitel bis zur Sohle und schien rasch zu dem Schluss zu kommen, dass er sich trotz ihres niedrigen gesellschaftlichen Rangs mit ihr abgeben würde.
Ernestine war eine jener Lehrerinnen, die über eine natürliche Autorität verfügten. Man konnte sie nicht ignorieren oder abfällig behandeln. Anton begann die Unterhaltung zu interessieren. Zuckerbergs Frau schien weder an ihren Mitreisenden noch an dem Gespräch Gefallen zu finden. Sie knetete ihre schmalen Hände und starrte aus dem Fenster. Ihr Gesicht wirkte völlig emotionslos.
»Was machen Sie beruflich?« Zuckerberg richtete seine Frage an Anton.
»Ich bin Apotheker und Sie?«
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich Fritz Zuckerberg bin«, erklärte er, so als müsste sein Name als Antwort reichen.
»Papa, nicht alle Menschen kennen sich im Farbgeschäft aus«, tadelte ihn seine Tochter.
»Ach so. Natürlich. Ich besitze die Farben- und Lackfabrik Zucker und Zuckerberg.«
Nun war Antons Interesse vollauf geweckt. Sein Wohnzimmer benötigte dringend einen neuen Anstrich, aber während des Krieges waren Farben knapp gewesen, und seither hatte er nicht die Zeit gefunden, das richtige Material zu kaufen. Immer wieder gab es andere Dinge, die dringlicher waren.
»Meine Tochter liegt mir seit Jahren in den Ohren, dass wir unser Wohnzimmer neu ausmalen lassen, aber während des Krieges wurde die Produktion von Farbe eingestellt.«
»Wir haben auch während des Krieges produziert«, sagte Zuckerberg stolz.
Für einen Moment drehte seine Frau ihren Kopf zu ihm, aber bevor Anton erkennen konnte, ob es Abscheu war, die in ihrem Blick lag, wandte sie sich wieder dem Fenster zu und beobachtete weiter die vorbeiziehenden Schneeflocken.
»In den letzten Kriegsjahren haben wir unsere Produktion sogar aufs Doppelte steigern können. Jetzt sind wir erfolgreicher denn je und exportieren bis nach Amerika.« Er plusterte die ohnehin breite Brust noch weiter auf.
Sein Verhalten erinnerte Anton an einen Hahn. Er bereute seine Bemerkung rasch, denn die nächste halbe Stunde verbrachte Zuckerberg damit, über die Vor- und Nachteile verschiedener Farben zu referieren. Anton unterdrückte ein Gähnen und hörte ihm nach einigen Sätzen nur noch mit einem Ohr zu, mit dem anderen war er bei Ernestine, die ein Gespräch mit Zuckerbergs Tochter begonnen hatte.
»Was halten Sie als Lehrerin von Otto Glöckels Schulreformen?«, fragte Clara Zuckerberg interessiert.
Anton wusste, dass sie mit ihrer Frage offene Türen bei Ernestine einlief. Als Lehrerin und überzeugte Sozialistin war sie eine glühende Befürworterin des Reformprogramms, das ein Ergebnis der neuen Stadtregierung Wiens war.
»Ich bin davon begeistert und würde mir wünschen, dass die Reformen noch tiefer greifen könnten. Aber bereits jetzt ist viel Gutes passiert. Endlich werden auch Kinder aus Arbeiterfamilien in Schulen gefördert und bekommen die Möglichkeit einer fundierten Bildung. In wenigen Jahren wird es ganz natürlich sein, dass Arbeiterkinder neben denen von Akademikern studieren. Außerdem werden die Lehrer gezwungen, umzudenken. Lernen muss Spaß machen, und die Kinder sollen vor dem Lehrer Respekt, aber keine Angst haben.« Ernestines Augen glänzten, ihre Wangen waren vor Aufregung rosig.
Anton liebte diesen Anblick. Am liebsten hätte er sie einfach nur beobachtet und ihr kommentarlos zugehört. Aber er musste sich auf sein Gegenüber konzentrieren und dem Vortrag über Farben folgen.
Zuckerberg holte gerade zu den neuesten Entwicklungen in der Lackherstellung aus, als auch er Gesprächsfetzen zwischen seiner Tochter und Ernestine aufschnappte. Er hielt mitten im Satz inne und drehte sich abrupt zu Clara Zuckerberg. »Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass ich es nicht gutheiße, wenn du dich über die unsinnigen, gesellschaftsgefährdenden Ideen der Sozialisten äußerst oder gar mit ihnen sympathisierst? Wir sind Unternehmer, und als solche sind die Sozialisten unsere Feinde.«
»Papa, der Krieg ist vorbei. Wir haben keine Feinde mehr.«
»Pah, natürlich haben wir Feinde. Sie sitzen im eigenen Land und versuchen uns zu ruinieren. Arbeiterkampf, das ist es, was uns gefährdet. Dabei sollten die Sozialisten sich darum kümmern, dass ihre Arbeiter sich nicht vor ihren Aufgaben drücken. Statt andauernd zu jammern, sollen die Männer Leistung bringen. Ohne uns Unternehmer würden sie in ihrem eigenen Dreck verhungern und ihre riesigen Kinderscharen dazu.«
Anton sah, wie sich Ernestines rundes, rosiges Gesicht verfinsterte. Schon setzte sie zu einer Antwort an, aber Clara Zuckerberg kam ihr zuvor. »Papa, ich will mich nicht mit dir streiten«, sagte sie versöhnlich. »Außerdem hat der Doktor gesagt, du sollst dich nicht aufregen. Das ist schlecht für deinen Blutdruck.«
»Wie soll ich mich nicht aufregen, wenn meine eigene Tochter zum Feind überläuft?« Zuckerbergs Gesicht hatte einen gefährlich dunkelroten Farbton angenommen. Die Enden seines Schnurrbartes vibrierten.
Sicher hatte Ernestine schon passende Worte auf den Lippen, aber diesmal stieß Anton sie sachte mit der Fußspitze an und warf ihr einen warnenden Blick zu. Zu seiner großen Überraschung beherzigte sie ihn und schwieg.
Nun mischte sich Frau Zuckerberg in das Gespräch ein. Müde griff sie sich an die Stirn und massierte ihre Schläfen. »Ich will nicht, dass ihr streitet. Ich bekomme davon Kopfschmerzen«, sagte sie mit leidender Stimme.
Zuckerberg presste die Lippen zusammen und schwieg für eine Weile. Etwas leiser sagte er schließlich: »Seit du zu diesem merkwürdigen Scharlatan von einem Doktor gehst, bekommst du ständig Migräne.«
»Papa, Dr.Kurz ist ein Nervenarzt und kein Scharlatan. Sigmund Freud und seine Kollegen haben längst bewiesen, dass es das Unterbewusstsein gibt. Akzeptiere das endlich. Seit Mama zu Dr.Kurz geht, hat sie viel seltener Kopfschmerzen, und sie braucht deutlich weniger von den starken Tabletten. Die Therapie tut ihr gut.«
»Leider nimmt sie immer noch viel zu viel von dem Zeug. Wenn du mich fragst, sind diese Psychoanalytiker lauter Gauner, die mir mein sauer verdientes Geld aus der Tasche ziehen und meiner Frau nicht helfen können.«
Frau Zuckerberg saß unbeteiligt neben ihrer Tochter, so als ginge sie das Gespräch nichts an. Dagegen schauten Anton und Ernestine betroffen zum Fenster hinaus. Auch wenn sie dort nichts sehen konnten außer Dunkelheit und Schneeflocken, die gegen die Scheibe geschleudert wurden.
In diesem Augenblick steckte der Schaffner, ein hochgewachsener Mann mit derselben weinroten Bahnuniform wie der Kellner zuvor, seinen Kopf ins Abteil.
»In wenigen Minuten erreichen wir den Semmering. Wenn sich die Herrschaften bitte auf das Verlassen des Zuges vorbereiten wollen.«
Anton war froh über die Unterbrechung des Gesprächs. Er wollte nicht die intimen Geheimnisse einer ihm fremden Familie erfahren. Als der Zug langsamer wurde, bemerkte er bestürzt, dass der Schneefall zugenommen hatte. Sicher war es eiskalt draußen. Hier im Abteil sorgte eine Heizung für angenehme Wärme, vielleicht wäre es klüger, doch bis nach Triest zu fahren. Sie könnten sich in einem der wundervollen Hotels auf dem Hauptplatz, der Piazza Grande, einmieten, mit direkter Sicht auf den Hafen und das Meer, und mit einer Kutsche einen Ausflug zum Schloss Miramare machen, das einst für den Bruder des Kaisers Maximilian errichtet worden war. Auch wenn die Stadt nun nicht mehr zu Österreich gehörte, so sprachen immer noch viele Menschen Deutsch, und es war ein Leichtes, sich dort zurechtzufinden.
Aber schon war Ernestine aufgestanden und wickelte ihren roten Wollschal um ihren Hals. »Ich bin ja so aufgeregt«, flüsterte sie Anton zu. »Ich war noch nie in einem so vornehmen Hotel wie dem Panhans. Wie es dort wohl aussieht?«
»Wir werden es gleich herausfinden«, sagte Anton. Seine Träume vom Meer zerplatzen wie eine Seifenblase. Nur mühsam schaffte er es, ein bisschen Begeisterung in seine Stimme zu legen. Dann half er Ernestine in ihren dunklen Wollmantel und zog seinen eigenen über. Aus der Gepäckablage holte er seinen und Ernestines Koffer. Die Familie Zuckerberg bereitete sich ebenfalls aufs Aussteigen vor.
»Man sieht sich später«, sagte Zuckerberg und verließ mit schnellen Schritten das Abteil. Seine Frau und seine Tochter folgten ihm.
Mit lautem Quietschen rollte der Zug in die Station ein. Ein kleines Gebäude aus Stein stand seitlich vom Bahnsteig. Daneben befand sich ein Monument mit der Büste des verstorbenen Kaisers, darunter prangte das Wappen der Monarchie. Eine Gaslaterne flackerte im Wind und warf diffuses Licht darauf. Offenbar hatte hier, nur eineinhalb Stunden von Wien entfernt, der Krieg nichts verändert. Die Station sah immer noch so aus wie 1854, als sie feierlich für den Personenverkehr eröffnet worden war.
Als der Schaffner die Waggontür öffnete, wehte Anton ein unfreundlicher Windstoß eiskalte Schneeflocken ins Gesicht, die trotz ihrer weichen Beschaffenheit die Haut durchbohrten wie winzig kleine Messer. Er fröstelte.
Ernestine betrat das Bahngleis und versank knöcheltief im frischen Schnee. Sie lachte.
Anton war ganz und gar nicht nach Lachen zumute. Am liebsten wäre er auf der Stelle zurück ins Abteil geklettert und hätte einen weiteren Becher cremiger Trinkschokolade mit Zimt bestellt.
Der Schaffner half ihnen, die Gepäckstücke aus dem Zug zu heben. Erst als alle Passagiere und Koffer im Schnee standen, ertönte seine schrille Pfeife erneut. Die Türen wurden mit lautem Krachen geschlossen, und der Zug setzte sich langsam ratternd in Bewegung. Wehmütig sah Anton der dampfenden Lokomotive nach. Der Geruch brennender Kohle lag auch dann noch in der Luft, als der Zug längst hinter den Bergen verschwunden war.
Unterdessen hatten die anderen Gäste die Zeit genutzt und waren zu den wartenden Pferdeschlitten gelaufen.
Anton konnte sehen, wie Zuckerberg seiner Frau die Hand reichte und ihr in einen der überdachten Schlitten half, in dem bereits zwei Gäste saßen. Seine Tochter folgte ihr, und zuletzt kletterte er selbst hinterher. Nun war der Schlitten voll. Der Kutscher rief seinen Pferden etwas zu. Gleichzeitig setzten sich die Tiere in Bewegung. Anton konnte die Glocken hören, die auf ihrem Geschirr befestigt waren. Der helle Klang drang nur leise zu ihnen, denn der Wind übertönte alle anderen Geräusche. Eine weitere Böe trieb ihm eine Handvoll Eiskristalle ins Gesicht, die sich erneut in die ungeschützte Haut seiner Wangen bohrten.
»Wir sollten uns auch nach einem Schlitten umsehen«, sagte er und zog seinen Schal enger um Hals und Kinn. Ernestine pflichtete ihm bei. Im Nu kam ein junger Bursche auf sie zugelaufen. Er hatte eine dicke Fellmütze auf dem Kopf und bunte Wollfäustlinge an den Händen.
»Wolln Sie ins Panhans oder ins Südbahnhotel?«, schrie er laut. Seine Stimme überschlug sich, er war mitten im Stimmbruch.
»Ins Panhans«, antwortete Ernestine freundlich.
»Dann kommen S’ mit.« Der Junge schnappte sowohl Ernestines als auch Antons Koffer und trug beide mit einer Leichtigkeit, als handelte es sich um zwei Daunendecken, zu einem der Schlitten, der fürs Gepäck bestimmt war. Eine Unzahl von Koffern und Taschen lag bereits darauf.
»Sie können hier warten, bis der überdachte Schlitten wieder zurückkommt. Oder gleich mit mir fahren.« Er wies auf die schmale Bank im hinteren Teil des Schlittens.
»Wie lange dauert es denn, bis der Schlitten wiederkommt?«, wollte Anton wissen.
»Vielleicht a halbe Stund, vielleicht länger. Kommt drauf an, ob da Ferdinand a Pauserl macht.«
Anton nahm an, dass Ferdinand der Kutscher des überdachten Schlittens war.
»In dem Fall fahren wir lieber mit dir«, sagte Ernestine, ohne Antons Antwort abzuwarten.
»Unter der Bank liegn a paar Decken«, sagte der Junge. Er verstaute die beiden Koffer auf dem Schlitten und kletterte auf den Kutschbock.
Anton reichte Ernestine die Hand, doch die hatte bereits die Röcke gerafft und stieg beherzt auf ein schmales Brett, eine Art Aufstiegshilfe am Schlitten.
»Könnten Sie mir einen kleinen Schubs geben?«
»Wie bitte?«
»Geben Sie mir bitte einen Schubs auf mein Hinterteil, damit ich da hinaufkomme.« Mit einer Selbstverständlichkeit zeigte sie auf den Schlitten.
Trotz der Kälte wurde Anton heiß. Es war viele Jahre her, dass er dazu aufgefordert worden war, das Hinterteil einer Frau zu berühren. Verlegen stand er neben ihr, ohne sich zu bewegen.
»Nun stellen Sie sich nicht so an«, sagte Ernestine ungeduldig. »Es ist kalt.«
Unsicher fasste Anton an ihren Hintern und schob sie in den Schlitten.
»Na bitte, es geht doch«, sagte sie zufrieden. »Noch vor ein paar Jahren wäre ich gelenkig wie ein kleines Reh in den Schlitten gesprungen.«
Anton verehrte Ernestine, aber er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass die kleine rundliche Frau jemals Ähnlichkeit mit einem Reh gehabt hatte. Er nahm auf der Bank neben ihr Platz. Das Holz war eiskalt. Hoffentlich holte sie sich keine Blasenentzündung. Als Apotheker wusste er, wie unangenehm und hartnäckig solche Entzündungen für Frauen sein konnten.
Gerade als der Schlitten sich in Bewegung setzte, rief eine Männerstimme vom Bahnhof aus: »Halt, warte!«
Der Junge hielt die Pferde zurück und drehte sich um.
»Wir müssen ins Panhans. Fährst du dorthin?«
»Ja, gnä’ Herr. Steigs auf. Es geht glei los.«
Hinter dem breiten Rücken des eingemummten Mannes tauchte noch eine Frau auf. »Hast du noch Platz für zwei?«
»Wenn d’ Herrschaften zsammenrücken!« Der Junge warf einen fragenden Blick nach hinten.
»Selbstverständlich«, sagte Ernestine und rückte näher zu Anton.
Der Mann mit dem Schal vor dem Mund und dem gefütterten Hut auf dem Kopf kletterte auf den Schlitten. Die Frau, die genauso dick eingepackt war wie er, folgte ihm. Dicht an dicht saßen alle vier nun aneinander. Man begrüßte sich, aber für eine Unterhaltung war es definitiv zu kalt.
Unterdessen breitete Anton die schwere, nach Pferde und Stall riechende Decke über ihnen allen aus. Der Stoff hielt die Kälte ein wenig ab. Dann wickelte er seinen Schal dicht ums Gesicht, sodass nur noch die Augen sichtbar waren. Anton schloss sie bis auf einen kleinen Schlitz, kauerte sich so gut es ging unter die Decke und hoffte inständig, dass er die Fahrt zum Hotel überleben würde.
Zum Glück war der Weg kurz und führte durch einen tief verschneiten Wald. Die Glocken am Geschirr der Pferde klingelten, der Schlitten glitt über den Schnee. Die dicht stehenden Bäume hielten den Sturm ein wenig ab. Dennoch rauschte der Wind durch die hohen Nadelbäume. Es war eisig kalt. Erst ein Mal hatte Anton derart gefroren. Weihnachten 1915. Damals hatte er gemeinsam mit einem Sanitäter und einem Priester Gräben an der Westfront nach verwundeten Soldaten abgesucht und sich gefragt, wie Gott es hatte zulassen können, dass machtgierige Männer diesen sinnlosen Krieg angezettelt hatten, in dem junge Soldaten sich gegenseitig abschlachteten. Der Priester hatte keine Antwort gehabt. Seither besuchte Anton keine Sonntagsmesse mehr. Er schüttelte den Kopf, um die unangenehmen Erinnerungen wieder loszuwerden, dabei fielen die Schneeflocken, die sich bereits auf seiner Mütze abgelegt hatten, auf Ernestines Schulter.
»Entschuldigung!«
Ernestine lächelte, zumindest glaubte Anton ein Lächeln in ihren Augen zu erkennen, der Rest ihres Gesichtes war von dem roten Wollschal verdeckt.
Wenig später hielt der Schlitten vor einem prächtigen Gebäude an. Die Säulen der Vorhalle erinnerten mit den gusseisernen Blumengirlanden an die Jugendstilgebäude auf der Ringstraße. Es stürmte nun so heftig, dass Anton seinen Hut festhalten musste.
Kaum stand der Schlitten, lief ein Bursche in der Livree des Hotels aus dem Foyer und verbeugte sich so tief, dass Anton Angst hatte, er würde kopfüber nach vorne purzeln. Der Junge half zuerst dem fremden Paar aus dem Schlitten, dann Ernestine und schließlich ihm. Rasch liefen alle auf die Eingangshalle zu. Eine Sturmböe erfasste Anton, zerrte an seinem Mantel und trieb ihn regelrecht ins Innere des Hotels.
Augenblicklich schlugen ihnen angenehme Wärme und der frische Geruch von Zitronenwasser entgegen. Anton wickelte seinen Schal vom Gesicht und öffnete seinen Mantel. Er stampfte fest auf, um den Schnee von seinen Schuhen und den Schultern zu schütteln. Die Flocken fielen auf den weichen Teppichboden im Eingangsbereich, wo sie geradewegs schmolzen und Wasserflecken zurückließen. Anton atmete erleichtert durch.
Alles in der Halle schien zu glänzen. Der dunkle Marmorboden, die hellen Wände, die frisch geputzten Marmorsäulen und unzählige Spiegel. Das Licht der Gaslampen spiegelte sich in den fein geschliffenen Kristallen, die in Ketten von den Lüstern hingen. Ein schmaler roter Teppich führte vom Eingangsbereich zur Rezeption. Es war ein merkwürdiges Gefühl, über diesen Teppich zu gehen. So mussten sich Kaiser und Prinzen fühlen. Bloß, dass es für die zur Normalität gehörte, während Anton zum ersten Mal über einen roten Teppich lief. Hinter einer Theke aus dunklem, ebenfalls glänzendem Kirschholz erwartete sie ein lächelnder junger Mann. Wie der Gepäckträger hatte auch er die Livree des Hotels an: Einen dunkelgrünen Anzug mit goldenen Knöpfen und einem roten Halstuch. An der Brusttasche des Anzugs heftete ein goldenes Schildchen, auf dem der Name »Herr Sebastian« stand.
»Herzlich willkommen im Panhans«, sagte Herr Sebastian, während er ein dickes, in dunkelgrünes Leder gebundenes Buch aufschlug.
Das Paar, mit dem sie gemeinsam im Schlitten gefahren waren, wartete bereits auf den Zimmerschlüssel. Der Mann lehnte sich lässig gegen die Theke, während die Frau aufrecht danebenstand und nervös mit dem Fuß wippte.
»Mein Name ist Dr.Hubert Schöller. Meine Schwester und ich haben zwei Einzelzimmer gebucht.«
Er richtete sich wieder auf und zog seinen Mantel aus. Etwas umständlich faltete er ihn zusammen und hängte ihn über seinen Unterarm. Er hatte ein angenehmes Äußeres und war etwa fünfzig Jahre alt. Seine Schwester war deutlich jünger. Anton schätzte sie auf Mitte dreißig. Gerade als Anton darüber nachdachte, ob die steile Falte zwischen ihren Augenbrauen auf Traurigkeit oder Strenge schließen ließ, wandte der Doktor sich an Ernestine und reichte ihr freundlich die Hand.
»Es tut mir leid, dass ich mich eben im Schlitten nicht vorgestellt habe, aber es war schlicht zu kalt für eine Unterhaltung.«
Ernestine stimmte ihm zu. »Ja, das war es wirklich. Aber hier ist es wunderbar warm.«
Der Doktor reichte auch Anton die Hand. Er hatte einen festen, resoluten Händedruck.
»Nehmen Sie auch am Tangotanzkurs teil?«, fragte Anton.
»Ja, aber meine Schwester ist von der Idee nicht so begeistert wie ich. Sie tanzt nicht gern. Ich habe sie zu der Veranstaltung überreden müssen. Seit Stunden liegt sie mir mit angeblichen Ausreden in den Ohren.«
Seine Schwester verdrehte die Augen. Ihr dunkles Haar war modern auf Kinnlänge geschnitten. Offenbar war ihr die Geschwätzigkeit ihres Bruders unangenehm. Doch der schien ihre Reaktion nicht zu bemerken und grinste von einem Ohr zum anderen. Dabei legte er eine Reihe perfekter Zähne frei. Seine Haut war eine Spur zu dunkel für diese Jahreszeit. Wie seine Schwester hatte er dunkles Haar, das jedoch von deutlich mehr grauen Strähnen durchzogen war als ihres.
»Nun, ich muss zugeben, dass auch ich kein begeisterter Tänzer bin«, gestand Anton. Einen kurzen Moment hoffte er, der Doktor könnte mit Ernestine tanzen, während er selbst und Fräulein Schöller zusahen, aber dann unterbrach Herr Sebastian ihr Gespräch, und die Gelegenheit, einen Vorschlag in diese Richtung zu machen, war dahin.
Der junge Mann reichte dem Doktor zwei Schlüssel. »Zwischen den Zimmern gibt’s eine Verbindungstür«, sagte er. »Die Zimmer sind im zweiten Stock. Sie können den Aufzug nehmen. Der Kofferträger bringt Ihnen ’s Gepäck auf die Zimmer!«
»Vielen Dank!«
Dann wandte er sich an Anton. »Dearf ich fragn, wer Sie sind?«
»Anton Böck und Ernestine Kirsch. Wir haben auch zwei Einzelzimmer gebucht.«
»Ohne Verbindungstür«, ergänzte Ernestine.
Herr Sebastian suchte in seinem Buch nach ihren Namen. Offenbar konnte er sie nicht finden. Erneut fuhr sein Finger die Listen der aufgeschlagenen Seite entlang.
»Ursprünglich war ein Doppelzimmer für das Ehepaar Rosenstein reserviert«, erklärte Ernestine. »Aber Frau Rosenstein hat sich bedauerlicherweise verletzt und uns ihre Karten überlassen. Ich habe Ihnen gestern ein Telegramm geschickt und darum gebeten, statt des Doppelzimmers zwei Einzelzimmer für uns zu reservieren.«
Auf Dr.Schöllers Gesicht machte sich Neugierde breit, als er den Namen Rosenstein hörte.
»Ach ja…« Herr Sebastian lief rot an. Offenbar gab es Schwierigkeiten. Auf seiner Stirn bildeten sich winzige Schweißtropfen. Seine Haut glänzte. »Oje, i glaub, da is uns a klanes Missgeschick passiert«, sagte er verlegen.
»Und das wäre?« Anton trat näher an die Kirschholztheke. Vor ihm stand eine goldene Druckglocke. Er musste den Impuls unterdrücken, mit der flachen Hand auf das glänzende Gerät zu schlagen. Nicht weil er ungeduldig war, sondern einfach, weil es dazu einlud. Schade, dass Rosa nicht hier war, gemeinsam mit ihr hätte er bestimmt geklingelt. Stattdessen drehte er sich zur Seite. Dr.Schöller und seine Schwester standen immer noch neben ihnen. Warum bezogen sie ihre Zimmer nicht? Aufmerksam verfolgte Dr.Schöller die Unterhaltung.
»Wir ham a Doppelzimmer mit separaten Betten im dritten Stockwerk für Sie vorgsehn.«
»Wir brauchen aber zwei Einzelzimmer«, beharrte Ernestine.
Bedauernd schüttelte Herr Sebastian den Kopf. »Des is leider net mehr möglich.«
»Warum denn nicht?«, fragte Anton neugierig. Er hatte nicht den Eindruck, dass das riesige Hotel voll belegt war. Ganz im Gegenteil, es herrschte eine merkwürdige Stille. Sicher gab es eine Reihe unbesetzter Zimmer.
»Frau Schwarz hat’s ganze Wochenende exklusiv für ihre Gsellschaft gbucht. Außer ihre Gäst san kane weiteren im Hotel. Alle Zimmer der ersten, zweiten und dritten Etage des Westflügels san reserviert und hergrichtet. WürdnS’ jetzt ein Zimmer in der vierten oder fünften Etage oder im Ostflügel beziehen, würd’s Stunden dauern, bis die Temperaturen angenehm warm san. GlaubenS’ mir, des wär net fein.«
Die Vorstellung, zu frieren, fand Anton nach der eisigen Fahrt mit dem Schlitten alles andere als erfreulich. Lieber freundete er sich mit dem Gedanken eines Doppelzimmers an, was ja durchaus Vorteile hatte. Wann hätte er je wieder die Gelegenheit dazu, gemeinsam mit Ernestine in einem Zimmer zu übernachten?
Doch da meldete sich Dr.Schöller zu Wort. »Wir können gern die Zimmer tauschen.«
Seine Schwester, deren Ungeduld mit jedem Augenblick, den ihr Bruder länger stehen blieb, wuchs, nickte genervt. Es schien, als wollte sie nur noch in ein Zimmer, egal, in welches. »Selbstverständlich!«, sagte sie schnell und eine Spur ungehalten.
»Das ist sehr freundlich von Ihnen!« Ernestine ergriff die Hand des Doktors und drückte sie, während Anton sich nicht sicher war, ob er jetzt eine große Chance verpasst hatte. Noch bevor er seine Frage beantworten konnte, hielt er den Schlüssel von Dr.Schöllers Einzelzimmer in der Hand.
»Des Abendessen findet in aner hoibn Stund im Speisesaal im Erdgeschoss statt, gleich nebn dem Wintergarten, der grad leider gschlossen is, weil die Schneelage es net erlaubt, ihn zu benutzn.«
»In einer halben Stunde schon?«, fragte Ernestine entsetzt.
Herr Sebastian warf einen Blick auf die große goldene Standuhr hinter sich und nickte.
»Ach du Schreck!«, sagte nun auch die Schwester des Doktors. »Da bleibt ja kaum noch Zeit, die Koffer auszupacken.« Sie wandte sich an Herrn Sebastian. »Würden Sie sich bitte beeilen, damit wir unser Zimmer beziehen können?« Sie wippte von den Zehenspitzen zu den Fersen und wieder zurück.
»Ja, sicher«, murmelte dieser. Er war erleichtert, dass sich das Zimmerproblem so schnell gelöst hatte.
»Gerhard wird’s Gepäck auf die Zimmer bringen.« Gerhard war der junge Bursche, der ihnen aus dem Schlitten geholfen hatte. Er mühte sich bereits mit Antons und Ernestines Koffern ab. Auch er trug ein goldenes Namensschildchen mit seinem Namen an der Brust. Im Gegensatz zu seinem Kollegen war er nur »Gerhard«, kein »Herr«. Offenbar stand er im Rang unter ihm.
Unterdessen zog Ernestine Anton am Ärmel. »Kommen Sie, nutzen wir die halbe Stunde, damit wir nicht zu spät zum Abendessen kommen.«
Die Aussicht auf ein köstliches Essen überzeugte Anton. Rasch folgte er Ernestine zum Aufzug.
Sie weigerte sich aber, ihn zu betreten. »Ich habe in diesen fahrenden Schränken immer ein mulmiges Gefühl.« Sie ging entschlossen daran vorbei, weiter zu den Stiegen. Es gab zwei verschiedene. Eine breite, die mit einem dicken dunkelgrünen Teppich ausgelegt war, und eine weitere, deutlich schmälere, die hinter einer Tür versteckt lag und aus einfachen Holzbrettern bestand. Die zweite war offenbar dem Personal vorbehalten. Ernestine entschied sich für die erste. Langsam stieg sie hoch und blieb immer wieder stehen, um die Landschaftsbilder zu betrachten, die an den Wänden hingen. Es handelte sich um Darstellungen der Berge in gedämpften Ölfarben, die mit üppigem, vergoldetem Holz gerahmt waren.
»Wie schade, dass wir nichts davon gesehen haben«, seufzte sie.
»Ich fürchte, dass Sie sich mit den Bildern zufriedengeben müssen«, sagte Anton. »Dem Wetterbericht zufolge sollen Sturm und Schneefall noch zunehmen.«
»Das ist ärgerlich. Aber leider nicht zu ändern«, seufzte Ernestine. »Zum Glück werden wir uns beim Tanzen nicht langweilen.«
Anton schluckte die Antwort, die ihm auf der Zunge lag, herunter.