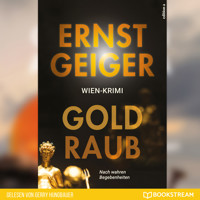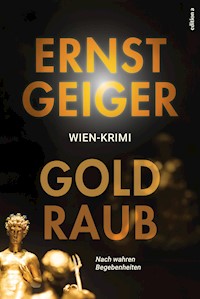
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ernst Geiger muss mit seinem Team den größten Kunstdiebstahl der österreichischen Kriminalgeschichte klären. Denn in den frühen Morgenstunden des 11. Mai 2003 verschwindet die Saliera, ein goldenes Salzfass, aus dem Wiener Kunsthistorischen Museum. Ihr geschätzter Wert: 50 Millionen Euro. Zeitgleich tobt in Wien ein Polizeikrieg, ausgelöst durch die Reformen des Innenministers und verstärkt durch persönliche Konflikte. In diesem Spannungsfeld muss Geiger eine riskante Entscheidung treffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GOLDRAUB
Ernst Geiger:
Goldraub
Unter literarischer Mitarbeit vonMaximilian Hauptmann-Höbart
Alle Rechte vorbehalten
© 2022 edition a, Wien
www.edition-a.at
Cover: Bastian Welzer
Satz: Anna-Mariya Rakhmankina
Lektorat: Sophie Schagerl
Gesetzt in der Premiera
Gedruckt in Deutschland
1 2 3 4 5 — 25 24 23 22
ISBN: 978-3-99001-592-6
eISBN: 978-3-99001-593-3
Die Zitate stammen aus Leben des Benvenuto Cellini, florentinischen Goldschmieds und Bildhauers, von ihm selbst geschrieben, übersetzt von Johann Wolfgang v. Goethe, erschienen 2016 im Holzinger Verlag.
Ähnlichkeiten mit realen Personen sind vom Autor nicht beabsichtigt und rein zufällig.
Ein Ernst-Geiger-Fall
GOLD RAUB
Nach wahren Begebenheiten
edition a
Für Evi, die mir seit41 Jahren zur Seite steht
INHALT
KUNSTHISTORISCHES MUSEUM
TABORSTRASSE: WIEN, JOSEFSTADT
ERSTER TEIL: DER EINBRUCH
KUNSTHISTORISCHES MUSEUM: WIEN, INNERE STADT
SCHNEEBERGDÖRFL: PUCHBERG AM SCHNEEBERG, NIEDERÖSTERREICH
KUNSTHISTORISCHES MUSEUM: WIEN, INNERE STADT
NEUBAUGASSE: WIEN, NEUBAU
BÜRO KRIMINALDIREKTOR: WIEN, ALSERGRUND
KUNSTHISTORISCHES MUSEUM: WIEN, INNERE STADT
ZWEITER TEIL: DER BRIEF
NEUSTIFTGASSE: WIEN, NEUBAU
VERSICHERUNGSBÜRO MONADIQOS: WIEN, DONAUSTADT
RAPPORTSAAL: WIEN, ALSERGRUND
RESTAURANT SALZBURGER HOF: WIEN, INNERE STADT
STADTPARK: WIEN, INNERE STADT
BAR PERUGGIA: WIEN, INNERE STADT
BÜRO DES CHEFREDAKTEURS: WIEN, DÖBLING
RAPPORTSAAL: WIEN, ALSERGRUND
CAFÉ MUSEUM: WIEN, INNERE STADT
BRAND BEI ZWETTL: WALDVIERTEL, NIEDERÖSTERREICH
DRITTER TEIL: DIE JAGD
PADUA, ITALIEN
STREBERSDORFER STRAßE: WIEN, FLORIDSDORF
RADIO ORANGE, TONSTUDIO: WIEN, BRIGITTENAU
LOKAL STRUDEL: WIEN, WÄHRING
DORF IN DER TOSKANA, ITALIEN
PENSIONISTENHEIM: GUTENSTEIN, NIEDERÖSTERREICH
BURGGARTEN: WIEN, INNERE STADT
FLORIDSDORFER MARKT: WIEN, FLORIDSDORF
WOHNUNG: WIEN, HIETZING
PRATERSTRAßE: WIEN, LEOPOLDSTADT
SIEMENS-NIXDORF-STEG: WIEN, ALSERGRUND
SICHERHEITSBÜRO: WIEN, ALSERGRUND
GUNOLDSTRASSE: WIEN, DÖBLING
SALMANNSDORFER HÖHE: WIEN, DÖBLING
SICHERHEITSBÜRO: WIEN, ALSERGRUND
SICHERHEITSBÜRO: WIEN, ALSERGRÜND
VIERTER TEIL: DAS GOLD
RESTAURANT STADTWIRT: WIEN, LANDSTRASSE
CAFÉ STRUDEL: WIEN, WÄHRING
WOHNUNG: WIEN, HIETZING
BRAND BEI ZWETTL: NIEDERÖSTERREICH
RAPPORTSAAL: WIEN, ALSERGRUND
BÜRO EINSATZTEAM SALIERA: WIEN, ALSERGRUND
VERHÖRZIMMER: WIEN, ALSERGRUND
NEUSTIFTGASSE: WIEN, NEUBAU
VERHÖRZIMMER: WIEN, ALSERGRUND
WOHNUNG: WIEN, WÄHRING
BRAND BEI ZWETTL: NIEDERÖSTERREICH
GROSSER SAAL, POLIZEIPRÄSIDIUM: WIEN, INNERE STADT
ALLES GOLD DER WELT
EPILOG
KUNSTHISTORISCHES MUSEUM
»Auf Gold kann man verzichten, nicht aber auf Salz.«
Cassiodor, römischer Staatsmann & Gelehrter
TABORSTRASSEWIEN, JOSEFSTADT
April 2003
Das Geräusch der Alarmanlage fühlte sich für Nick an wie die Scherben einer alten, rostigen Glasflasche, die in sein Trommelfell drangen. Es bohrte sich hinein und ließ kaum Platz, um vernünftig nachzudenken.
Es war ein Amateurfehler gewesen, zuerst die Magnetkontakte am Türrahmen abzumontieren. Was für ein Idiot er doch gewesen war!
Eine kurze Berührung, nicht mehr als ein Streicheln, hatte gereicht, um den Alarm auszulösen. Und obwohl er theoretisch wusste, wie er die Situation unter Kontrolle bringen konnte, schlug sein Herz schneller als gewohnt.
Diese Anlage war ein altes Teil, sie war noch verkabelt und lief nicht über Funk wie die modernen Geräte. Einmal aktiviert alarmierte sie nicht subtil und unbemerkt.
Vielmehr mussten beide leiden, der Einbrecher genauso wie das Opfer. War das etwa fair? Geräusche der Panik schwirrten durch das Gebäude. Dreißig Sekunden und in der Einsatzzentrale der Polizei am Schottenring würde eine Meldung eingehen. Der diensthabende Beamte würde einem Funkwagen die Adresse durchgeben.
In einem Zeitfenster von fünf bis acht Minuten wäre die Streife hier. Selbst wenn es Nick gelänge, dieses nervenzerreißende Geräusch zu unterbrechen, wäre die Konfrontation mit der Polizei dann unvermeidlich.
Nick warf einen Blick auf seine Armbanduhr, ein kleines Modell mit Digitalanzeige. Er konzentrierte sich, presste die Augen zusammen, um einen klaren Blick zu bekommen. Die Alarmzentrale, also das zentrale Modul, mit dem alle Magnetkontakte verbunden waren, hing im hinteren Teil des Ganges unterhalb der Decke. Bereits mit dem ersten Blick erkannte er, dass sie schon lange nicht mehr gewartet worden war.
Er klappte die kurze Leiter auf, die er mitgebracht hatte, und stieg zwei Sprossen nach oben. Irgendjemand hatte einen Plastikmantel, dessen beiger Farbton schon längst dem Grau der Wand gewichen war, über die Anlage montiert, womöglich als zusätzliche Schutzmaßnahme. Nick rüttelte daran, doch so leicht gab er nicht nach. Er griff in seine hintere Gesäßtasche und holte einen Schraubenzieher heraus. Mit ein paar schnellen Umdrehungen hatte er die rostigen Schrauben an der rechten Seite des Gehäuses gelöst. Der Mantel schwang auf.
Fünfzehn Sekunden.
Er erkannte das Modell.
Es war noch älter, als er gedacht hatte. Ein weißes Bedientableau mit einigen übergroßen Ziffern und einem grünen Display, daneben zwei Lautsprecher, die das nervenzerreißende Geräusch erzeugten.
Es wirkte wie die überdimensionierte Ausgabe eines dieser Pensionistenhandys, die gerade so beliebt waren, mit ihren viel zu großen Tasten und einem viel zu dunklen Display.
Sieben Sekunden.
Nick kannte das Modell, weil er darüber bereits vor vielen Jahren in einem Fachmagazin gelesen hatte. Solche Anlagen wurden nicht mehr hergestellt und es wurde auch davon abgeraten, sie überhaupt noch zu verwenden. Ihre Übertragung konnte unterbrochen werden, wenn das Bedientableau nicht mehr funktionierte. Für eine Alarmanlage war das grob fahrlässig, weil der Alarm wirkungslos blieb, wenn der Einbrecher die Alarmanlage zerstörte.
Vier Sekunden.
Nick überlegte nicht lange. Er nahm den Schraubenzieher, drehte ihn in der Hand einmal um, sodass das runde, harte Ende nun nach vorne zeigte. Und dann schlug er zu. Bereits bei seinem ersten Schlag brach das Display entzwei, mit einem hässlichen Knacken gab die Anlage nach. Doch erst nach dem dritten Schlag erlosch das Geräusch, die Schallwellen flachten ab wie eine Welle, nachdem sie über einem Riff gebrochen war. Nur ein Phantomklingeln blieb in seinen Ohren zurück, aber auch das würde bald verschwinden.
Er blickte auf die Uhr, als die dreißig Sekunden gerade abliefen. Hätte er nur einen Augenblick länger gezögert, wäre die Polizei eingeschaltet worden. Nick wischte sich den Schweiß von der Stirn. In dem Raum herrschte eine Stille, die ihn noch mehr beunruhigte als das Kreischen davor.
»Ist das Problem erledigt, Herr Roßmann?«, fragte eine Stimme hinter ihm.
Nick drehte sich um. Unter ihm stand der Hausmeister, Herr Slobodan, ein alter Herr mit runzeligem Gesicht, schlohweißem Haar und kräftigem Akzent. Er hatte die Arme hinter dem Rücken verschränkt und beugte sich nach vorne, als würde er nur darauf warten, dass Nick einen Fehler beging.
»Jetzt schon. Kein Wunder, dass die Anlage ständig losgeheult hat«, sagte Nick, während er versuchte, mit seinem Körper das kaputte Gerät zu verdecken. Er hätte es ohnehin ersetzen müssen, aber er wollte nicht, dass der Eindruck entstand, er hätte es absichtlich zerstört, nur um ein neues verkaufen zu können.
»Die Bewegungsmelder sind völlig hinüber, die hätte man schon vor Jahren ersetzen müssen. Bei der kleinsten Bewegung gehen sie los. Ein Windstoß reicht schon. Außerdem ist das Modell alt. Für Einbrecher leichtes Spiel.«
Was ich gerade bewiesen habe, fügte er in Gedanken hinzu.
»Ehrlich gesagt kann ich Ihnen nicht mal die Bewegungsmelder für dieses alte Modell ersetzen. Es wäre einfacher, ein neues Modell einzubauen. Das brauchen wir nicht mehr verkabeln, funktioniert alles über Funk.«
Nick konnte sehen, wie Herr Slobodan überlegte. Vermutlich musste er dafür die Hausverwaltung um Erlaubnis fragen. Nick hatte schon oft erlebt, dass Kunden ganz instinktiv daran zweifelten, dass eine neue Anlage insgesamt billiger sein konnte als die Reparatur der alten. Am Ende verstanden sie, dass die Geräte mittlerweile einfacher zu bedienen, sicherer und haltbarer geworden waren, aber ihre erste Reaktion, das konnte Nick in ihren Augen sehen, war es, das alte Stück zu behalten. Warum taten sich Leute so schwer, das Neue zuzulassen und sich vom Alten zu verabschieden, selbst wenn es sich bloß um etwas so Belangloses wie eine Alarmanlage handelte?
»Der Alarm wird an eine Privatfirma weitergeleitet«, fügte Nick hinzu. »Dann haben Sie auch nicht dauernd Probleme mit der Polizei.«
Das schien Herrn Slobodan zu überzeugen. Während der Hausmeister die Verwaltung anrief, blickte sich Nick im Stiegenhaus des Altbaus um. Der Eingangsbereich stand dem Zustand der Alarmanlage in nichts nach: Schimmel kroch die Wände hoch und der Putz bröckelte. Die Stiegen waren uneben und vom Keller stieg ein muffiger Gestank nach oben. Nick hätte es nicht gewundert, wenn das Haus nach dem Auslösen der Alarmanlage in sich zusammengefallen wäre. Wofür brauchte so ein Haus überhaupt eine Alarmanlage? Wer wollte hier einbrechen?
Dem Zustand der Anlage nach zu schließen, war sie vor über zwanzig Jahren hier eingebaut worden. Nick hielt nicht viel davon, Alarmanlagen in den Eingangsbereichen von Wohnhäusern unterzubringen. Zu groß die Gefahr, dass sie ein Bewohner auslöste, wenn er den falschen Schlüssel in die Tür steckte und sie mit Gewalt aufzubekommen versuchte. In Privatwohnungen waren sie viel effektiver.
In den letzten Wochen war sie immer wieder losgegangen und hatte nicht nur den Hausbewohnern, sondern auch der Polizei Probleme bereitet. Da es die Firma, die diesen Einbau vorgenommen hatte, schon lange nicht mehr gab, war Nick kontaktiert worden. Ihm gehörte eine kleine Sicherheitsfirma in der Neustiftgasse, die sich in den letzten Jahren einen guten Ruf erarbeitet hatte. Es wäre ihm unangenehm gewesen, bei einer solchen Routinearbeit unabsichtlich die Polizei zu alarmieren und dann auch noch für die Blaulichtgebühr aufkommen zu müssen, die anfiel, wenn ein Fehlalarm ausgelöst wurde.
Herr Slobodan kam zurück. »In Ordnung«, sagte er. »Bauen Sie die neue ein.«
Nick trat hinaus in die Taborstraße und ging zu seinem schwarzen VW, den er in einer Seitengasse geparkt hatte. Er war schon von Weitem zu erkennen, denn in weißen Lettern prangten »Roßmann Sicherheit« und seine Nummer darauf. Er öffnete die Hecktür, nahm sich eine der vorbereiteten Anlagen und kehrte in das Wohnhaus zurück.
Nick trennte die alte Anlage von der Verkabelung und nahm sie von der Wand. Danach fixierte er die neue Anlage und programmierte sie. Er tauschte die alten Bewegungsmelder durch neue aus und verband sie mit der Anlage. Falls jemand nun versuchte, ohne Schlüssel durch die Eingangstür zu gelangen, oder ein Fenster einschlug, würde sie losgehen.
»Und wirklich nur dann«, versicherte Nick dem misstrauisch blickenden Hausmeister. »Leise und diskret.« Er erklärte ihm, dass er sogar eine Telefonnummer programmieren konnte, die eine SMS erhielt, sollte sich die Anlage aktivieren.
Herr Slobodan schien nicht gerade begeistert von der Aussicht, seine Telefonnummer in so ein elektronisches Ding einprogrammieren zu lassen, doch er stimmte letztlich zu. Als Nick die Programmierung abgeschlossen hatte, reichte er Herrn Slobodan die Bedienungsanleitung und die Rechnung.
»Garantie?«, fragte der alte Mann, während er die Rechnung in die Hosentasche stopfte.
»Drei Jahre«, antwortete Nick lächelnd.
»Hm«, brummte der Alte und stieg die Stufen hinunter in das Kellergewölbe, wo er offensichtlich zu tun hatte. Zumindest hoffte Nick, dass der Mann nicht dort unten wohnte.
Die ganze Arbeit hatte gut eine Stunde gedauert. Als Nick wieder auf die Straße trat, schien ihm die Sonne ins Gesicht. Es war ein warmer Apriltag, der sich so viel vom nahenden Sommer krallte, wie er kriegen konnte. Wenn er die Augen schloss, war ihm, als könnte er den nahen Augarten riechen.
Nick ging an einem Friseursalon vorbei, überquerte die Straßenbahnschienen und bog wieder in die Seitengasse ein, in der er sein Auto geparkt hatte. Nachdem er die Gasse zur Hälfte abgegangen war, blieb er stehen und warf einen Blick die Straße hinunter. War er etwa daran vorbeigegangen? Er blickte auf das Straßenschild: Darwingasse. Er war in der richtigen Straße. Und er hätte schwören können, das Auto genau hier, auf Höhe einer Anwaltskanzlei, abgestellt zu haben …
Die schwere Holztür, hinter deren Glasfenster Nick einen geschmackvoll eingerichteten Eingangsbereich mit Marmorstufen und einem Kristallluster entdecken konnte und neben der auch das Messingschild der Anwaltskanzlei angebracht worden war, schwang auf und eine Frau in grauem Kostüm kam heraus.
Sie trug die Haare seriös nach oben aufgesteckt, mit festem Schritt lief sie die Straße entlang, als wäre sie auf dem Weg zu einem wichtigen Termin. Dezentes Make-up betonte ein ernstes, intelligentes Gesicht.
»Entschuldigen Sie«, sagte Nick, als die Frau an ihm vorbeieilen wollte, »Sie haben nicht zufällig einen schwarzen VW gesehen? Genau hier?«
Die Frau machte kurz einen verwirrten Eindruck. Dann musterte sie Nick, der in seinen Jeans, dem weißen Shirt und der schwarzen, abgewetzten Lederjacke genauso gut Musiker wie Alarmanlagentechniker hätte sein können, und entschied sich schließlich für ein Lächeln.
»War das Ihrer?«, fragte sie.
»Ja«, antwortete Nick.
War er etwa gestohlen worden? Der Wagen einer Sicherheitsfirma gestohlen, während er eine Alarmanlage installierte? Und falls dem so war, warum wurde das Lächeln der Frau dann breiter?
Sie deutete auf ein kleines Messingschild, ebenso fein gearbeitet wie jenes neben der Haustür, nur hing dieses unter einem der Fenster, die im Erdgeschoss lagen und auf die Straße hinausgingen. »Parkplätze Kanzlei Reinprecht« war darauf eingraviert worden.
»Ich arbeite in der Kanzlei«, erklärte die Frau. »Ihr Wagen ist vor einer halben Stunde abgeschleppt worden.«
Nick wusste nicht, auf wen er wütender sein sollte, auf die Frau oder sich selbst.
»Bitte seien Sie mir nicht böse«, sagte sie und nun wurde ihr Lächeln einen Deut entschuldigender. »Ich habe gerade erst hier angefangen. Mein Chef hat sich fürchterlich über den Wagen aufgeregt. Aber falls es Ihnen ein kleiner Trost ist …« Sie kramte in ihrer Handtasche, zog eine graue Visitenkarte hervor und reichte sie Nick: »Mag.a Katarina Timać« stand darauf.
»Wir sind allerdings auf Strafsachen spezialisiert, also kann ich Ihnen beruflich vermutlich nicht weiterhelfen.« Die Frau drückte Nick die Karte in die Hand.
»Sie finden darauf meine Privatnummer. So können Sie mich rund um die Uhr erreichen. Falls ich Ihnen einen Drink spendieren darf, als Entschuldigung sozusagen.«
Ohne Nicks Antwort abzuwarten, lächelte sie ihm noch einmal zu und ging dann an ihm vorbei. Kurz darauf war sie in die Taborstraße eingebogen und verschwunden.
Nick stand da, mit der Karte in der Hand, und blickte ihr nach. In letzter Zeit waren solche Sachen häufiger passiert, kleine Andeutungen, dass sich sein Leben nicht mehr mit derselben Leichtigkeit vor ihm ausrollte, wie das bisher der Fall gewesen war. Ging er laufen, fühlte er sich müder als früher, wenn er nach Hause zurückkam. Er versprach sich in Diskussionen, war unbefriedigt mit dem, was er vorbrachte und wie. Er machte häufiger Fehler, wenn er im Garten arbeitete oder in der Garage, verschweißte etwas schlecht, mühte sich mit einfachen Montagen ab, verlor schneller die Geduld. Mit dem abgeschleppten Auto war dieser Serie an Niederlagen eine weitere hinzugefügt worden.
Zumindest hatte er bei der Anwältin einen guten Eindruck hinterlassen. Das gelang ihm bei Frauen meistens, ohne dass er wusste, wieso. Er blickte noch mal auf die Karte, eine versteckte Einladung für einen Feierabenddrink.
»Das Auto wäre mir lieber«, brummte er und steckte die Karte ein. Wer wusste schon, wann er einmal juristische Hilfe benötigen würde.
Er ging zur U-Bahn-Station Taborstraße, in der die lilafarbene Linie U2 verkehrte. Zumindest war dieser Auftrag für heute sein letzter gewesen. Er würde in sein Büro in der Neustiftgasse zurückkehren, seine Sachen sortieren und dann versuchen, seinen Wagen zurückzubekommen. Morgen ist ein neuer Tag, dachte Nick, als er in den U-Bahn-Waggon stieg.
Der Waggon war überfüllt mit Menschen, die alle von der Arbeit nach Hause wollten oder zumindest in die nächste Bar, um noch ein wenig die Aprilsonne zu genießen, die morgen schon in kaltes Schneetreiben umschlagen konnte. Denn der April, pflegte Nicks Mutter immer zu sagen, macht, was er will.
Nick klammerte sich an eine der gelben Sicherheitsschleifen aus Plastik, die von der Decke baumelten. Das rote Licht über der Tür blinkte dreimal auf und ein scharfer Ton erklang. Einer der Fahrgäste überlegte es sich offenbar noch einmal anders. Der Mann war einen Kopf kleiner als Nick, trug einen abgewetzten und zerschlissenen Militärmantel und verbreitete einen penetranten Geruch. Kurz bevor sich die Türe schließen konnte, hechtete er mit einem Sprung nach draußen. Kaum hatte der letzte Zipfel seines flatternden Mantels den Waggon verlassen, schloss sich die Tür und die U-Bahn setzte sich mit einem Ruck in Bewegung.
Bei seinem waghalsigen Manöver hatte der Mann ein paar Leute angerempelt. Ein junger Kerl war dabei auf Nick gestürzt. Ein wenig unbeholfen entwand er sich Nicks Griff, stammelte eine Entschuldigung und stellte sich wieder neben seinen Freund. Beide trugen sportliche Kapuzenpullover und hatten eine Umhängetasche um die Schulter geworfen. Nick schätzte, dass es sich um Studenten handelte. Er hätte auch gerne studiert, irgendetwas mit Mathematik oder Physik, in diesen Fächern war er in der Schule schon begabt gewesen. Doch sein Vater hielt davon wenig. Echte Männer arbeiten, hatte er immer gesagt. Und Nick sollte ein echter Mann werden. Also absolvierte Nick trotz Matura die Lehre zum Elektrotechniker, landete in einer Sicherheitsfirma, verbrachte dort einige Jahre und stellte sich ziemlich geschickt an. Nachdem er sich ein wenig zur Seite gelegt hatte, von einer kinderlosen Tante mit einem Erbe bedacht worden war und einen Kredit aufgenommen hatte, gründete er seine eigene Sicherheitsfirma. Sieben Jahre war das nun her und Nick hatte keines davon bereut. Er war heute sein eigener Mann, nach seiner Definition, nicht nach der seines Vaters. Und genau so wollte er es haben.
»Verdammt«, hörte er den Jungen sagen, der auf ihm gelandet war, »der Kerl hat mir meine Brieftasche geklaut!«
Sein Kollege lachte. »Kein Wunder, dass er so schnell rauswollte«, sagte er.
»Hat dich ausgenommen, als er an dir vorbei ist. Nicht schlecht, muss man ihm lassen.«
Offenbar fand der Bestohlene das weniger lustig. »Lach nicht, du Arsch. Da war alles drin, meine Kreditkarte, mein Führerschein … Was mach ich denn jetzt?«
»Probiere es doch bei Lost & Found«, mischte Nick sich ein. »Vielleicht wurde die Brieftasche nicht gestohlen, sondern sie ist dir einfach irgendwo aus der Tasche gefallen.«
»Dann hat sie bestimmt schon längst jemand eingesteckt…«, sagte der Junge verzweifelt.
»Einen Versuch ist es wert«, sagte Nick, während die U-Bahn in die Station Museumsquartier einfuhr. »Man kann nie wissen.«
Die Tür öffnete sich und Nick stieg aus. Als er die Rolltreppe nach oben fuhr, zog er die Geldbörse aus seiner Jackentasche. Das schwarze, abgegriffene Leder fühlte sich warm und behaglich an.
Er klappte sie auf und warf einen Blick auf den Führerschein: Christian Wolff. Noch nie gehört.
Nick kam in dem Zwischengeschoss der U-Bahn-Station an und ging zu dem Stationsbüro, ein gut verstecktes, kleines Kämmerchen, in dem auf Monitoren die Menschen auf den U-Bahn-Steigen zu sehen waren.
Er klopfte an die Tür und wartete kurz. Eine korpulente Frau mit blonden Locken, die ihr bis zu den Schultern reichten, öffnete ihm die Tür.
»Bitte?«
»Ich bin in der Taborstraße eingestiegen und habe die hier auf dem Boden der U-Bahn gefunden.« Nick streckte ihr die Brieftasche hin. Die blonde Frau starrte darauf, als wäre es der Heilige Gral. Offenbar schreckte sie davor zurück, die Brieftasche an sich zu nehmen. Wartete sie auf mehr Informationen?
»Ich wollte sie nur abgeben«, sagte Nick. »Damit sie der Besitzer wiederbekommt.«
Langsam und zögerlich packte die Frau zu und nahm Nick die Geldtasche aus der Hand.
»Das ist sehr freundlich«, sagte sie, als wollte sie nicht recht glauben, was gerade geschah. »Nicht viele Leute melden solche Funde. Sehr anständig.«
Konnte Nick Misstrauen in ihrer Stimme spüren? Aber gegen wen?
Gegen seine Absichten oder gegen die vielen Menschen, die täglich an ihr vorbeiliefen und von denen die meisten einen solchen Fund für sich behalten würden, das Geld einstecken, die Kreditkarte ausprobieren, um die Brieftasche schließlich in irgendeinem Mistkübel zu entsorgen?
»Warten Sie kurz«, sagte sie, »ich habe ein Formular, da können Sie Ihren Namen angeben, damit Sie der Finder kontaktieren kann, um sich zu bedanken.«
Kaum war ihr Kopf wieder in dem kleinen Raum verschwunden, drehte sich Nick um und ging um die Ecke, schlängelte sich an zahlreichen Menschen vorbei, um über die Rolltreppe ins Freie zu gelangen.
Nick dachte daran, wie er noch zwei Nächte in seiner Wiener Wohnung schlafen würde, ehe er über das Wochenende nach Hause fahren würde, zu seiner Frau und seiner Tochter ins beschauliche Waldviertel, wo man stundenlang spazieren gehen konnte, ohne eine Menschenseele zu treffen. Keine Aufmerksamkeit, keine Geheimnisse, keine Affären oder Betrügereien, keine Lügen, nichts zu verstecken. Kein Risiko, aber auch keine Niederlagen. Ein ruhiges Leben. Ein schönes Leben.
Nick fand sich vor dem Museumsquartier wieder.
Er schmeckte den Staub, der vom Boden aufstieg und sich über ihn legte, die schleichende Frühjahrswärme als Bindemittel nutzend.
Er hob den Kopf und wich geblendet zurück. Die Kuppel des Kunsthistorischen Museums warf das Licht wie einen gleißenden Speer auf ihn zurück. Er konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal in dem Museum gewesen war. Ein Blick auf seine Uhr zeigte ihm, dass er noch genug Zeit hatte, sich darin gemütlich umzusehen, vielleicht sogar an der letzten Führung teilzunehmen.
Nick musste an all die Schätze denken, die in diesem prächtigen Bau gesammelt wurden und einen friedlichen Schlaf schlummerten. Jahrhundertelang hatten Kaiser und Könige unbeschreibliche Prunkstücke gesammelt und jedes einzelne von ihnen war umgeben von der Magie des Unvergleichlichen, verbarg ein Geheimnis, das nur seinem Besitzer offenbart wurde. Doch heute war es unmöglich geworden, diese Schätze zu erfühlen und zu begreifen, verschlossen lagen sie hinter zentimeterdickem Glas. Ihrer Geheimnisse beraubt, genau wie er.
Dabei wusste Nick, dass jeder Mensch ein Geheimnis brauchte.
ERSTER TEIL
DER EINBRUCH
11. bis 13. Mai 2003
Ich kniete nieder und bat ihn, er möchte mir diesen Totschlag und die übrigen, die ich von hier aus im Dienste der Kirche begangen hatte, vergeben. Darauf erhub er die Hand und machte mir ein gewaltiges Kreuz über meine ganze Figur, segnete mich und verzieh mir alle Mordtaten, die ich jemals im Dienste der apostolischen Kirche verübt hatte und noch verüben würde. Ich ging wieder hinauf, fuhr fort zu schießen und traf immer besser; aber mein Zeichnen, meine schönen Studien, meine angenehme Musik gingen mir alle im Rauch fort, und ich hätte wunderbare Sachen zu erzählen, wenn ich alle schönen Taten aufzeichnen wollte, welche ich in diesem grausamen Höllenwesen verrichtet habe.
Aus »Leben des Benvenuto Cellini, von ihm selbst geschrieben«
KUNSTHISTORISCHES MUSEUMWIEN, INNERE STADT
Sonntag, 11. Mai 2003, 1.30 Uhr
Die letzten Besucher huschten flüsternd an ihm vorbei, als er die Gemäldegalerie abschritt. Die Lange Nacht der Museen war gerade zu Ende gegangen, es war halb zwei Uhr früh. Um diese Uhrzeit saß er normalerweise schon längst im Überwachungsraum, trank sein zweites Red Bull, lagerte die Füße hoch, ließ seinen Blick über die Bildschirme gleiten und drückte alle zwanzig Minuten einen kleinen, runden schwarzen Knopf, damit die Polizei nicht alarmiert wurde und plötzlich vor dem Museum auftauchte.
Das war seine wichtigste Aufgabe und er meisterte sie ohne Anstrengung.
»Mislav«, hörte er eine müde Stimme vor sich.
Mislav Jančar hob den Blick. Direktor Blum war als Letzter im Saal 10 zurückgeblieben. Zusammengesunken stand er in der Mitte des Raums und wirkte erschöpft. Bis zuletzt hatte der Direktor mit den Besuchern gesprochen und sich sogar die Zeit genommen, ein wenig über seine Lieblingsbilder zu erzählen.
»Alles ruhig?«
Jančar mochte Blum nicht besonders. Der Direktor war ein kleiner, korpulenter Mann, der mit Westen und Jacketts seinen hervortretenden Bauchansatz zurückzuschieben versuchte. Für das niedere Personal, zu dem der Sicherheitsdienst gehörte, drückte er seine Solidarität lieber durch gezwungen kumpelhafte Worte aus als durch eine Erhöhung des Gehalts.
»Totenstill«, erwiderte Jančar und nickte dem Direktor zu. Blum überlegte, ob er noch etwas sagen sollte, aber offenbar fiel ihm nichts mehr ein. Also nickte auch er und verließ den Saal.
Nun war Jančar allein mit sich und dem quietschenden Geräusch, das seine Gummisohlen erzeugten, wenn sie über den Parkettboden glitten. Als er sich sicher war, dass der Direktor nicht zurückkommen würde, trat er wie jede Nacht, in der er Dienst hatte, vor ein Bild am Ende von Saal 10 und hielt einige Momente inne.
Auf dem Gemälde war eine Winterlandschaft abgebildet. Links im Bild war dicker weißer Schnee zu sehen, in dem ein paar Jäger mit einer Meute von Jagdhunden stapften, dem Betrachter den Rücken zugewandt. Dunkle tote Bäume ragten wie Plastikstücke aus dem Boden. Vor den Jägern fiel der Hügel steil ab und unter ihnen öffnete sich eine weite Landschaft. Zugefrorene Seen waren zu erkennen, auf denen Menschen Schlittschuh liefen. Das Eisblau des Wassers mischte sich mit dem des Himmels.
Das Bild war Jančar zum ersten Mal aufgefallen, kurz nachdem er sich von seiner Frau hatte scheiden lassen. Zwei Jahre war das nun her. Obwohl er schon zehn Jahre als Sicherheitsmann im Kunsthistorischen Museum gearbeitet hatte, hatte er es zuvor nie beachtet. Eines Nachts war es plötzlich vor seinen Augen aufgetaucht wie ein Gespenst. Trotz der kalten Bildlandschaft hatte es eine seltsame Anziehungskraft auf ihn ausgeübt. Er schien nur wenige Meter hinter diesen Jägern zu stehen, kurz davor, in das Bild hineinzuwandern. Als er es länger betrachtete, um herauszufinden, was daran so besonders war, entdeckte er am linken Bildrand ein kleines Feuer, um das einige Figuren saßen. Es war die einzige Quelle der Wärme in diesem Gemälde und doch schien es bis zu ihm hinaus, wärmte ihn geradezu mit seinem flackernden Schein.
Für gewöhnlich interessierte sich Jančar nicht für Kunst. Er absolvierte den Rundgang, der ihn in zweieinhalb Stunden vom Keller über die Ägyptische Sammlung zur Kunstkammer und weiter durch die Gemäldegalerie führte, ohne auf die Gegenstände zu achten, an denen er vorbeilief. Doch seit zwei Jahren verweilte er bei jedem Rundgang kurz vor diesem Bild. Ein kleiner Streifen Wärme in alles verzehrender Kälte. Das konnte er gut gebrauchen.
»Saal 10 klar?«, rauschte es aus dem Funkgerät an seinem Gürtel. Das Geräusch riss ihn aus den Gedanken.
Er führte es an die Lippen. »Gleich«, sagte er. Nach einem letzten Blick auf das Gemälde drehte er sich um und verließ den Raum. »Saal 10 klar«, sagte er.
Sein Kollege Halil würde nun einen Schalter betätigen und damit die Bewegungsmelder aktivieren. Das geschah völlig geräuschlos, doch Jančar stellte sich gerne vor, wie unsichtbare Infrarotstrahlen vom einen Ende des Raums zum anderen schossen. Das sah er immer wieder in verschiedenen Actionfilmen, in denen Diebe, die gut ausgerüstet und noch besser aussehend waren, wertvolle Schätze stahlen. Doch er wusste, dass solche Filme bloße Fantasieprodukte waren. Die Drehbuchschreiber hatten mit Sicherheit noch nie einem Mann wie ihm bei der Arbeit zugesehen. Warum auch? Sein Job war fürchterlich langweilig.
Ein Netz aus Infrarotstrahlen, dachte Jančar und schüttelte den Kopf. Das Museum hatte nicht mal Überwachungskameras in jedem Raum.
Während er durch die Säle schritt, schwang er seine Taschenlampe durch die Luft. So wurde ihm zumindest nicht langweilig. Er hatte noch eine weite Runde vor sich.
Er schritt am Bild eines Jünglings vorbei, die halbe Brust entblößt, in einer Hand ein Schwert, während die andere einen abgetrennten, gigantischen Kopf präsentierte. Jančar war schon unzählige Male daran vorbeigelaufen, aber um diese Uhrzeit fand er es immer wieder gruselig. Er war noch nie untertags in dem Museum gewesen, doch er wusste von den anderen Mitarbeitern, mit denen er sich manchmal unterhielt, dass viele Menschen stundenlang vor diesen Bildern stehen konnten.
Was sahen sie darin? Unschätzbar wertvoll nannte sie Direktor Blum gerne. Jančar hätte sie sicherlich nicht in sein Wohnzimmer gehängt.
Jančar verließ die Gemäldegalerie und ging die breiten Marmorstiegen nach unten. Außer dem leisen quietschenden Geräusch, das entstand, wenn sich seine Turnschuhe von den Stufen lösten, herrschte völlige Stille.
»Hey, Schlafwandler«, meldete sich eine Stimme aus dem Funkgerät. »Hast du nicht etwas vergessen?«
Jančar blieb stehen. Er hatte wie immer im Keller begonnen, wo die Kunstwerke lagerten, die gerade restauriert oder aus anderen Gründen nicht in der Ausstellung zu sehen waren. Danach war er in den zweiten Stock gegangen und hatte das Münzkabinett überprüft. Hier einzubrechen, das leuchtete ihm ein. Es gab viele Menschen, die wie verrückt Münzen sammelten, das wusste er. Für Münzen gab es genug Abnehmer.
Danach hatte er seine Runde in der Ägyptischen Sammlung fortgesetzt, denn die Besucher der Langen Nacht waren bereits zu den Gemälden weitergezogen. Die Kunstkammer im Halbstock hatte er schnell durchquert. Darin gab es jede Menge seltsames Zeug, das irgendwelche Adeligen über Jahrhunderte gesammelt hatten. Manchen Dingern wurden magische Kräfte nachgesagt, doch Jančar war von seiner Großmutter streng christlich erzogen worden. Der Teufel wohnt nicht in Dingen, hatte ihm die alte Frau oft gesagt. Nur in Menschen.
»Die andere Hälfte der Gemäldegalerie«, rief er etwas zu laut aus und erschrak, als seine Stimme von den hohen Wänden widerhallte. Die Gemäldegalerie teilte sich in die Werke der niederländischen, flämischen und deutschen Maler auf der einen und die Gemälde der italienischen, spanischen und französischen Maler auf der anderen Seite. Die Lange Nacht der Museen hatte Jančar durcheinandergebracht und er hatte nur die Seite der nördlichen Meister überprüft.
»Beeil dich«, hörte er Halils Stimme. »Ich schlafe sonst noch ein hier.«
Jančar eilte die Stufen wieder nach oben und trat in jenen Teil der Gemäldegalerie, den er noch nicht durchgesehen hatte. Wütend auf sich selbst beschleunigte Jančar seine Schritte und lief durch die hohen Räume.
Er wollte gerade das Kabinett 5 an seinen Kollegen durchgeben, als ihn ein Geräusch abrupt inne halten ließ. Jančar hielt den Atem an. Hatte er sich verhört? Hatte ihm sein eigener Herzschlag einen Streich gespielt? Doch da war es wieder, unverkennbar: ein Rascheln in der Dunkelheit.
»Halil?«, hauchte er in sein Funkgerät. Keine Antwort. »Halil, melde dich«, sagte er, doch sein Kollege blieb stumm. War er wieder mal auf die Toilette gegangen, obwohl es ihnen verboten war, den Überwachungsraum unbesetzt zu lassen?
Die Dunkelheit schien nach ihm zu greifen. Er befand sich in dem Flügel, der auf den Museumsplatz hinauszeigte und auf der Südwestseite des Museums lag. Seit einigen Monaten wurde die Fassade renoviert und ein Gerüst war errichtet worden, über dem eine große Leinwand hing, die als Werbefläche benutzt wurde. Sie ließ weder Sonnen- noch Mondlicht in die Ausstellungsräume fallen.
Er hängte das Funkgerät an seinen Gürtel zurück, nahm seine Taschenlampe und knipste sie an. Er konnte das Blut in seinem Körper pulsieren fühlen. Das Geräusch war aus dem Eckraum gekommen, aus dem Kabinett 4, auch Raffael-Saal genannt. Was sollte er tun? Solange sein Kollege Halil nicht reagierte, konnte er auch keine Verstärkung rufen.
Außerdem war ihnen verordnet worden, nur im absoluten Ernstfall die Polizei zu verständigen. Zahlreiche Fehlalarme hatten das Museum in der Vergangenheit einen Haufen Geld gekostet. Jančar musste wohl selbst nachsehen.
So langsam und leise er konnte, schlich er auf den Raum zu. Doch je länger seine Schuhe auf dem Boden stehen blieben, desto stärker saugten sich seine billigen Gummisohlen fest und erzeugten ein unsägliches ploppendes Geräusch, als er sie wieder vom Parkett löste. Seine Atmung ging schneller und es stieg ihm ein Rauschen in die Ohren, während er sich an den Vitrinen und Gemälden vorbeischlängelte.
Er betrat den Raffael-Saal. Der Raum wurde von einem einzigen Gegenstand dominiert, der ehrfurchtgebietend auf einem Sockel in der Mitte thronte: ein goldenes Salzfass, die Saliera. Jančar wusste nicht besonders viel über das Objekt, nur, dass es sehr wertvoll war. Er verstand nicht, was die beiden Figuren darstellen sollten, die auf dem Salzfass saßen und es seltsam in die Länge zogen. Doch die Massivität des Goldes faszinierte ihn. Manchmal, wenn er es anblickte, konnte er die glatte und kalte Oberfläche in seinen Händen spüren. So fühlte er sich an, dachte er dann, der Reichtum von tausend Leben.
Doch nun lag die Saliera verborgen hinter einem Schattenwall. Jančar konnte nichts erkennen.
»Ist da jemand?«, fragte er zögerlich. Er machte noch zwei Schritte in den Raum hinein, drehte sich um und …
Ein Umriss löste sich von der Wand und sprang auf ihn zu. Jančar taumelte zurück und ließ die Taschenlampe fallen, die beim Aufprall ausging. Blind hob er die Hände vor das Gesicht. Als er das Gleichgewicht zu verlieren drohte, packte ihn eine Hand am Hosenbund und bewahrte ihn davor, in die Glasvitrine zu segeln.
Vor ihm sah er Halil und unter dessen Bart blitzten die weißen Zähne hervor, als er in Gelächter ausbrach.
»Du Arschloch«, schimpfte Jančar, als er erkannte, worauf er da reingefallen war. »Du verdammtes Arschloch!«
»Reg dich nicht so auf«, sagte Halil, während er versuchte, Luft zu holen. »Du hättest dein Gesicht sehen sollen!«
»Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen.« Jančar war rot angelaufen und hob seine Taschenlampe vom Boden auf. Am liebsten hätte er Halil damit eins übergezogen. »Was soll der Scheiß? Warum bist du überhaupt hier? Du solltest im Überwachungsraum sitzen!«
»Herbert ist gekommen«, sagte Halil. Herbert war der Leiter des Sicherheitsdiensts, ein fünfzigjähriger Österreicher, der immer schlecht gelaunt war und dessen Tante oder Cousine, Jančar wusste das nicht genau, in der Verwaltung des Museums arbeitete. Die letzten Tage war Herbert krank gewesen, zumindest hatte er das behauptet. Offenbar ging es ihm heute gut genug, um wieder mal an seinem Arbeitsort vorbeizuschauen.
»Ich habe fünf Euro gewettet, dass du dir vor Angst in die Hose machst«, kam Herberts einfältige Stimme aus Jančars Funkgerät. »Wegen dir Scheißer schulde ich Öztürk jetzt was.«
»Sehr witzig«, sagte Jančar. Zu all seinen anderen gewinnenden Eigenschaften war Herbert auch noch ein Rassist. »Kabinette 4, 5 und 6 klar.«
»Bingo«, antwortete Herbert.
Noch immer wütend auf seine Kollegen, ging Jančar durch die übrigen Säle, dicht gefolgt von Halil, der noch immer wie ein kleiner Junge kicherte. Nachdem nun auch dieser Teil der Gemäldegalerie gesichert worden war, kehrten sie in den Überwachungsraum im Ostflügel des Gebäudes zurück.
Der Raum war klein, mit drei alten Bürosesseln ausgestattet und einem Tisch, auf dem sich Dosen, Kaffeebecher und Chipstüten stapelten. An der Wand hingen einige Bildschirme, auf denen Überwachungsbilder zu sehen waren, und darunter war ein Schaltpult angebracht worden, mit dem sich Alarme ausschalten oder an die Polizei weiterleiten ließen.
»Da sind ja die zwei Abenteurer«, begrüßte sie Herbert, als Jančar und Halil durch die Tür kamen.
Jančar sagte nichts und ließ sich in einen Sessel fallen. Man konnte die klebrigen Energydrinks riechen, die zu den Grundnahrungsmitteln der Sicherheitsleute gehörten. Eine Uhr an der Wand zeigte zwei Uhr früh. Noch sechs Stunden Dienst.
Sein Tagesgeschäft in der Nacht zu verrichten, schottete einen vom Rest der Gesellschaft ab, das hatte Jančar schon bald bemerkt. Man ging ins Bett, wenn andere gerade aufstanden, musste sich ausruhen, wenn andere Menschen etwas unternehmen wollten.
Es war schon schwierig genug, mal ins Kino zu gehen oder mit Freunden in eine Bar. Über Sex wollte Jančar gar nicht nachdenken.
Und wofür, fragte sich Jančar, als er seine beiden Kollegen vor sich sah. Herbert hatte sich in ein schmuddeliges Magazin vertieft. Sein Bestand an solchen Hochglanzmagazinen, die Lust wecken sollten, in Jančar aber nichts als Ekel auslösten, schien grenzenlos. Halil hatte die Arme verschränkt und döste vor sich hin, das Red Bull neben ihm hatte offenbar nicht geholfen.
Jančar seufzte tief und wandte sich den Bildschirmen über ihm zu. Er würde seine Augen so lange auf diesen flimmernden Schirmen haften lassen, bis sich sein Verstand gnädig zeigte und sie ihm, beinahe unbemerkt, schloss.
Er war eingedöst, als ihn ein lautes Klatschen weckte. Herbert hatte sein Magazin auf den Tisch geworfen. »Ich muss mal«, sagte er und verschwand nach draußen.
Verschlafen blickte Jančar um sich. Halils Kopf war auf die Tischplatte gefallen, eine kleine Pfütze hatte sich neben seinem Mund gebildet. Die Uhr zeigte fast drei Uhr früh.
Jančar stand auf, um sich ein wenig zu strecken. Er saß gerade in der Hocke, die Arme vorgestreckt, als der Alarm losging. Beinahe wäre er nach hinten gekippt. Halil fuhr in die Höhe, stieß die Dose um und spritzte die klebrige Flüssigkeit in alle Richtungen.
»Was ist los, verdammt?«
»Ganz ruhig«, sagte Jančar. »Bloß ein Alarm.«
Halil wandte den Kopf. »Wo ist Herbert?«
»Musste mal für kleine Männer«, sagte Jančar. Der Alarm war leise, aber stechend, unüberhörbar waberte er durch die Luft wie Nebel und heischte um ihre Aufmerksamkeit.
Jančar blickte auf die Kontrolltafel. »Kabinett 4«, sagte er, als er das Lämpchen blinken sah. »Der Raffael-Saal.«
»Da war alles ruhig, als wir durchgingen«, sagte Halil.
»Wird wohl ein Fehlalarm sein«, sagte Jančar. Beide blickten sich an. Wenn sie den Alarm in drei Minuten nicht abschalteten, würde die Polizei anrücken. Doch in den letzten Jahren hatte es beinahe wöchentlich Fehlalarme gegeben. Der letzte lag zwar schon ein wenig zurück, doch Jančar hatte noch nie einen Alarm erlebt, der kein Fehlalarm gewesen war. Die Statistik war also eindeutig auf ihrer Seite.
Dennoch zögerte er. Für gewöhnlich sagte Herbert, was in solchen Fällen zu tun war. Um Verantwortung zu übernehmen, wurde ihm ein wenig mehr gezahlt als Jančar, und in diesem seltenen Fall fand Jančar das auch gerechtfertigt. Verantwortung war etwas, mit dem er ungefähr so viel anfangen konnte wie mit den Gemälden der flämischen Meister im ersten Stock. Die Bezahlung, das hatte Jančar schon bald erkannt, richtete sich nicht nach Kompetenzen, sondern nach Verantwortung. Wer mehr bezahlt bekam, war am Ende auch an mehr schuld. Das war fair in einer Welt, in der das gefährlichste Gut die Verantwortung war, noch abstoßender als jedes radioaktive Material. Niemand wollte sie länger als notwendig in der Hand halten und die meisten Menschen fürchteten sich sogar davor, von ihren Strahlen nur gestreift zu werden.
»Standardprozedur?«, fragte Halil schließlich. Sie hatten noch eine Minute und zwanzig Sekunden. Die Standardprozedur war in stiller Übereinkunft zwischen Sicherheitspersonal und Verwaltung getroffen worden. Bereits eine Maus konnte einen Alarm auslösen und tat das auch häufig. In einem so alten Gebäude wimmelte es nur so von Mäusen. Die Polizei jedes Mal anrücken zu lassen, nur weil sich eines dieser Tierchen zwischen die Sarkophage der Pharaonen verirrt hatte oder unter antiken Skulpturen dahinhuschte, war nicht finanzierbar.
Während des Baues der Linie U2 gab es so gut wie jeden Abend einen Fehlalarm. Manchmal reichte sogar ein besonders schwerer Lastwagen aus, der über den Museumsplatz fuhr.
Zwanzig Sekunden.
Wo zur Hölle blieb Herbert, dachte Jančar.
Die Standardprozedur bestand darin, den ersten Alarm abzustellen und zu warten. Ging ein zweiter los, würde sich einer der Sicherheitsleute auf den Weg machen, um sich die Sache anzusehen, und die Polizei alarmieren. Doch dazu war es in den zwölf Jahren, in denen Jančar nun schon hier arbeitete, noch nie gekommen.
»Standardprozedur«, bestätigte Jančar und drückte den Knopf. Augenblicklich erlosch der Alarm. Weder Halil noch Jančar bewegten sich. Beide warteten, was passieren würde. Eine Anspannung lag im Raum, die keiner der beiden aufzulösen wagte.
Da schwang die Tür auf und Herbert trat ein. Er warf den beiden verwirrte Blicke zu, als er sie wie versteinert dastehen sah. »Was ist denn mit euch los?«, fragte er.
»Alarm«, sagte Halil nur.
»Und?«, fragte Herbert, ließ sich wieder in seinen Stuhl fallen und schnappte sich das Magazin vom Tisch. »Ihr wisst doch, was zu tun ist. Ausschalten und warten. Die Säle und die Durchgänge dazwischen sind voll von Bewegungsmeldern. Wenn sich da drin was bewegt, das größer ist als eine Maus und schwerer als der Wind, dann löst das einen zweiten Alarm aus.«
Er beugte sich nach vorne und hielt den Kopf schief, als würde er konzentriert lauschen.
»Hört ihr das?«, fragte er schließlich.
»Nein«, sagte Jančar.
»Ganz genau, ihr Profis«, sagte Herbert, lehnte sich wieder zurück und schlug das Magazin auf. »Fehlalarm, wie sonst auch immer.«
Ganz wohl fühlte Jančar sich nicht, auch wenn er nicht sagen konnte, wieso. Zuerst der Schreck, den ihm Halil eingejagt hatte, und jetzt das. Was für ein Tag.
Jančar warf einen Blick auf die Uhr. Noch viereinhalb Stunden, dann würde er sich ins Bett fallen lassen, während die Sonne über den Dächern der Stadt auftauchte, und endlich ein wenig Ruhe finden.
SCHNEEBERGDÖRFLPUCHBERG AM SCHNEEBERG, NIEDERÖSTERREICH
Sonntag, 11. Mai 2003, 4 Uhr
Das Band an der Ziellinie schwang nur wenige Meter vor mir im Wind, flatterte wie eine Wetterfahne kurz vor dem Sturm. Dahinter füllten Hunderte Menschen das Burgtor aus, sie schrien und sprangen, und das alles für mich.
Meine Beine flogen über die leere Straße wie eine Feder durch die Luft, sanft, gleichmäßig. Der Schweiß drang aus meinen Poren in derselben Regelmäßigkeit, mit der meine Atmung ging. Flach, beständig, kurz ein, länger aus, um Seitenstechen zu vermeiden. Die Schönheit der letzten Meter überwältigte mich, ließ mich beinahe erschaudern. Der Weg ist das Ziel, sagt ein altes Sprichwort. Aber ohne Ziel weiß man nicht, dass man sich auf einem Weg befindet.
Ich roch alles, das Frühlingsgrün der Blätter, den Staub der Straße, die Euphorie der Menschen, die abgewetzten Profile meiner Schuhe auf dem Asphalt. Und mit einem Schlag erstarb jedes Geräusch. Der Wind fiel zu Boden, die Münder der Menschen zogen sich stumm auseinander, die Menge war gefangen in einer alles verschlingenden Stille. Der Rhythmus meiner Atemzüge, die mich während des gesamten Laufs begleitet hatten, drang nicht mehr zu meinen Ohren. Und ich ergab mich jener Erfahrung, die jedem Läufer schmerzhaft und süß zugleich erscheint, weil sie seiner Leistung erst Sinn verleiht und ihn gleichzeitig an all das erinnert, was er nie schaffen wird: Ich blieb stehen.
Das Band, das die Ziellinie angekündigt hatte, war verschwunden. Ich drehte mich um und bemerkte, dass ich plötzlich auf dem Heldenplatz stand, ohne das Ziel überquert zu haben. Unberührt flatterte das Band hinter mir. Niemand war zu sehen, ich hätte der einzige Mensch in ganz Wien sein können. Und vielleicht war ich es auch.
Die Kälte kroch an mir hoch und fühlte sich an wie Morgentau. Doch es war keine Kälte, wie sie getrockneter Schweiß auf dem Körper zurückließ, abweisend und dicht wie ein Panzer. Es war eine Kälte, die sich einem durch die Eingeweide bahnte, die Organe umwickelte, das ganze Herz erfasste.
Was war der Weg wert, wenn man das Ziel nie erreichte?
Dann wachte ich auf.
Der Regen prasselte gegen das Fenster. Ich blickte auf den Wecker, der auf einem kleinen Tischchen am Kopfende des Bettes stand. Es war vier Uhr früh. Eva schlief tief und fest neben mir, das Gesicht zur Seite gewandt.
Ich wusste, ich würde nicht mehr einschlafen können. Leise glitt ich aus dem Bett, schlüpfte in die Hausschuhe und stieg die Treppen in das Erdgeschoss hinab. Das Haus war dunkel, Umrisse stießen durch die Schatten, als wären die Möbel nur zur Hälfte zusammengesetzt worden, die Räume nur halb eingerichtet, die Atmosphäre schizophren.
Seitdem Anfang des Jahres meine Mutter in ein Pensionistenheim in Gutenstein gezogen war, wo sie eine ständige Betreuung erhielt, war etwas verloren gegangen. Obwohl ich in den letzten Jahren viel Zeit hier verbracht hatte, um das Haus meiner Kindheit zu renovieren, und sein Fundament, sein Dach, seine Fassade und jeden Grashalm im Garten kennengelernt hatte, Details, die mir als Kind nie aufgefallen waren, fehlte etwas.
Ich setzte mich an den langen Esstisch im Wohnzimmer und blickte durch die Glastür auf die Terrasse, wo die Dunkelheit das Bergmassiv verschluckte, das sich vor uns erhob. Irgendwo dahinter lauerte er, der Schneeberg, der diesem Dorf seinen Namen gab, doch es sollten noch einige Stunden vergehen, bis die Sonnenstrahlen hinter seinen Spitzen hervorbrachen und ihn in die Wirklichkeit zogen.
In den letzten Monaten waren die Albträume häufiger geworden. Ich arbeitete nun schon viele Jahre für die Berggasse, wie das Sicherheitsbüro der Polizei genannt wurde, und hatte mit allen erdenklichen Straftaten zu tun gehabt: Diebstahl, Erpressung, Drogenhandel und nicht zuletzt Mord. In den vergangenen Jahren war ich Leiter des Morddezernats gewesen und hatte mit Fällen wie den Favoritner Mädchenmorden oder Jack Unterweger zu tun gehabt. Doch meist schlief ich ruhig wie ein Fisch im Wasser. Was hatte sich geändert?
Der Tisch, übersät mit Aktenordnern, verriet es mir. Es kam immer häufiger vor, dass ich Ordner und Mappen mit ins Schneebergdörfl brachte, in dem meine Frau und ich uns eigentlich eine Oase der Ruhe hatten schaffen wollen. Doch seit der Polizeireform von Innenminister Strasser hatte sich alles verändert. Sie hatte die alte Ordnung völlig auf den Kopf gestellt.
Lange war daran gebastelt worden und mit dem Ergebnis hatten nun wir, die Kriminalbeamten, zu kämpfen. Ein zentrales Kriminalamt war neu geschaffen worden, dem drei Kriminaldirektionen unterstanden. Die erste Kriminaldirektion war früher das Sicherheitsbüro gewesen. Es kümmerte sich um die schweren Delikte, um Mord, Diebstahl, Drogen. Außerdem waren die Wirtschaftspolizei, die sich etwa um schweren Betrug, Veruntreuung und andere Wirtschaftsdelikte kümmerte, und die Fremdenpolizei jetzt in der Direktion I untergebracht. Mir war die Leitung der Direktion I übertragen worden, allerdings mit einem fahlen Beigeschmack. Mein langjähriger Chef, Max Edelbacher, der als Roter alter Schule mit der schwarz-blauen Regierung von Beginn an auf Kriegsfuß stand, war ins Kommissariat Favoriten versetzt worden, was einen tiefen Fall für ihn bedeutete.
Die Direktion II bestand aus fünf Kommissariaten, die alle 23 Wiener Bezirke abdeckten und sich mit kleineren Delikten befassten, sozusagen dem Tagesgeschäft. Die Direktion III war vormals als Erkennungsdienst bekannt gewesen, also die Spurensicherung.
Während diese Organe früher mehr Macht besaßen und sich gegenseitig in die Schranken weisen konnten, unterstanden die drei Direktionen nun alle dem neuen Kriminalamt. Dieses war geschaffen worden, um die gesamte Polizeiarbeit zu zentralisieren. Damit erhoffte man sich Effizienz und schnelle Handlungsfähigkeit.
Der Chef dieses Kriminalamts und damit auch mein Chef war Kriminaldirektor Robert Dachs. Dachs hatte zuvor die Wirtschaftspolizei geleitet und war mit der Strukturierung der Reform beauftragt worden. Ich kannte Dachs schon länger, hatte immer wieder oberflächlich mit ihm zu tun gehabt. Doch seit der Reform hatte sich unser Verhältnis verändert.
Dachs hatte seine Arbeit so gut gemacht, dass ihn die Politik auf den obersten Sessel hievte. Über ihm stand nur noch der Polizeipräsident, der aber eher eine repräsentative Funktion innehatte. Tatsächlich verfügte Dachs über weitreichende Kompetenzen. Oder, wie manche meinten, über eine gefährliche Ansammlung von Macht.
Noch konnte ich Dachs nicht richtig einschätzen. Er verhielt sich distanziert, konnte manchmal herrisch sein, aber seine Anweisungen waren klar und deutlich. Oft kam er mit seiner Polizeiuniform in die Arbeit, während wir anderen Beamten Zivil trugen, Anzug und Krawatte. Aber im Grunde war mir egal, wie er sich anzog. Dachs schonte sich selbst nicht und die Beamten, die unter ihm arbeiteten, genauso wenig. Frühere Kollegen aus der Wirtschaftspolizei hatten berichtet, dass dieser Eifer obsessive Züge annehmen konnte. Noch hatte ich das nicht bestätigen können, zu kurz arbeiteten wir zusammen, doch auch in der Arbeit hatte sich etwas verändert. Etwas, das ich nicht benennen konnte.
Während ich nachdachte, streifte mein Blick die nach außen hin verspiegelte Glasscheibe und kurz zuckte ich zusammen. War dort draußen etwas durch die Büsche gehuscht?
Ich hatte in meinem Beruf viel Schreckliches gesehen, doch ich hatte gelernt, mit dem Erlebten umzugehen. Anders war es in meinem Beruf auch gar nicht möglich. Doch seit der Umstrukturierung war meine Haut dünner geworden. Ich verspürte mehr Stress und es fiel mir schwerer, mich zu konzentrieren. Ich wusste, dass es sich bei der Bewegung draußen vermutlich um einen Hasen handelte oder bloß um den Wind, der durch die Sträucher strich. Dennoch beunruhigte es mich. Jeden Tag erwartete ich, dass etwas Tiefgreifendes geschehen würde. Und in der Vagheit dieser Erwartung konnte sich alles verstecken.
Vorsichtig stand ich auf und schob die Glastüre zur Seite. Die Nacht war kühl und das Licht der Sterne, die hier, fernab der großstädtischen Lichtverschmutzung, gut zu sehen waren, schenkte keine Wärme. Langsam schritt ich über die Steinfliesen der Terrasse, während der Regen auf mich fiel, sanfte Nadelstiche.
Ich wartete, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Wartete und lauschte. Im Gras waren keine Spuren zu erkennen, keine umgeknickten Halme oder Abdrücke. Auch die Büsche, die vor dem Zaun gepflanzt worden waren und den Garten umgaben, waren nicht abgebrochen oder zur Seite gedrückt worden. Alles war ruhig, friedlich, trügerisch. Schließlich beschloss ich, dass es keinen Sinn mehr hatte, weiter hier draußen auf etwas zu warten, das nicht kommen würde, und drehte mich um. Erneut fuhr ich zusammen.
Ich brauchte einen Moment, um zu erkennen, dass ich es selbst war, der mir entgegenblickte, mein Gesicht müde und zweifelnd. Es waren wohl diese Konturen im Glas, deren Reflexion mir im Mondlicht und mit dem einfallenden Regen wie eine Bewegung vorgekommen war und die ich zuvor nicht als meine eigenen erkannt hatte.
Vielleicht, dachte ich, verhielt es sich mit diesem Fehlen, dessen abwesenden Gegenstand ich nicht benennen konnte, womöglich ganz anders.
Vielleicht verwirrte mich nicht so sehr, was verschwunden, sondern was dazugekommen war. Mit meinem neuen Amt hatte ich mehr erreicht, als ich es mir je hatte erträumen können. Ich war keine fünf Minuten von diesem Haus in eine einklassige Volksschule gegangen, meine Mitschüler hatten zumeist die Bauernhöfe ihrer Eltern übernommen. Doch ich empfand kein Glück über meine neue Stellung. Vielleicht aber hatte das gar nichts mit Glück zu tun. Doch wenn das stimmte, was konnte ich schon dagegen tun?
Ich ging zurück ins Haus, schloss die Glastür, ließ mich auf die Couch fallen und schaltete den Fernseher ein. Irgendwann fielen mir die Augen zu.
Etwas kitzelte meinen Hinterkopf. Ich blinzelte. Eva stand hinter mir.
Sie lächelte. »Guten Morgen«, sagte sie.
»Morgen«, murmelte ich.
»Schlafen wir jetzt in getrennten Betten?«
»Ich habe schlecht geträumt«, sagte ich. »Es hatte etwas mit dem Wien-Marathon zu tun.«
Eva warf mir einen besorgten Blick zu. »Vergiss den Marathon«, sagte sie. »Ich mache uns mal ein Frühstück.«
Ich streckte mich und lockerte meine Muskeln. Eva wusste, dass ich dieses Jahr unbedingt den Wien-Marathon hatte laufen wollen, und zwar unter 3 Stunden 30. Ich war in den letzten Jahren sechs Marathons gelaufen, unter anderem in New York, der Wachau und Wien. Meine Bestzeit lag bei 3 Stunden 38. Nicht schlecht, aber das ging noch besser. Ich hatte lange für den Wien-Marathon im April trainiert, doch Verletzungen hatten es mir letztlich unmöglich gemacht, überhaupt anzutreten. Noch eine Sache, die unerledigt an mir hing wie eine Fessel.
Der nächtliche Regen war frühsommerlichem Sonnenschein gewichen und Eva deckte den kleinen Tisch auf der Terrasse, deren Steinplatten die Wärme der Sonne aufsogen wie ein Schwamm.
Eva setzte sich neben mich. Ihre Schönheit kam mir vor wie das Anbrechen eines neuen Tages: Obwohl man es Tausende Male erlebt hatte, konnte man sich seines Zaubers nicht verschließen. Mit ihr frühstücken zu können, war ein Geschenk, das nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Alltäglichkeit mein Leben erfüllte. Ich mahnte mich, das nicht zu vergessen. Meine Frau hatte sich stets um unsere Tochter Katja gekümmert, wenn ich lange Stunden im Büro bleiben musste. Sie hatte mich stets unterstützt. Nun sollten wir eigentlich mehr Zeit füreinander haben und dennoch warteten im Wohnzimmer bereits schwere Aktenordner auf mich.
Der Geruch von Kaffee und frischem Brot stieg mir in die Nase. Ich strich mir Erdbeermarmelade auf die Brotscheibe und nahm einen kräftigen Bissen.
»Schade, dass Katja nicht mitgekommen ist«, sagte ich, während ich kaute.
Unsere Tochter hatte im September mit ihrem Jusstudium begonnen. Sie war in eine kleine Wohnung nicht weit von uns gezogen, im zwölften Bezirk. Noch so eine Veränderung. Obwohl sie gelegentlich zu uns essen kam, sahen wir uns weniger. Auch auf unsere Wochenendausflüge ins Schneebergdörfl begleitete sie uns nicht mehr so oft wie früher.
»Es ist ihr erstes Semester«, sagte Eva. »Da hat sie Besseres zu tun, als mit ihren alten Eltern zwischen Kuhweiden zu sitzen.«
»So alt sind wir noch nicht«, wandte ich ein.
»Für Kinder sind die Eltern immer alt«, sagte Eva.
Ich lachte, nahm ihre Hand und atmete die Luft ein, die nach nassem Gras und Heu roch. Als Kriminalbeamter schmeckte man, wenn ein Ort unberührt war und unschuldig. Ich gierte regelrecht danach, mir die Lunge mit dieser Luft zu füllen, bevor wir heute Nachmittag wieder zurück nach Wien fahren würden.
Alles an diesem Ort, die Schläge der Schmetterlingsflügel, die mir ins Auge fielen wie ein Blinzeln, das Gras vom flutenden Sonnenlicht übergossen, die Schneedecken auf den Bergspitzen, über uns thronend als stumme Zeugen der Ewigkeit, das alles hätte mir reichen können, doch das tat es nicht, noch nicht zumindest. Ich fühlte, dass ich die Ziellinie noch nicht überquert hatte, wenn ich auch noch nicht wusste, worauf ich genau zulief.
Das Klingeln meines Handys zog einen Riss durch die Geräuschkulisse dieser Idylle und dahinter kam mein anderes Leben zum Vorschein, jenes, das durch meine Träume spukte. Ich warf Eva einen kurzen Blick zu und sie nickte. Wir hatten uns im Polizeidienst kennengelernt, sie verstand besser als jede andere Person, was es bedeutete, im Kriminaldienst zu arbeiten.
Ich ging zur Küchentheke, auf der mein Diensthandy lag.
»Geiger?«
»Dr. Geiger«, meldete sich die nervöse Stimme eines jungen Beamten.
»Was ist los?«
»Kriminaldirektor Dachs bittet Sie, so schnell wie möglich nach Wien zu kommen. Ins Kunsthistorische Museum…«
Er brach ab und dachte wohl darüber nach, wie viel er sagen sollte. »Es geht um einen Einbruch.«
»Was wurde gestohlen?«, fragte ich. Mit dem Handy am Ohr warf ich einen Blick nach draußen, wo meine Frau saß und sich von der Sonne anscheinen ließ. Das Bild zog mich hinein, verschluckte meine Aufmerksamkeit, sodass ich beinahe nicht hörte, was der Beamte sagte.
Seine Antwort klang mechanisch, wie abgelesen: »Bei dem gestohlenen Gegenstand handelt es sich um … « Er machte eine Pause, wohl um auf seine Notizen zu blicken und jeden Buchstaben einzeln abzulesen.
»Um die Saliera.«
KUNSTHISTORISCHES MUSEUMWIEN, INNERE STADT
Sonntag, 11. Mai 2003, 11 Uhr
Siebzig Minuten später parkte ich meinen Dienstwagen, einen schwarzen VW Golf, am Burgring. Eva würde später mit unserem Privatauto zurückfahren. Ich hatte ihr gesagt, sie brauchte mit dem Essen nicht auf mich zu warten. Es war schwer zu sagen, wie lange das hier dauern würde.
Als ich ausstieg, konnte ich bereits ein Polizeiaufgebot vor dem Kunsthistorischen Museum erkennen. Heute fiel es mir leicht, auf den ersten Blick auszumachen, welches der beiden Zwillingsgebäude Kunstschätze beherbergte.
Einige Menschen nutzten das angenehme Frühsommerwetter, um über den Platz zu spazieren oder in der Wiese rund um die Statue von Maria Theresia zu sitzen. Ein paar neugierige Blicke wurden auf die Polizisten geworfen, die keine Zivilisten auf die steinernen Treppen ließen, die vor dem Eingang des Kunsthistorischen Museums lagen.