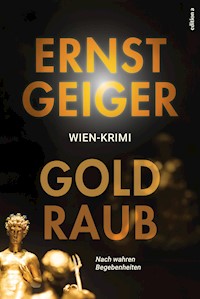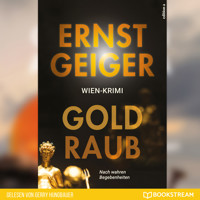Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Der Mörder inszeniert die Leiche der zwanzigjährigen Alexandra wie ein Kunstwerk. Der Wiener Kriminalbeamte Ernst Geiger weiß, dass die Lösung des Falles ein Rennen gegen die Zeit ist, doch die Ermittlungen stocken. Als zwei weitere Mädchen sterben, verfällt ganz Wien in Panik. Die Mädchenmorde ziehen die spektakulärsten Polizeiermittlungen nach sich, die die Stadt je erlebt hat. Ein fesselnder Krimi, basierend auf wahren Begebenheiten in den ausklingenden 1980er- und beginnenden 1990er-Jahren, raffiniert erzählt vom damaligen Chefermittler Ernst Geiger.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Geiger:
Heimweg
Alle Rechte vorbehalten
© 2021 edition a, Wien
www.edition-a.at
Lektorat: Maximilian Hauptmann
Cover: Isabella Hofbauer
Satz: Sophia Stemshorn
Gesetzt in der Premiera
Gedruckt in Deutschland
1 2 3 4 5 — 24 23 22 21
ISBN 978-3-99001-540-7eISBN 978-3-99001-541-4
Ein Ernst-Geiger-Fall
HEIM WEG
Die Geschichte der Favoritner Mädchenmorde
Inhalt
1988
2000
1988
2000
1989
2000
1990
2000
EPILOG
1988
Dienstag, 25. OktoberDisco Azzurro, Wien-Favoriten
Das Erste, was ihm auffiel, war der bordeauxrote Rollkragenpullover. Er schätzte sie auf Anfang zwanzig, aber so genau konnte er es im aggressiven Stroboskoplicht der Tanzfläche nicht erkennen. Sie bewegte sich zwischen zwei Mädchen, vermutlich ihren Freundinnen, langsam zu Always on my mind der Pet Shop Boys, die Hände immer eng am Körper, die Finger fuhren die Seiten des Pullovers hinauf und hinunter, als würde sie über die Saiten einer Violine streichen, sie glitten über den langen Hals, berührten die blonden Locken.
Maybe I didn’t treat you / Quite as good as I should have drang es aus den dröhnenden Boxen, die in den Ecken der Disco hingen und die Wände zum Vibrieren brachten. Es war eine ruhige Nummer, Musik für verliebte Pärchen, die einander bei langsamen Bewegungen tief in die Augen blickten. Sie tanzte umgeben von unzähligen Leuten, doch sie tanzte für sich allein. Sie hatte die Augen geschlossen und bemerkte ihn nicht. Niemand bemerkte ihn.
Er stand an den Tresen gelehnt, nippte vorsichtig an seinem Bier und lauschte aufmerksam der Musik. Leichtes Unwohlsein machte sich in seiner Magengegend breit. Die Situation war ungewöhnlich für ihn. Er ging nicht oft aus, die laute Musik tat ihm in den Ohren weh, und unter Menschen fühlte er sich einsamer als sonst, wenn er allein war.
Doch es war der 25. Oktober, und alle, die alt genug waren oder unaufmerksame Eltern hatten, trafen sich in einem der unzähligen Wiener Tanzlokale. Morgen würden sie ausschlafen, ihren Kater auskurieren, Aspirin schlucken und gar nicht bemerken, wie der Nationalfeiertag langsam an ihnen vorbeizog. Doch das alles war jetzt noch unendlich weit weg. Jetzt ging es um schwitzende Körper, um zuckende Arme und stampfende Beine, um lautes Gelächter und verunsicherten Blickkontakt und eine lange, unbeschwerte, sorgenfreie Nacht. Er versuchte, diese Empfindungen zu teilen. Und zum ersten Mal verstand er fast, was das bedeutete: dazugehören.
Schon oft hatte er die Kollegen in der Bank über diese für ihn so unbekannten Erlebnisse sprechen hören. Auch heute Vormittag, versteckt hinter dem Schalter, an dem er Sparbücher für kleine Kinder in Begleitung ihrer Mütter eröffnete oder älteren Damen erklärte, wie sie Geld aus einem Automaten bekommen konnten, der wie durch Zauberhand Geldscheine ausspuckte. Mit halbem Ohr hörte er Pläne von wilden Discobesuchen mit Freundinnen und von einer Männerrunde, die Wien unsicher machen würde.
Es war nicht die Absicht der Kollegen gewesen, ihn neidisch zu machen oder bloßzustellen. In Wirklichkeit sprachen sie gar nicht mit ihm. Er hörte nur zu. Das genügte.
Als er heute von der Bankfiliale im vierten Wiener Gemeindebezirk mit der Straßenbahnlinie 65 zu seiner kalten, dunklen Zweizimmerwohnung im zehnten Bezirk, Favoriten, unterwegs gewesen war, hatte er sich unweigerlich fragen müssen, wie das wohl war: Pläne zu haben, zu einer Gruppe zu gehören, neue Menschen und Dinge kennenzulernen.
Lange hatte er mit sich gerungen. Das Abendessen, lustlos zubereitete Spaghetti mit Bolognesesauce aus der Dose, war kalt geworden, während er nachdachte. Er schaltete den Fernseher ein und wieder aus. Schließlich zog er sich eine frische Jeans an, ein weites Kragenhemd mit Hawaii-Muster und sein einziges Sportsakko, braun, mit Schulterpolstern und Ellbogenflicken.
Mit dieser mutigen Kombination hatte er die nächste Disco angesteuert, das Azzurro. Und jetzt stand er hier, einen Arm an die Theke gelehnt, den anderen gegen die Wand. In einem Winkel eingeklemmt, in dem er unmöglich zu entdecken war. Von dort aus starrte er auf die Tanzfläche, die Augen angestrengt gegen das flackernde Licht geöffnet, und ließ seine Gedanken an Orte abschweifen, die sein Körper nie erreichen würde.
Girl, I’m sorry I was blind / but you were always on my mind.
Der Song ging langsam zu Ende. Sollte er sie ansprechen? Er sah sie mit den beiden Mädchen von der Tanzfläche gehen. Sie steuerten einen der Tische an, wo sie in einer Sitznische die Köpfe zusammensteckten und aufgeregt tuschelten. Er müsste einmal quer über die Tanzfläche, vorbei an den zuckenden und pulsierenden Körpern, vorbei am Geruch von Schweiß und Haarspray. Würde er es überhaupt so weit schaffen? Die Distanz schien ihm unüberwindbar. Doch hätte er sie erst einmal überwunden, dann stünde das Schwierigste noch bevor: das Gespräch. Darf ich mit dir tanzen? Willst du mit mir tanzen? Hättest du Lust zu tanzen? Was war die richtige Art, sie anzusprechen? Egal wie er es anstellen würde, es würde nicht gut genug sein.
Wie konnte er ihr begreiflich machen, dass er nicht einfach tanzen wollte, sondern dass er von allen Frauen hier nur mit ihr und mit ihr alleine tanzen wollte? Er hatte den ganzen Abend über die Tanzfläche beobachtet, doch nur von ihr hatte er den Blick nicht lassen können. Wenn eine Nummer zu Ende ging und er sie lachen sah, dann war er sich sicher, dass sie ein wunderbarer Mensch sein musste. Jetzt, wo er darüber nachdachte, wurde ihm klar, dass er eigentlich gar nicht mit ihr tanzen wollte. Er wollte mit ihr reden, sie zum Lachen bringen, er wollte, dass sie sich in ihn verliebte. Er wollte ein ganzes Leben an einem Abend.
Er nahm einen großen Schluck von seinem Bier, stellte es etwas zu kräftig am Tresen ab und stieß sich von der Wand ab, in Richtung des tumultartigen Gedränges. Er kämpfte sich durch Hände, Schultern, aneinandergepresste Münder. Die Tanzfläche war aus einem Meer aus wogenden Menschen zu einem Morast aus schwerfälligen Körpern geworden.
Endlich hatte er es geschafft. Orientierungslos torkelte er zu der Nische, in der sie sitzen musste. Er blieb vor dem Tisch stehen, an dem er sie vermutete. Doch als er den Blick hob, konnte er sie nicht sehen. Stattdessen lächelte ihm ein brünettes Mädchen mit haselnussbraunen Augen und zu viel Rouge entgegen.
»Na«, fragte sie, »möchtest du tanzen?«
»Deine Freundin«, brachte er heraus. »Kann ich … Kannst du mich vorstellen?«
Das Mädchen musterte ihn. »Welche Freundin meinst du denn?«
»Mit den blonden Locken und dem bordeauxroten Pullover.«
Kurz blickte ihn das Mädchen verdutzt an. Vermutlich war ihr selbst noch gar nicht aufgefallen, dass der Pullover bordeauxrot war. Wer achtete schon auf so ein Detail an einem Ort wie diesem?
Dann lachte sie auf. »Du meinst die Xandi. Na, ich weiß nicht. Warum stellst du dich nicht einfach selbst vor? Da kommt sie.«
Mit Entsetzen drehte er sich um und sah, wie sich das blonde Mädchen langsam auf sie zubewegte, in jeder Hand ein Glas Bier. Alle Worte, die er sich zurechtgelegt hatte, waren verschwunden. Alle Informationen, die er jemals über die sozialen Gepflogenheiten der Konversation zusammengetragen hatte, waren innerhalb eines Atemzugs ausgelöscht worden.
Ohne sich zu verabschieden, wich er zurück. Er stolperte Richtung Tanzfläche, prallte gegen einen Rücken und kam ins Straucheln. Er stammelte Entschuldigungen, die im Lärm unmöglich zu hören waren. Er schaffte es zurück zu seiner Ecke, wo das Bier genauso auf dem Tresen stand, wie er es zurückgelassen hatte.
Jetzt erst bemerkte er, wie stark sein Herz pochte. Seine Hände zitterten. Hatte er seine Chance vertan? Vermutlich würde die Brünette ihrer blonden Freundin erzählen, wie seltsam er sich verhalten hatte. Er fühlte sich wie der größte Idiot. In einem schnellen Zug trank er das Bier aus und bestellte mit wenigen Handzeichen noch eines. Die kühle Flüssigkeit beruhigte seine Nerven. Vermutlich hatte das Mädchen ihn gar nicht gesehen. Und wahrscheinlich hatte ihre Freundin ihn ebenfalls schon vergessen. Mit jedem Schluck gewann er ein Stück Sicherheit zurück.
Er beschwor noch einmal das Bild herauf, wie sie sich lächelnd auf der Tanzfläche bewegte. Alleine müsste er sie treffen, dann würde sie ihn bestimmt nicht ablehnen. Wenn sie alleine wären und er ihr erklären könnte, wie schön sie war, dann würde sie verstehen.
Als er mit seinen Gedanken wieder in den muffigen Innenraum des Azzurro zurückkehrte, mittlerweile spielte es eine Nummer von Michael Jackson, und seine Augen dorthin richtete, wo sie gerade noch gesessen war, war sie verschwunden. Er konnte ihre beiden Freundinnen sehen, darunter die Brünette, doch nicht sie. Er blickte zur Tanzfläche. War sie dort? Er konnte sie unter den flackernden Silhouetten nicht ausmachen. Hatte sie die Diskothek vielleicht verlassen? War das seine Chance?
Ohne recht darüber nachzudenken, stolperte er vorwärts. Sein Bier, das sechste oder siebente, ließ er achtlos auf der Theke zurück. Bereits nach wenigen Schritten spürte er die Wirkung des Alkohols, der Raum wirkte seltsam eng und verschwommen, sein Gehirn sendete Signale, die auf dem Weg zu seinen Beinen verlorengingen. Es war ein Wunder, dass er ohne Zusammenprall den Weg zur Garderobe fand.
Als er vor den Eingang trat, legte sich die Kälte um ihn wie ein Mantel aus Dornen. Es kam ihm nicht wie Oktober, sondern wie Mitte Dezember vor. Er blickte auf die Uhr und benötigte einige Momente, um die Position der Zeiger unter dem fahlen Licht einer Straßenlaterne richtig zu deuten. Fast halb drei Uhr früh.
Die breite Himberger Straße war beinahe menschenleer. Ein paar betrunkene Gäste der Disco taumelten noch darauf herum, in der Ferne waren vereinzelt Motorengeräusche und Lachen zu hören. Er blickte sich um. Wo konnte sie sein?
Ziellos begann er, die Himberger Straße stadteinwärts, in Richtung Favoritner Zentrum, zu gehen. Nur wenige Meter von der Disco entfernt lag die Straße verlassen vor ihm. Wie eine Oase des Lichts ragte linker Hand eine Tankstelle aus der Dunkelheit. Das Licht zog ihn magnetisch an.
Er fokussierte seinen Blick, und dann sah er sie: Ein paar Meter neben der Tankstelle war eine Telefonzelle. Und in dieser Telefonzelle stand sie. Die junge Frau mit den blonden Locken und dem bordeauxroten Rollkragenpullover, mittlerweile unter einer Lederjacke versteckt. Xandi. Alexandra?
Zaghaft ging er auf die Telefonzelle zu. Sein Kopf fühlte sich taub an. Er dachte nicht daran, wie das Bild auf sie wirken würde: ein nach Alkohol riechender Fremder, der mitten in der Nacht an eine Telefonzelle klopfte. In seinen Gedanken überwog die Gewissheit, dass sie ihn verstehen würde, dass sie ihn erkennen würde. Er war völlig fasziniert von ihr. Wie konnte ihr das nicht gefallen?
Er war nur noch wenige Meter von der Telefonzelle entfernt, sie hatte ihren Blick auf das schwarze Telefon gerichtet und bemerkte ihn nicht. Er war nun so nah, dass er sie hören konnte.
»Es ist so lieb von dir, dass du mich so spät noch abholen kommst. Sicher, dass es keine Umstände macht?«, sagte sie, und ihre Stimme war so, wie er sie sich vorgestellt hatte: weich, warm, verständnisvoll. »Du bist der Beste. Ich freu mich auch schon sehr, dich zu sehen. Ja, die Tankstelle beim Azzurro. Bis gleich«, sagte sie und fügte nach einer kurzen Pause hinzu: »Ja, ich dich auch. Bussi, Georg.«
Sie hängte den Hörer auf die Gabel und drehte sich um. Instinktiv sprang er zur Seite, hinter eine Plakatwand. Er hörte, wie ihre Absätze über den Asphalt klapperten und ihre Schritte sich langsam entfernten.
Er fühlte sich mit einem Mal ausgenüchtert. Als hätte ihm jemand einen Faustschlag versetzt und seinen Kopf danach in Eiswasser getaucht. Wer war dieser Georg? War das etwa ihr Freund? Doch wenn er ihr Freund war, wenn er sie liebte, wieso ließ er sie dann allein in eine Diskothek gehen? Wo doch jeder wusste, dass junge Frauen, besonders so schöne wie sie, unzähligen Gefahren ausgesetzt waren. Sie konnten angegriffen, ausgeraubt, verletzt oder, am schlimmsten, verführt werden. Hätte er so eine wunderschöne Freundin – wäre sie seine Freundin – er würde sie sicherlich nicht alleine ausgehen lassen. Er würde sie vor anderen Männern beschützen. Diesem Kerl war offenbar völlig egal, was sein Mädel spätnachts trieb. Das war für ihn Beweis genug, dass sie ihm nicht wichtig sein konnte. Sie hatte etwas Besseres verdient. Jemanden, der ständig auf sie aufpasste, der nicht von ihrer Seite wich, der sie keine Sekunde vergessen ließ, wie schön und schützenswert sie war. Jemanden wie ihn. Jemand, der sie nicht ausnützte, dem sie nicht egal war.
Langsam trat er hinter der Plakatwand hervor und in den Halbschatten, den die Tankstelle auf den Asphalt warf. Sie war etwa zwanzig Meter vor ihm. Sollte er sie vor diesem Typen warnen, der es offensichtlich nicht gut mit ihr meinte? Sollte er ihr beweisen, dass er viel mehr für sie tun würde? Dass er sie nicht so ungeschützt mitten in der Nacht eine leere Straße hinabspazieren lassen würde? Dass sie die Frau seiner Träume war?
Er musste sich schnell entscheiden. Nur noch wenige Augenblicke, und die Dunkelheit, die hinter den Kastanienbäumen begann und die Straße genauso wie die parkenden Autos in ein Reich jenseits seiner Kontrolle zog, würde sie verschlucken. Schon jetzt waren ihre blonden Locken, ihr wippender Gang, fast nicht mehr als ein flüchtiger Traum.
Er musste sich schnell entscheiden, sonst würde sie für immer fort sein.
PULLOVER
2000
Donnerstag, 14. SeptemberBerggasse, Wien-Alsergrund
Das Hemd klebte an meiner Brust. Ich warf einen Blick zum Fenster, um sicherzugehen, dass es auch wirklich geöffnet war. Was kurzfristig Erleichterung versprochen hatte, war mittlerweile der Grund, dass sich mein Büro in einen spätsommerlichen Hochofen verwandelte.
Es war Dienstagnachmittag, und ich war den ganzen Tag mit dem Lesen, Korrigieren und Genehmigen von Akten beschäftigt gewesen. Nicht gerade die spannendste Arbeit für einen Polizisten. Und dennoch sah meine Hauptbeschäftigung genau so aus.
Als stellvertretender Vorstand des Sicherheitsbüros, der Zentralstelle der Wiener Kriminalpolizei, zuständig für schwere Straftaten, wurde ich von allen Referaten über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten und überwachte, ob auch keine Ermittlungsfehler begangen wurden. Seit fast zehn Jahren hatte ich diesen Posten jetzt schon inne, und mit jedem Jahr hatte ich mich etwas weiter von der Ermittlungsarbeit des Kriminalbeamten entfernt und zur Verwaltungsarbeit bewegt. Eine ausgesprochen wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, doch wie gut ich sie auch ausführte, sie war niemals mit dem Gefühl zu vergleichen, sich durch undurchsichtige Motive und scheinbar wasserdichte Alibis zu kämpfen.
Ich schloss den letzten Akt für heute. Es handelte sich um ein Drogendelikt. Vor etwas mehr als einem Jahr hatten wir mit der großangelegten Operation Spring einen Drogenring aus Nigeria hochgehen lassen. Es war das Ende eines langen und langwierigen Kampfes gegen den Handel mit Rauschgift, der in den neunziger Jahren aufgekommen war. Noch immer mussten wir uns mit den Nachwehen herumschlagen. Es war eine zermürbende Arbeit, denn Kokain und Heroin waren Waffen, die sehr viel langsamer wirkten als Messer oder Pistolen. Sie brachten einen schleichenden Tod, der ein Leben nicht auf einen Schlag auslöschte, sondern langsam zerrieb. Vor allem junge Menschen waren betroffen, nicht selten wurde vor Schulen oder Spielplätzen gedealt. So wichtig die Bekämpfung von Drogenkriminalität war, so wenig lag sie mir.
In dieser Hinsicht war das vergangene Jahrzehnt besser gewesen. Die achtziger Jahre waren das Jahrzehnt der Banküberfälle gewesen. Bankräuber waren vielschichtig, vom hochverschuldeten Amateur, der aus Verzweiflung eine Bank ausraubte, bis zum Berufskriminellen war alles dabei. Kein Raubüberfall glich dem anderen, jedes Mal sah man sich neuen Herausforderungen ausgesetzt, und während die Überfälle immer verwegener wurden, mussten auch wir immer schneller handeln. Die Achtziger waren also das Jahrzehnt der Bankräuber gewesen, die Neunziger das der Drogen.
Was stand uns wohl im nächsten Jahrzehnt bevor?
Ich stand auf und trat zum Fenster. Als ich es schließen wollte, hielt ich inne und blickte aus dem ersten Stock auf den Donaukanal hinab, der hinter der Rossauer Lände vorbeizog. Das leise Brummen von Motoren und Gesprächsfetzen wurden von Hitzewellen heraufgetragen. Eine Trägheit schwappte mir entgegen, die man nur zu leicht mit Ruhe verwechseln konnte.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah ich eine Gruppe junger Leute gehen, sie lachten und trugen Schilder, zwei von ihnen schleppten sogar ein zusammengerolltes Banner. Ich konnte lesen, was auf den Schildern stand. »Gegen ein rechtsextremes Österreich«, war auf einem zu lesen, auf dem anderen: »Nieder mit Schwarz-Blau.«
Die Plakate erinnerten mich daran, wie turbulent dieses Jahr gewesen war. Von Ruhe konnte da keine Rede sein. Seit Februar gab es nach langen, schwierigen Koalitionsverhandlungen eine Regierung aus der konservativen ÖVP und der rechten FPÖ. Das hatte nicht nur in der Gesellschaft für ein kleines Erdbeben gesorgt, sondern auch bei der Polizei.
Seit Monaten waren unsere Leute im Dauereinsatz, um die wöchentlich stattfindenden Donnerstagsdemonstrationen gegen die Regierung zu begleiten. Mittlerweile war die Teilnehmerzahl zurückgegangen, aber wir mussten ständig mit neuen, kreativen Aktionen der Demonstranten rechnen.
Dabei waren die Zeiten innerhalb der Polizei nicht weniger stürmisch als auf den Straßen der Republik. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es eine politische Gewichtung innerhalb der Polizei, die so unumstößlich wie inoffiziell war. Die Gendarmerie auf dem Land war schwarz, also ÖVP-nah, die Polizei in Wien war rot, hatte also eine Nähe zur Sozialdemokratischen Partei. Diese Verteilung war so normal geworden, dass wir fast schon vergessen hatten, dass es sie überhaupt gab.
Doch mit einem Schlag war alles anders geworden. Der neue Innenminister Ernst Strasser hatte einiges vor: Er wollte Gendarmerie und Polizei zusammenlegen, das Polizeiwesen modernisieren, ein Bundeskriminalamt und ein Bundesamt für Verfassungsschutz einrichten. Jeder, egal wie ranghoch, musste sich um seinen Posten neu bewerben. Angst hatte sich in unseren Gängen breit gemacht. Wer würde nächstes Jahr noch dort sein, wo er heute war?
Selbst beim Chef war Anspannung zu spüren. Max Edelbacher, von allen außer Hörweite nur Edelmax genannt, sonst ein angenehmer Vorgesetzter, der einen stets mit einem Lächeln begrüßte, eilte dieser Tage mit sorgenvoller Miene von einer Besprechung zur nächsten. Andere Zeiten zogen auf. Immer wieder waren die Worte »Abbau« und »Zusammenlegung« zu hören. Der Polizeiapparat sollte »effizienter« gestaltet werden. Dass dabei auch gleich ein paar Führungspositionen verändert werden würden, konnte man sich denken. Und Edelbacher als alter Sozialdemokrat, der mit Kritik an politischem Vorgehen nicht hinterm Berg hielt, passte nicht in die Pläne der neuen Regierung.
Dabei war er eine Institution im Haus, er leitete »die Berggasse«, wie die Zentrale des Sicherheitsbüros in der Berggasse genannt wurde, schon eine gefühlte Ewigkeit. Er brachte unglaubliche Kompetenzen mit und war bereits vor vielen Jahren in den USA gewesen, um sich bei der Chicago Police etwas für die österreichische Polizeiarbeit abzuschauen. Mit seinem buschigen Schnauzer und der fliehenden Stirn war er nicht nur eine auffällige Erscheinung, sondern auch ein angenehmer Chef, vernünftig und interessiert an neuen Entwicklungen, doch ihm fehlte das diplomatische Fingerspitzengefühl, das man in solchen Zeiten brauchte. Wenn selbst sein Sessel wackelte, wer war dann noch sicher?
Ich zwang meine Gedanken in die trockene Luft meines Büros zurück. Vielleicht sollte ich mich um ein paar Pflanzen bemühen. In meinem großen Büro dominierte ein schwerer, alter Eichenholzschreibtisch den Raum, ein Computer thronte darauf. Vor wenigen Jahren hatte er die elektrische Schreibmaschine abgelöst, und ich hatte mich immer noch nicht ganz an diese neue Technologie gewöhnt.
Graue Büromöbel, der klassische Beamtenstil, und ein paar Aktenschränke vervollständigten den Raum. Nicht besonders imposant, aber alles, was ein guter Polizist brauchte. Dieser Tage wurde viel zu viel Energie auf politische Scharmützel verwendet und viel zu wenig für ehrliche Polizeiarbeit.
Ich nahm mein Sakko, das ich heute nicht länger als nötig angehabt hatte, und legte es mir über den linken Unterarm. In der rechten Hand trug ich meinen Aktenkoffer. Als ich in den Vorraum trat, blickte Trudi, meine Sekretärin, auf. Seit meiner Beförderung zum stellvertretenden Leiter war sie zu meiner fleißigsten Mitarbeiterin geworden. Sie verfluchte die moderne Technik mindestens genauso oft wie ich, doch im Gegensatz zu mir schaffte sie es mit Hartnäckigkeit und Geduld, sich jeden Computer untertan zu machen.
»Sie machen Schluss für heute?«, fragte sie.
»Ja, sieht so aus«, antwortete ich. Ich wollte schon durch die Tür auf den Gang treten, da rief sie mich noch einmal zurück.
»Ich soll Sie daran erinnern, noch eine Flasche Wein zu besorgen«, sagte sie pflichtbewusst. »Blaufränkisch, wenn möglich. Fürs Abendessen heute. Ihre Frau hat angerufen.«
Ich brachte ein schiefes Lächeln zustande. »Danke, Trudi«, sagte ich. Ich nickte ihr zu und schloss leise die Tür hinter mir.
Die langen Nächte, in denen ich mit Kollegen über mögliche Tathergänge und Verdächtige nachgedacht hatte, und aus denen wir mit dem unwiderstehlichen Körperduft aus Kaffee und Zigaretten am nächsten Morgen durch die Bürokorridore streiften, waren in den letzten Jahren ruhigen und entspannten Abenden mit meiner Frau Eva gewichen. Die meiste Zeit genoss ich diese Insel der Ruhe, die völlig frei von den Schrecken und menschlichen Abgründen war, die mich in meiner Arbeit ständig begleiteten. Es war heilsamer als irgendeine andere bekannte Verarbeitungsstrategie, sei es Psychotherapie oder Alkohol.
Aber an manchen Tagen packte mich eine Schwermut, und ich dachte an die Tage im Mordreferat zurück. Wir waren zu oft überspannt gewesen, ständig mussten wir gegen die Zeit arbeiten, doch die Aufregung wirkte wie ein Rausch. Nach meiner Beförderung zum stellvertretenden Vorstand des Sicherheitsbüros war es mir zumindest gelungen, meinen Posten als Leiter der Mordkommission zu behalten. Wenigstens blieb ich so immer auf dem neuesten Stand und konnte meine Überlegungen bei Ermittlungen einbringen, aber die Laufarbeit blieb mir meistens erspart.
Ich trat durch das schwere Tor der Berggasse ins Freie. Ein leichter Windstoß empfing mich und befreite mich von den letzten Resten Melancholie. Ich nahm mir vor, durch den Votivpark und die Alser Straße hinaufzuspazieren. In der Lange Gasse gab es eine kleine Vinothek, in der sich bestimmt ein guter Blaufränkischer würde finden lassen.
Langsam durchquerte ich den Park, in dem Studenten auf der Wiese lagen und die sich langsam zurückziehenden Sonnenstrahlen genossen.
Für eine Weile ließ ich meinen Blick auf den neugotischen Türmen der Votivkirche ruhen. Sie erinnerte mit ihrem kargen Sandstein und den spitz zulaufenden Streben an ein Skelett. Und tatsächlich wurde ihr Bau gewissermaßen mit einer Leiche bezahlt. 1853 versuchte ein ungarischer Schneider, Kaiser Franz Joseph bei einem seiner Spaziergänge zu erstechen, nachdem der Kaiser Aufstände in Ungarn brutal niedergeschlagen hatte. Das Attentat scheiterte und aus Dank für des Kaisers unversehrte Gesundheit wurde die Votivkirche erbaut.
Der Schneider, János Libényi, wurde natürlich kurz darauf gehängt. Die Exekutive arbeitete damals eben noch mit anderen Mitteln.
Ein Klingeln ließ mich innehalten. Kurz blickte ich desorientiert durch die Gegend, bis ich bemerkte, dass das Geräusch aus meiner Hosentasche kam. Ich zog mein Nokia heraus und hob ab.
»Geiger.«
»Ernst, wo bist du?«
Ich erkannte sofort die Stimme meines langjährigen Kollegen Ewald »Eddie« Müller. Seit meinen ersten Tagen im Mordreferat hatten wir viele Fälle gemeinsam bearbeitet. In den vergangenen Jahren hatte er sich verstärkt den Cold Cases zugewandt, also Fällen, die wir ungelöst zu den Akten hatten legen müssen. Besonders durch das Aufkommen neuer Technologien wie DNA-Analyse war dieses Konzept aus den USA zu uns gekommen, doch das Sicherheitsbüro hatte weder die finanziellen noch die personellen Ressourcen, um daraus eine eigene Abteilung zu machen. Also ging Eddie alten Spuren meist in seiner freien Zeit nach.
Polizeiarbeit ist wohl der einzige Beruf auf der Welt, der zugleich das befriedigendste und das unbefriedigendste Gefühl vermitteln kann.
Versucht man das Rätsel zu lösen, hinter dem sich die Wahrheit eines Verbrechens verbirgt, setzt man unzählige kleine Mosaiksteinchen zusammen. Die Erkenntnis kündigt sich in leisen, unhörbaren Schritten an, findet im Hinterkopf statt. Sie klopft nicht an, sondern stürmt unangekündigt herein. Und dann steht man plötzlich vor einem Durchbruch, und mit einem Schlag findet alles Fragen, Suchen und Überlegen ein Ende. Warum ist wohl der Krimi die beliebteste Literaturgattung, die es gibt? Abgesehen davon, dass die Polizisten darin meistens auf völlig unrealistische Weise arbeiten, gibt er den Lesern etwas, was sie in ihrem Leben zu oft vermissen: das Gefühl der Abgeschlossenheit, das sich einstellt, wenn die großen Fragen, also Wer, Warum, Wie, endlich bis ins letzte Detail aufgeklärt werden.
Doch wenn wir einen Fall nicht lösen konnten, dann konnte uns diese Unabgeschlossenheit wahnsinnig machen. Dann saßen wir unzählige Nächte zusammen und hingen unseren eigenen Theorien nach. Und mit jedem Tag, der verging, wurde die Gewissheit größer, dass uns eine Wahrheit, die wir hätten aufdecken können, für immer entglitten war. Ich konnte also nachfühlen, warum Eddie in diesen alten Akten wühlte. Ob es gesund war, der Vergangenheit so viel Platz einzuräumen, war eine andere Sache.
»Ich stehe vor der Votivkirche«, antwortete ich. »Bin gerade auf dem Weg zu dieser kleinen Vinothek in der Lange Gasse, kennst du die?«
»Du holst Wein? Für die Arbeit oder privat?« Ich hörte Belustigung in Eddies Stimme.
»Heutzutage trinke ich nur noch zu Hause, so ist das in den höheren Etagen. Aber du rufst doch nicht an, um meine Abendpläne zu erfahren?«
»Nein«, sagte Eddie und seine Stimme nahm plötzlich einen Ton an, den ich kannte. Diesen Ernst legte er nur dann in seine Stimme, wenn er absolut notwendig war. Wenn es um Mord ging.
»Wir haben etwas gefunden, was du dir anschauen solltest, Ernst. Dringend.«
»Klar, Trudi sollte noch da sein, leg es einfach auf ihren Schreibtisch und …«
»Nein«, unterbrach mich Eddie. »Sofort.«
»Sofort? Eddie, ich habe Eva heute einen gemütlichen Abend versprochen, Pasta und Rotwein …«
»Ruf sie an«, sagte Eddie bestimmt. »Sag ihr, dass ihr das Essen verschieben müsst.«
»Was zum Teufel ist denn los?«
»Nationalfeiertag 1988«, sagte Eddie nur. »Kannst du dich an den Tag erinnern?«
Plötzlich war die Votivkirche verschwunden, der Park mit den Studenten hatte sich aufgelöst, und selbst die drückende Wärme des Spätsommers war meiner Erinnerung gewichen. Mit einem Mal war es klirrend kalt geworden, ich sah ein verblichenes Werbeplakat vor mir und spürte, was dahinter lag. Es war ein Ort, den ich seit nunmehr fast zehn Jahren kaum noch besucht hatte, nicht einmal in meiner Erinnerung erlaubte ich mir, dorthin zurückzukehren. Nur meine Träume entführten mich manchmal an diese Stelle. In den schlimmen Nächten.
»Ich bin in fünf Minuten bei dir«, sagte ich nur und legte auf.
Nachdem ich meiner Frau Bescheid gegeben hatte, drehte ich mich um und lief den Weg zurück, den ich gerade gekommen war.
Das Gefühl, das mich überrollte wie eine brechende Welle, war mir bekannt. Es war ein Riss, der sich in der Gegenwart aufgetan hatte und einen Blick in die Vergangenheit erlaubte. Und was dieser Blick freizugeben versprach, waren die Antworten auf die großen Fragen.
Es war die Chance auf Erkenntnis.
1988
Mittwoch, 26. OktoberLainzer Tiergarten, Wien-Hietzing
Laufen ist kein Sport. Es ist Konzentration in Bewegung. Der ganze Körper gehorcht einem einzigen Rhythmus: das flache Einatmen, das lange Ausatmen; die Beine, die den Körper in perfekter Synchronisation über den Boden tragen; selbst die Arme schießen gegengleich vor und zurück, als würden sie den Läufer durch die Luft ziehen. Das Faszinierende am Laufen ist der Moment, in dem alles zu kippen beginnt. An dem das Laufen zur einzig vorstellbaren Aktivität wird. Plötzlich ist der Lauf kein Mittel zum Zweck, keine Fortbewegung von einem Punkt zum anderen. Er ist zum Zentrum aller Gedanken geworden. An diesem Punkt hat die Bewegung alles eingenommen, jede andere Möglichkeit verdrängt. Gäbe es keine Ziellinie, die den Läufer gewaltsam in die Wirklichkeit aus Jubel und Gratulanten und Schulterklopfer zurückholt, er würde niemals stehen bleiben. Immer weiterlaufen.
Ich spürte den Zustand dieses Rausches herannahen, als mich der Piepser aus dem Korridor riss, zu dem sich meine Wahrnehmung verengt hatte. Meine Schritte verlangsamten sich, bis ich am Wegesrand zum Stehen kam. Ich holte einige Male tief Luft, um meinen Puls zu senken. Langsam blickte ich mich um, während Menschen an mir vorbeiliefen. Vermutlich hatte ich gerade mal die Hälfte der Strecke durch den Lainzer Tiergarten zurückgelegt, etwa fünf von zehn Kilometern. Ich beneidete die Kollegen nicht, die gerade zu irgendwelchen Paraden unterwegs waren, um dort dafür zu sorgen, dass die Neutralität der Republik Österreich ohne Zwischenfälle gefeiert werden konnte. Ich hatte an diesem Feiertag nur Bereitschaftsdienst und mich deshalb für einen Lauf durch den Lainzer Tiergarten angemeldet, ein großes Waldgebiet, das vom Westen Wiens bis in das benachbarte Niederösterreich hineinragt. Unter den Habsburgern noch als Jagdrevier genutzt, lebten nun Hirsche und Wildschweine frei im Tiergarten. Es war ein Ort der Ruhe und Entspannung.
Da ich am Feiertag auf Abruf war, hatte ich einen Piepser für Notfälle dabei. Offenbar war ein solcher eingetreten.
Ich blickte auf. Keine zwanzig Meter von mir entfernt sah ich eine Wildschweinfamilie zwischen ein paar Bäumen hindurchspazieren.
Ich seufzte, und mein Atem stieg als Wolke in den kühlen Oktoberhimmel. Mit dem Laufen hatte ich aus einem ganz pragmatischen Grund begonnen. Im Polizeidienst waren Bier, Wein und Zigaretten genauso dienstüblich wie eine Käsekrainer, eine Wurstsemmel oder ähnlich nahrhafte Mahlzeiten. Die Rechnung war einfach: je größer der Stress, desto ungesünder die Lebensweise. Und in der Berggasse, der Zentrale des Sicherheitsbüros, noch dazu im Referat für Mord, war der abendliche Absacker schon lange ein gut gepflegtes Ritual, und der Geruch von schwerem Zigarrettenrauch war so sehr Teil der Möbel, dass ungeübte Besucher husten mussten, wenn sie sich in einen Sessel sinken ließen.
Natürlich trank und rauchte ich auch, das gehörte beinahe schon zur Berufsbeschreibung. Aber das Laufen war mein Ausgleich, mein persönlicher Zufluchtsort. Es half mir, den Kopf freizubekommen. Wer sich bewegte, blieb nicht bei einer Erinnerung oder einem Erlebnis stehen. Weitergehen, das war eine Fähigkeit, die man im Mordreferat schnell lernen musste.
Mit einem Knopfdruck brachte ich den Piepser zum Schweigen.
Ich warf noch einen Blick Richtung Waldrand. Ein großes, fettes Wildschwein blickte zwischen den Bäumen hervor, die kleinen, schwarzen Knopfaugen starrten mir entgegen, aber nicht feindselig, sondern seltsam versöhnlich.
Ich atmete noch einmal tief aus und sammelte meine Kräfte. Dann, bevor die Kälte in meine Muskeln kriechen konnte, lief ich zügig in Richtung des nächsten Ausgangs.
Die Zentrale des Sicherheitsbüros lag an der Ecke Rossauer Lände/Berggasse. Die Fassade des Komplexes, um die Jahrhundertwende entstanden, war weiß und mit schlanken Linien relativ nüchtern gehalten, die ganze Aufmerksamkeit lag auf dem Haupteingang: Ein Eckturm ragte knapp vierzig Meter in die Höhe und schloss mit einer Kuppel ab, die an die Baukunst der Secession erinnert. Während die Rossauer Kaserne ein paar Meter weiter mit ihren Backsteinen eher an die berühmte Rote Burg in Berlin erinnert, in der im frühen 20. Jahrhundert die Polizeiarbeit revolutioniert wurde, brauchte sich auch die Berggasse nicht zu verstecken. Die Ermittlungserfolge der österreichischen Polizei erlaubten durchaus einen Vergleich mit der Roten Burg, die während der Weimarer Republik ein Vorbild für die internationale Polizeiarbeit gewesen war.
Ich eilte in mein Büro, zog mir die nassgeschwitzten Laufsachen aus und einen grauen Anzug an, den ich für Notfälle dort aufbewahrte.
Während ich mich umzog, trat Eddie Müller hinter mich. Ich konnte sein Aftershave beinahe auf einen Kilometer Entfernung riechen.
»Bist du heute auf Abruf?«
»Sieht ganz so aus«, sagte ich, während ich mir meine Walther PPK in den Holster steckte.
Ich drehte mich um. Eddies schwarzes Haar fiel ihm wild in die Stirn, und seine Augen deuteten darauf hin, dass ihm einige Stunden Schlaf fehlten. Sein athletischer Körper bewegte sich hektisch, ruckartig. Er wirkte, als wäre er gerade von der Polizeischule gekommen, und tatsächlich war er erst einige Wochen im Mordreferat.
Als er in mein Büro gekommen war, um sich vorzustellen, war er mir auf Anhieb sympathisch gewesen.
»Wenn du glaubst, du hast schon alles gesehen«, hatte ich ihm nach der kurzen Vorstellung mit auf den Weg gegeben, »dann schicken sie dich ins Mordreferat.«
»Warum?«, hatte er gefragt und dabei selbstsicher gelächelt, wie das bei jungen Polizeibeamten gerne mal vorkommt. »Damit du dann den Rest siehst?«
»Nein«, hatte ich ihm geantwortet. »Damit du erkennst, wie begrenzt deine Vorstellungen sind.«
Er hatte mich nur angeschaut und nicht genau gewusst, was ich damit meinte.
»Das war es wohl mit deinem freien Tag«, sagte Eddie.
»Mal abwarten«, sagte ich. »Vielleicht falscher Alarm.«
»Du hast es also noch nicht gehört?«, fragte er.
»Nein, was?«
»Im Studium hast du sowas jedenfalls sicher noch nicht gesehen«, sagte er nur. Es war mittlerweile Tradition geworden, mein Studium zur Sprache zu bringen. Normalerweise hätte Eddie als rangniedrigerer Kollege nicht so große Töne spucken dürfen, aber wir hatten uns in den wenigen Wochen bereits gut angefreundet. Das Mordreferat war eine kleine Truppe, und dessen Mitglieder arbeiteten noch enger zusammen als in andere Gruppen. Wir waren ein eingeschworener Haufen und konnten uns aufeinander verlassen. Hierarchien waren nicht mehr so wichtig, wenn einen nachts die gleichen Bilder wach hielten. Dann entwickelte man ganz automatisch ein Verständnis füreinander.
»Du würdest dich wundern, was man dort alles lernt«, sagte ich nur.
Ich hatte nicht den klassischen polizeilichen Berufspfad zurückgelegt, sondern mich erst nach dem Studium der Rechtswissenschaften dazu entschlossen, eine Karriere als Gesetzeshüter einzuschlagen. Als Polizeijurist nahm ich eine gewisse Sonderrolle ein. Ich bekleidete die Rolle eines Oberkommissärs und war gegenüber Polizeibeamten weisungsbefugt.
Ich folgte Eddie nach draußen, wo wir in einen Streifenwagen stiegen. Kaum hatte ich mich angeschnallt, schaltete er das Blaulicht ein. Ich warf ihm einen Blick zu. Weil wir meist an einen Tatort kamen, wenn das Verbrechen bereits begangen worden war, brauchten wir derartige Effekte für gewöhnlich nicht.
Eddies Miene war unbewegt. Ich entschied, ihn nicht weiter zu drängen. In wenigen Minuten würde ich ohnehin wissen, was los war.
Wir rasten den Donaukanal Richtung Erdberg entlang. Eddie blickte stur auf die Straße. Autos fuhren auf die Randsteine auf, um uns Platz zu machen.
Ich dachte an die paradoxe Situation, in der wir uns befanden. Wir nahmen unsere Ermittlungen auf, wenn wir dem Opfer schon nicht mehr helfen konnten, denn das war für gewöhnlich tot. Doch unsere Pflicht erstreckte sich über das Opfer hinaus, es war eine Pflicht der Gesellschaft gegenüber: einen Menschen zu finden, der gegen das grundlegendste Prinzip unseres Rechtsstaats verstoßen hatte. Einen Menschen, der einen anderen umgebracht hatte. Die Jagd nach Mördern hatte jedoch etwas von einer Katze, die ihren Schwanz zu fangen versucht. Wir liefen etwas hinterher, was letztlich immer uneinholbar hinter uns lag.
Für gewöhnlich plagten mich solche Gedanken nicht. Ich war mittlerweile geübt darin, meine Arbeit professionell und ohne große gedankliche Abschweifungen auszuführen. Aber es beunruhigte mich, als ich sah, wie fest Eddie das Lenkrad umklammert hielt. Die Adern auf seinen Handrücken traten deutlich hervor.
Er bog scharf ab. Wir überquerten den Donaukanal und fuhren die Tangente bis zum Verteilerkreis entlang. Das Schweigen begleitete unsere Fahrt wie eine böse Vorahnung.
Was erwartete ich? Das Übliche. Die meisten Gewaltverbrechen mit Todesfolge finden in einem kleinen Kreis statt, innerhalb der Familie oder zwischen Bekannten. Manchmal kommt es zu Schlägereien oder Überfällen, die tödlich enden. Oftmals handeln die Täter dabei impulsiv, unüberlegt und hinterlassen Spuren. Wir hatten zu dieser Zeit vielleicht vierzig bis fünfzig vollendete Tötungsdelikte jährlich. Wir klärten natürlich nicht alle auf, aber genug. Ich war 1982 ins Sicherheitsbüro gekommen und erst seit einigen Jahren im Mordreferat tätig. Doch Tatorte mit unschönen Szenen waren schnell zum Bestandteil meines Berufs geworden. Ich hatte mich daran gewöhnt. Und genau das erwartete ich auch von diesem hier.
Ein guter Ermittler lernt, dass er zunächst mit dem wahrscheinlichsten, dem einfachsten Fall rechnen soll. Immerhin ist das Leben kein Sherlock-Holmes-Roman. Menschen sind keine raffinierten Meisterverbrecher, die elaborierte Mordpläne ersinnen. Doch manchmal können sie noch viel schlimmer sein. Manchmal sind sie Bestien, Monster, die alles Zivilisierte abwerfen. Sie bringen etwas zum Vorschein, was sich die guten Bürger gar nicht vorstellen können, sich gar nicht vorstellen dürfen. Denn diese Bestien führen uns eindrucksvoll vor, wie fragil das Gerüst der Gesellschaft ist.
Wir passierten den Verteilerkreis und fuhren die Himberger Straße entlang, die durch den zehnten Wiener Gemeindebezirk, Favoriten, führte. Gemeindebauten zogen vorüber, vereinzelt hingen rotweiß-rote Fahnen aus den Fenstern, um dem Nationalfeiertag Respekt zu erweisen.
Was die Menschen, die wir jagten, zum Vorschein brachten, war die dünne Grenze zwischen Ordnung und Chaos. Die meisten von uns halten sich ihr ganzes Leben lang an die gesellschaftlich akzeptierten Normen und Gesetze. Auch wenn wir noch nie einen Blick in Gesetzestexte geworfen haben, wissen wir, was wir tun dürfen und was nicht. Wir kennen den Unterschied zwischen Recht und Unrecht ganz instinktiv.
Doch einige wenige unter uns durchbrechen diese Grenze und entlarven sie als Illusion. Eine überlebenswichtige Illusion zwar, die aber jeden Tag aufs Neue in Gefahr ist, ignoriert, überschritten, zerrissen zu werden. Und genau diese Fälle waren mein Beruf.
Eddie setzte einen Blinker und fuhr mit dem Polizeiauto an den Bordsteinrand. Das Blaulicht ließ er eingeschaltet. Neben uns ragte eine Plakatwand empor, das Blech rostig, das Plakat darauf verblichen. Es zeigte eine Familie in bester Vorstadt-Idylle: Vater, Mutter, zwei Kinder. Bloß war das Papier so spröde geworden, dass die Gesichter der Eltern seltsam verzerrt waren, Grimassen, die auf den Betrachter hinabstarrten. »Genießen Sie die Wärme des Sommers«, stand dort. Offenbar die Werbung für einen neuen Gartengrill.
Zwischen Straßenrand und Gehsteig war ein kleiner Streifen Gras, auf dem Bäume standen, die im kalten Oktober bereits ihre Blätter verloren hatten. Wir sahen in einigen Metern Entfernung zwei andere Polizeiwagen stehen, darunter den »Mordwagen«, einen Fiat Ducato, in dem sich Material zur Spurensicherung, aber auch ein Klapptisch und eine Schreibmaschine befanden, sodass wir bereits am Tatort mit der Dokumentation beginnen konnten.
Ich erkannte auch den Mercedes von Dr. Ruben, dem Gerichtsmediziner.
Ein Polizist hatte uns entdeckt und kam uns entgegen.
»Dr. Geiger«, begrüßte er mich. »Eddie«, nickte er meinem Partner zu.
»Was haben wir hier?«, fragte ich.
Der Polizist, ein junger Mann mit wachen Augen und hellblonden Haaren, schien nicht so recht zu wissen, was er uns sagen sollte. Sein Blick richtete sich auf seine Zehenspitzen.
»Am besten, Sie schauen sich das selbst an«, sagte er. »Hinter der Plakatwand …« Es schien, als wolle er noch etwas hinzufügen, also wartete ich.
Endlich hob er den Blick. In seinen Augen glaubte ich Unverständnis zu sehen, als würde sein Verstand verzweifelt versuchen, Informationen zu verarbeiten, die aber mit keiner ihm bekannten Methode einzuordnen waren.
»Ich will Sie nur warnen«, sagte er endlich und schluckte danach schwer, als müsste er etwas unterdrücken. »Sowas hat hier noch niemand gesehen.«
Eddie warf mir einen Blick zu. Ob er an unser erstes Gespräch dachte? War dies ein Bild, das er sich nicht hatte vorstellen können?
Ich nickte ihm zu. Dann traten wir hinter die Plakatwand.
Das Erste, was mir auffiel, war der bordeauxrote Pullover. Als hätte jemand einen einzigen Farbklecks in dieses triste Bild geworfen, um der Grausamkeit etwas entgegenzusetzen. Doch das führte bloß dazu, dass ich plötzlich eine Verzweiflung spürte, die mich zu überwältigen drohte. Es dauerte jedoch nur einen Augenblick, dann war die Empfindung vorüber.
Ich betrachtete den Tatort. Der Polizist hatte uns hinter eine der Blechwände geführt. Dort befand sich ein Areal von etwa zehn Meter Breite und dreißig Meter Länge. Gras und Büsche hatten sich im Wildwuchs diesen kleinen Fleck zwischen Asphalt und Blech zurückgeholt und hielten ihn trotzig besetzt. Einige Hagebuttensträucher und Rosenhecken fristeten ein tristes Dasein und zeugten von einer Natur, die sich bereits seit langer Zeit in Auflösung befand.
Beinahe exakt in der Mitte dieses Rechtecks, die Symmetrie spottete dem Grauen des Ortes, wuchs ein kleiner, kahler Baum aus dem Boden. Er trug bloß einige dünne Äste und kaum Blätter. An diesen Baum war sie gebunden worden.
Der erste klare Gedanke, den ich fassen konnte, war: Das ist eine Inszenierung. Ich schauderte.
Bei den meisten Morden handelt es sich um Beziehungsdelikte, es besteht also eine Verbindung zwischen dem Täter und seinem Opfer. Ein Streit, der außer Kontrolle gerät, oder ein Schlag, der härter ausfällt, als man sich das selbst hätte vorstellen können. Es ist eine Tat im Rausch, im Affekt, beherrscht von animalischen Trieben. Im Angesicht des Todes jedoch verfallen die meisten Täter in eine Phase des Schocks, den man mit Ruhe verwechseln könnte. Sie versuchen, ihre Opfer irgendwie zu verstecken, je nach Tatort begraben sie es unter Blättern und Zweigen, legen es in einen Kellerschacht oder an einen anderen weniger zugänglichen Ort. Sie versuchen so, einen Vorsprung vor der Polizei zu gewinnen. Vielleicht sind manche auch von der irrationalen Hoffnung getrieben, dass sie den Mord ungeschehen machen können, wenn die Leiche nur niemals gefunden wird.
Doch das hier war anders. Hier hatte jemand einen Menschen auf grausame Weise zu Tode gebracht und danach keinen Ekel, keine Abscheu empfunden. Der Täter war geblieben und hatte sich die Zeit genommen, den Ort seines Verbrechens herzurichten. Was hier vor mir lag, hatte eine Weile gedauert. Es war Arbeit gewesen.
Die junge Frau saß an den Baumstamm gelehnt, die Füße in einer Grätsche nach vorne ausgestreckt. Ihr Blick war gesenkt, zwischen die Beine gerichtet. Sie war völlig nackt. Mit ihrem Pullover und ihrer Strumpfhose war ihr Hals an den kahlen Baumstamm gebunden, sodass sie in dieser Position verharren musste. Alles an diesem Bild, vom Winkel des Kopfes bis zur Position der Beine, war arrangiert. Sie sollte genauso gefunden werden.
»Angriff gegen den Hals«, riss mich die tiefe, schleppende Stimme von Dr. Ruben aus meinen Gedanken. Der Gerichtsmediziner war zusammen mit dem Erkennungsdienst offenbar schon einige Zeit hier, doch ich bemerkte die Kollegen erst jetzt.
Die Abteilung Erkennungsdienst, Kriminaltechnik und Fahndung, kurz EKF, hatte bereits mit der Spurensicherung begonnen. Die Arbeit der EKF-Beamten bestand gewöhnlich darin, Fotos zu schießen, Entfernungen abzumessen, mögliche Beweise einzusammeln und den Tatort auf Schuhabdrücke zu untersuchen. Dr. Ruben inspizierte währenddessen die Opfer und gab eine erste Einschätzung ab.
So auch hier. »Sie ist erdrosselt worden«, erklärte Dr. Ruben. Er war ein älterer, stets elegant gekleideter Herr, der dennoch den Eindruck machte, immer am falschen Ort zu sein. Oft stand er gedankenverloren in der Gegend und betrachtete die Szenerie, als wüsste er nicht genau, wo er sich befand. Er war bereits seit Jahrzehnten als Gerichtsmediziner tätig und Herrscher der Sensengasse Nr. 2, wo sich das Institut befand. Wenn ich an den alten Mann inmitten der Leichenberge dachte, kam mir Hades in den Sinn, der griechische Gott der Unterwelt.
Dr. Ruben sah die Leiche mit schiefem Blick an, als würde er abzuschätzen versuchen, was da vor ihm lag. Diesmal machte ich ihm keine Vorwürfe für seine Zerstreutheit.
»Vermutlich hat der Täter versucht, sie zu vergewaltigen«, fuhr er fort. »Soweit wir sehen können, weist sie keine Abwehrverletzungen auf. Wir können davon ausgehen, dass der Täter viel stärker als sein Opfer war.«
»Gott«, sagte Eddie und verbarg sein Gesicht in seinen Handflächen.
»Was ist … mit der Position?«, fragte ich leise, als würde das Mädchen vor uns nur schlafen und dürfte nicht geweckt werden.
»Hören Sie, die Kinder der Nacht, wie sie Musik machen«, murmelte Dr. Ruben.
»Wie bitte?«, fragte Eddie.
»Nichts, nichts«, sagte der Mediziner. »Ein Zitat aus Werner Herzogs Nosferatu, ein Film über die schrecklichste aller Krankheiten: die Unfähigkeit zu lieben. Nur ein solcher Mensch scheint mir in der Lage, so etwas zu tun.« Der Doktor fuhr sich durch das ergraute Haar.
»Das Opfer wurde definitiv post mortem in diese Position gebracht. Wir konnten noch nicht feststellen, wie weit der Täter kam, aber es findet sich Sperma auf dem Oberschenkel. Noch können wir es nicht sicher sagen, aber ich gehe stark davon aus, dass er sie erdrosselt und erst dann ausgezogen hat. Sie ist definitiv nicht mit dem Pullover oder der Strumpfhose erwürgt worden. Die dienen bloß als Requisiten.«
»Das ist eigenartig«, sagte Eddie, nachdem er die Hände von seinem Gesicht genommen und sich wieder gefasst hatte.
Ich trat einige Schritte nach vorne. Blonde Locken, ein lippenstiftroter Mund, ein hübsches, junges Gesicht. Das sind Details, die in einer solchen Situation erst später auffallen. Es ist von großer Bedeutung, schnell entscheiden zu können, welche Informationen zur Lösung des Falls beitragen können und welche nicht. Diese gehörten nicht dazu, und doch konnte ich sie nicht ignorieren.
»Haben wir einen Namen?«, fragte ich.
»Alexandra Schriefl.«
Ich wandte mich um und erkannte Ferdinand »Ferdl« Gennad, der im Erkennungsdienst für seinen präzisen Blick und seine nüchterne Sprache geschätzt wurde.