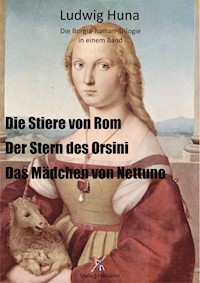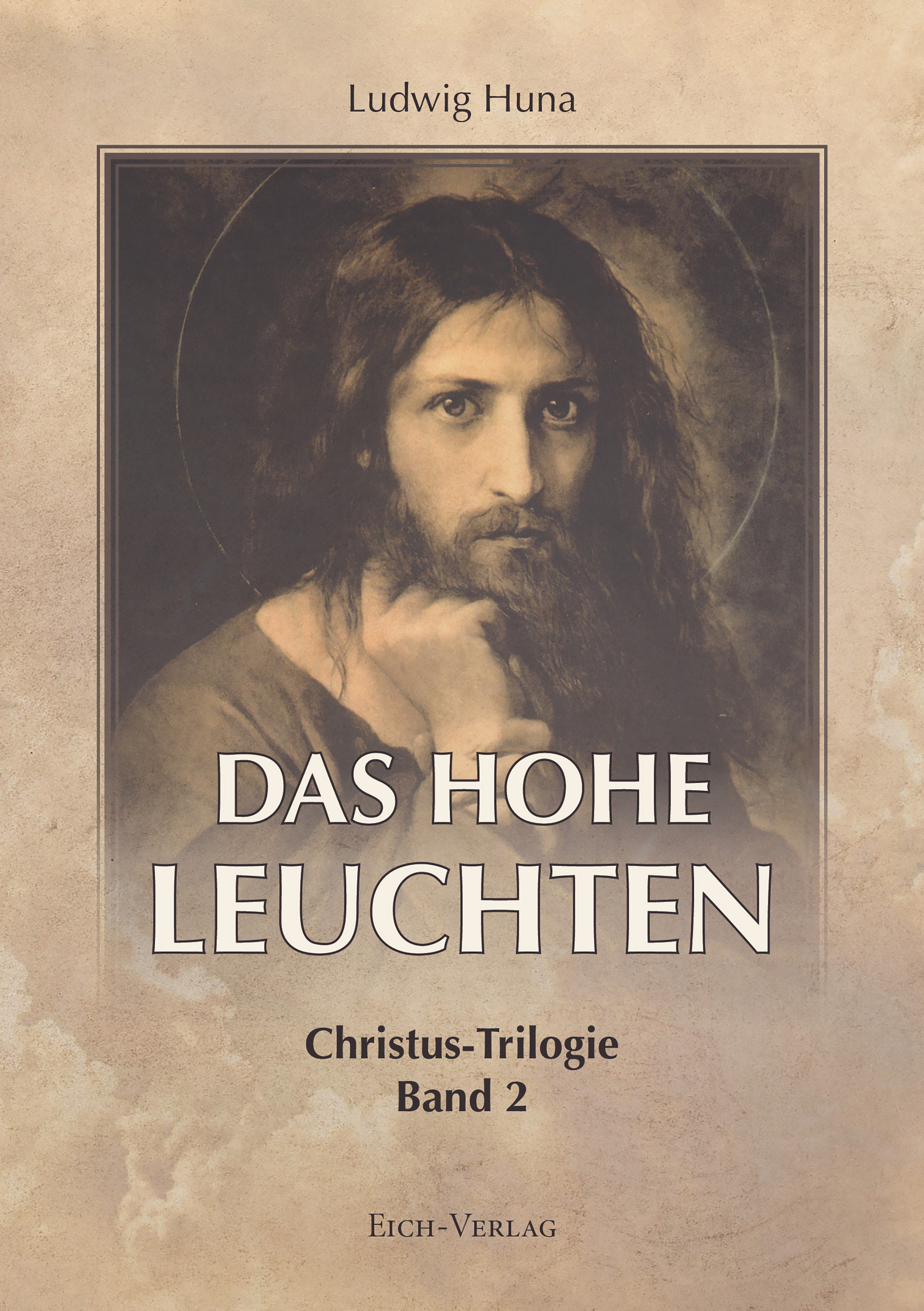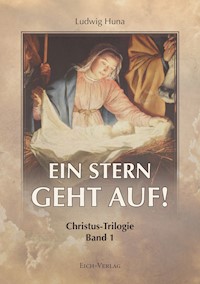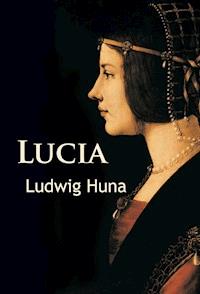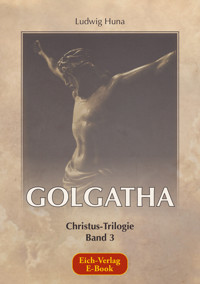
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eich, Thomas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Christus-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Im dritten Band seiner Trilogie schildert er das Leiden und Sterben Christi, seinen Einzug in Jerusalem, seine Verhaftung und seinen Prozess, die Kreuzigung und die Auferstehung. Der krönende Abschluss eines großartigen Romanwerks. Erschütternd, berührend, erhebend. Mitreißend und lebendig zeichnet Ludwig Huna in diesem großangelegten Romanwerk den Lebensweg eines Menschen, der zu einem der größten Religionsstifter aller Zeiten werden sollte. Leben und Werden des Jesus von Nazareth, seine geschichtliche, kulturelle und geistige Umwelt, seine Worte, seine Taten – das alles gestaltet Huna mit dramatischer Wucht. Losgelöst von allem dogmatischen Beiwerk, entwirft er das farbenprächtige Bild einer Zeit des Umbruchs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ludwig Huna
Golgatha
Christus-Trilogie
Band 3
Ein historischer Roman
Eich-Verlag
Bitte respektieren Sie das Urheberrecht. Sie dürfen dieses E-Book
nicht kopieren, verbreiten, reproduzieren oder zum Verkauf anbieten.
Das betrifft sowohl kommerzielle als auch nicht-kommerzielle Zwecke.
Danke für Ihr Verständnis.
1. E-Book-Auflage 2021
© Thomas Eich-Verlag, Werlenbach 2021
Alle Rechte vorbehalten
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Umschlagfoto: Bild von JacLou DL auf Pixabay
Umschlaggestaltung und Satz: Thomas Eich
Druck und Bindung:
Printed in Germany
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.eich-verlag.de
ISBN 978-3-940964-64-9
Der Leidensweg des Nazareners
Erstes Kapitel
Ein trostloses Regengrau über Stoppel und Stein am Galiläischen See. Zwischen Beth und Tiberias am feuchten Hang eines Hügels lagern in Zelten die Apostel, Jünger und Frauen. Nebel verschlingen die Bergkuppen und werfen ihre Schleier über die Halden, auf denen die schwarzen Schafe gespensterhaft weiden. Gleich einem fleckigen Spiegel liegt das Wasser reglos zu den Füßen der sehnsüchtig gespannten Menschen, deren Gedanken um den fernen Meister weben. Wann kommt er wieder? Ihre Augen suchen den Bergpfad ab, der zwischen den Ölbäumen aufwärts führt und den er vor Tagen mit seinen drei Jüngern gegangen war.
Welk fallen die nassen Blätter von den Bäumen, formen sich zu glitschigen Häufchen, in die der Regen tropft. Der Rauch eines Hirtenfeuers kräuselt sich träg vom Hang herüber ins Lager und legt sich als grauer Schleier über den Boden. Das Land, das im Frühling idyllisch heiter gelächelt, als klänge der Jubelton des Hoheliedes Tag und Nacht über die grünenden Fluren, trägt nun die Trauer des Herbstes auf seinem Antlitz. Die Häuser und Steinhütten am See, Tennen, Kelter, Brunnen und Bäume sind in nässenden Nebeln versponnen. Das Korn ist längst abgeerntet, gewürfelt und aufgestapelt, der Traubensaft dunkelt in den Fässern, die Feigen sind abgenommen, die Oliven gepresst, und der Erntedank ist verhallt. Das Laubhüttenfest steht bevor.
Die Neugierigen um die Schar der Apostel haben sich verloren. Die Frauen braten den Hammel am Spieß, und Andreas Jona, der gerechte Speiseverwalter, verteilt das von Judas gesammelte Dankbrot der Geheilten.
Hingelagert bei den Feldfeuern besprechen die Jünger ihre Sorgen, während die Frauen mit ihren rascher arbeitenden Gefühlen leichter aus dem Labyrinth der Not zu finden wissen. Johanna, Susanna, Maria Magdalena und einige andere Galiläerinnen sind redlich bemüht, die getrübten Gesichter der Jünger zu erhellen. Manche sitzen auf Steinen und bessern ihre Kleider und Sandalen aus, andere gehen ruhelos von Feuer zu Feuer und trösten besonders bekümmerte Herzen, die, von Krankheit belastet, sich aus den Seeorten eingefunden haben, um nun, da sie den Herrn nicht gefunden, enttäuscht auf den Steinen zu kauern und ihr Elend zu verweinen.
„Er weiß doch, dass wir nach ihm dürsten“, sagt Bartholomäus der Zaghafte, dessen Augen vor Leid verschwommen sind. „Warum eilt er nicht zu uns zurück?“
Simon von Kana sitzt an des Betrübten Seite. „Eile ist die Tochter des Teufels. Wie könnte er sie in seinen Dienst nehmen?“
Philippus, der schlanke, herbe Galiläer, halb heidnischen Blutes, sitzt daneben. „Mein Herz gleicht einem ausgetrockneten See. Wenn ich seine Worte hörte, floss immer ein stärkender Strom durch meine Seele.“
„Und in mir entzündete er immer ein wärmendes Licht, das ich Wahrheit nannte“, sagt Thaddäus, der vollbärtige Mann, der eben an seinem Mantel näht. „Nun schwelt das Licht nur, ein dumpfer Rauch verdeckt sein Leuchten.“
Matthäus der Zöllner drückt seinen Seelenkummer anders aus. „Unkraft ist meines Tages Inhalt.“
Jakobus der Jüngere, des Alphäus Sohn, auch der Kleine genannt, ist nicht so niedergedrückt. „Es ist nicht seine Rede, die mich so packt, es ist der ganze Mensch, der seine Worte lebt. Für seine Rede müssen wir den Verstand bemühen, für ihn selbst unser Herz.“
Hinter einem Olivenbaum kauert Judas der Rotbart. Er äugt nach dem Frauenzelt, wo Maria Magdalena das triefende Fett des Hammels in der Schale auffängt. Nun rückt er den Gefährten näher und schlägt seinen Mantel um die fröstelnden Glieder. „Herz – Herz – ein sehr unsicheres Ding“, wendet er sich zu Jakobus. „Wenn es der Verstand nicht in seine ordnenden Hände nimmt, wird es zum bedrohlichen Tyrannen über den Menschen.“
Philippus blickt ihn argwöhnisch von der Seite an. „Du mäkelst unausgesetzt an dem Herrn.“
Judas tut erschreckt. „Das tue ich nicht. Seine Kraft kommt sicherlich aus Gott. Nur bestürzt sie uns Juden. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz für uns: Wie der erste Prophet war, wird auch der letzte sein. Der erste ließ Manna vom Himmel fallen, so warte ich darauf, bis auch Jesus das Himmelsbrot herabbeschwört.“
Philippus bläht die Nüstern auf. „Das ist der Geist der Anfechtung. Du lebst und denkst aus deinem kalten Gesetz heraus, und nun kommt dieser, legt seine Menschenliebe in das Gesetz, und mit einem Mal ist Gesetz und Glaube daran warm geworden. Aber du bist unberührt geblieben von seinem neuen Gesetz, armer Judas.“
Der aus Karioth windet sich hin und her. „Ich gestehe, dass ich noch nicht mit mir im Reinen bin. Gesetz und Propheten waren bisher die einzigen Offenbarungen Gottes für uns Juden, und nun kommt dieser und stürzt sie um.“
Da mengt Andreas sich ein. „Er sagte doch, dass er sie erfülle.“
„Die Schriftgelehrten behaupten es anders. Und ihnen sollen wir doch auch gehorchen.“
„Man kann nicht Gott und dem Mammon dienen“, schmettert Andreas heraus.
„Machet euch Freund mit dem ungerechten Mammon“, schlägt der Rotbart zurück. „Auch das tönte von seinen Lippen. Er verwirrt unseren Sinn mit Gegensätzlichkeiten.“ Und mit einer Wendung zum Frauenzelt hinüber: „Sagte ich das nicht immer, Magdalena?“
Die Schöne aus Magdala hebt ihre abgrundtiefen Augen auf und blickt den einstigen Geliebten traurig an. „Darnach frage ich nicht. Er hat meinen armseligen Namen in den Sand geschrieben und sich zu meinem mit Sünden überschwemmten Menschen gesetzt. Aus seiner Nähe wehte mich verzeihende Kraft an und ich wurde rein. Und ihr Männer, wart ihr nicht alle des Zornes Kinder, der Hoffart Schüler, der Leidenschaft ergebene Knechte? Von dem allen hat er euch erlöst.“
Judas wird wieder unruhig. „Ich fühle mich noch nicht erlöst.“
Magdalena blickt ihn mitleidig an. „Ich habe gelernt, dass Sünde Leid schafft. Aber dieses Leid ist nicht die Strafe Gottes, sondern die Folge der Übertretung des göttlichen Gesetzes.“
„Das sind Worte, Weib. Ich sprach da unlängst einen aus Tiberias, der auch in den Nazarener vernarrt ist. ,Wenn ich in sein Herz schaue‘, sagte er, ,glaube ich die Scheibe des Mondes zu sehen, so sanft ist er.‘ Und dann sprach ich einen Mann aus Nain, der sagte wieder: ,Mir ist er wie die Hochsommersonne, wenn sie über dem See glüht, ich kann nicht in ihren Glanz schauen.‘ Wer hat nun recht von den beiden? Worte, schrecklich schöne Worte, aus dem närrischen Gefühl geboren.“
„Du spielst schon wieder dem Verstand in die Saiten“, fährt Philippus auf Judas los. „Es wird gut sein, wenn du dein Leben etwas näher untersuchst. Es passt nicht recht in die Nähe des Herrn. Schon Petrus warnte uns alle vor dir.“
Judas wird borstig. „Petrus? So so – Petrus? Das will gemerkt sein.“ Er tappt an dem Frauenzelt vorbei nach dem Hang, wo das Hirtenfeuer seinen Rauch über den Boden wirbelt. Dort verbeißt sich sein schadhaftes Gemüt in sein elendes Stück Menschentum, das von bösen Geistern bedrängt wird.
Philippus sieht ihm durch die Nebelschleier nach. „Der ganze Mensch war mir von je ein Ärgernis.“
Die Gefährten nicken. Thaddäus verkrampft die Hände. „Unleidig ist er vom Scheitel bis zur Sohle. Immer verlangt er nach Wundern und will nicht einsehen, dass das größte Wunder Jesu Leben selbst ist. Es ist doch die höchste sittliche Wahrheit, die es uns gebracht. Gestern erst, als sie den Mondsüchtigen zu uns brachten, den keiner von uns heilen konnte, lachte Judas verbissen auf. ,Der Herr hätte es auch nicht vermocht‘, sagte er zu Zacharias, dem Gärtner.“
Da seufzt Andreas mit glanzlosen Augen. „Meine Seele ringt wie die des Judas mit den Geistern des Zweifels. Sie wird hin und her geworfen wie ein Wrack auf dem stürmischen See.“
„Auch du, Andreas?“, Jakobus der Kleine blickt ihn entsetzt an. „Du warst doch einer der Starkgläubigen.“
„Seit gestern bin ich´s nicht mehr. Das Gesicht des Mondsüchtigen klagt mich an. Mich, euch alle. Hat der Herr nicht zu uns gesagt: Wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird größere tun denn diese.“ Und verzweifelt: „Wir können diese Werke nie und nimmer tun! Schmählich versagt unsere Kraft, also glauben wir nicht an ihn.“ Ein ehrlicher Jammer schreit aus seiner Brust.
Da verhüllen die Männer ihre Häupter, denn auch sie quält dasselbe Gefühl der Minderwertigkeit. Es ist, als hätte sich der Teufel in die verlassenen Gemüter eingenistet.
Da erhebt sich Johanna, eines herodianischen Pflegers Weib, aus der Weiberschar und ruft in der Jünger Zelt hinüber: „Ihr Toren! Wollt ihr euch dem Bösen verschreiben? Der Geist des Zweifels ist der Böse. Ihr Kleinmütigen erkennt die Fratze nicht, ihr haltet das Böse für wahr und wirklich ich sage euch: Es ist nicht! Es ist bei Gott nicht!“ Johanna steht mir leuchtenden Augen da, und ihre Brüste wogen in innerer Erregung.
Philippus, der leicht entzündbare Mann, eilt auf sie zu. Aus der Tiefe der aufgewühlten Seele dankt er ihr für den Weckruf und spricht zu den anderen: „Dieses Weib beschämt uns Männer. Sie hat einen Glauben, dem Senfkorn gleich, wie der Meister sagte, das da unbeirrt seine Kraft aus der Erde zieht und sich getrost in der dunklen Tiefe verwurzelt, denn es weiß, dass es mit Gottes Kraft ans Licht kommt. Dieser Judas hat euch wieder einmal verstimmt. Ich sage euch: Fehlerlos wie sein Leben ist Jesu Lehre, voll Fehler aber die Sehnsucht der Menschen, ihn anders zu sehen, als er ist. Nicht weltverneinend, weltbejahend sieht ihn das wahre Sucherherz.“
Da erhebt der Zweifler Thomas die Hand. „Sagte er aber nicht, sein Reich sei nicht von dieser Welt?“
Philippus lässt sich nicht unterkriegen. „Damit will er nur sagen, dass ihn die weltgebundenen Menschen, die ihn mit irdischer Macht überhäufen wollen, nie finden werden. Das Äußerliche gilt ihnen alles, der Geist dahinter nichts. Von dieser Welt kann sein Reich nie sein, denn es ist durch und durch geistig.“
Da schnellt aus Magdalenas Brust ein Schrei: „Der Meister!“ Sie läuft wie ein gehetztes Wild gegen den Berghang. Froh erschreckt fahren die Jünger auf.
Noch verbergen die Bäume die heranschreitenden Gestalten; aber Marias Auge hat den geliebten Meister dennoch erkannt, wie er, gefolgt von Petrus, Johannes und Jakobus, den Hang herabkam, an dem Hirtenfeuer vorbei.
Einer aber war schneller als das Weib. Judas wollte als der Dienstfertigste von allen erscheinen, und er eilte noch vor der Magd von Magdala den Hang hinauf, dem Meister entgegen.
„Sei gegrüßt, Meister!“ Und er schwenkt ihm das gelöste Kopftuch zu.
Jesus hält im Schreiten inne. Seine Glieder haben nicht mehr den Schimmer der Verklärung vom Berge, aber in seiner Brust wogen noch die Gefühle der Kraftverbundenheit mit dem Gottgeist, und sie tragen ihn über die regennassen Steine.
Das unnatürlich frohe Herz des Judas liegt wie ein ausgeschälter Nusskern vor ihm. Aber er verzieht keine Miene, ergreift des Falschen Arm und dankt ihm für seinen ersten Willkomm. Dann sieht er Magdalena demütig am Wege stehen, aber innerer Freude voll. „Maria, sei gegrüßt!“, wendet er sich zu ihr.
Die Apostel kommen heran. Mit herzbetörender Neugierde fragen sie sich einer nach dem anderen in sein Herz. Bilden sich doch alle ein, Gefährten seines Erlebens, derselben Erfahrung, der gleichen Durchseelung zu sein. Eine Art Neid überschattet die drei glücklichen Jünger, die mit ihm waren, berufen und auserwählt, das Liebesleuchten seines Herzens am inbrünstigsten zu erfahren. Dieser Johannes vor allem trägt sein Haupt glückhaft hoch; weiß er doch, wie ihn sein Herr liebt. Sogar Petrus neben ihm scheint im Anwert zu sinken, wenn ihre prüfenden Blicke die beiden vergleichen. Der harte Fischer hat keinen Lächelmund und ist doch, wie sie meinen, der Heilsliebe voll. Und Jakobus, des Johannes Bruder, spiegelt in seinem Gesicht die helle Freude wider, die er aus dem Bergerleben mit ins Tal genommen. Doch das Schweigegebot des Herrn drückt die Herzen der drei Jünger nieder. Ihre Erlebnisschauer müssen sie in sich verschließen. Das musste zu Spannungen zwischen den Jüngern führen.
Nun geht der Erhabene zwischen den Feuern und Zeiten dahin, alle grüßend, die ihm entgegenkommen, und bald fliegt die Kunde von seiner Wiederkehr über den See, nach den Orten und Weilern hin. Menschen strömen herbei, ihn zu sehen, und auch der Pharisäer armselige Meute macht sich auf, sein seltsames Tun zu durchschnüffeln. Und langsam schleppen sich die Kranken heran, um von ihm und dem heilenden Geist aus Gott berührt zu werden. Ja, dieser Mensch gilt ihnen als vergottet.
Zweites Kapitel
Am nächsten Morgen durchbricht die Sonne das trübe Gedünst, und der See leuchtet auf.
Um Jesu Gezelt wird es lebendig. Das Volk hatte sich die Nacht über um die Zelte der Apostel gelagert, die Feuer angezündet und den Morgen in Gebeten erwartet.
Den Stimmenlärm übertönt plötzlich ein wildes Kreischen vom Weg nach Tiberias her. Petrus tritt mit Ingrimm auf der Stirn heraus und fragt nach der Ursache des Lärms. Da zeigen die Jünger nach dem Weg, wo eine Menschenschar heranzieht.
„Siehst du den Mann mit dem Knaben?“, schiebt sich Bartholomäus an den stämmigen Petrus heran. „Sie brachten die beiden schon gestern zu uns, damit wir den jungen Pharisäer heilen; er ist mondsüchtig, aber es packt ihn das Übel auch bei Tag.“
Da steht auch schon Jesus in der Zeltöffnung. Er sieht nach dem Weg und der Menge, erblickt auch gleich den Vater mit dem kranken Knaben, der sich wie besessen gebärdet, denn der Schaum trieft ihm vom Munde, und seine Zähne knirschen. Der Nazarener lässt die von der Neugier des Volkes umtobte Gruppe halten, und in seiner Brust entzündet sich augenblicklich die Flamme unendlichen Erbarmens.
„Ihr habt ihm nicht helfen können?“, wendet er sich an die Jünger.
Sie senken beschämt die Köpfe. „Da du fern warst“, sagt Thaddäus kleinlaut, „verließ auch uns der anspornende Geist, das Erbarmen vertrocknete in unseren Brüsten, die Heilkraft versiegte, unserer Hände Berührung war machtlos an diesem Kinde.“
Da kerbt sich bitteres Weh um die Mundwinkel des Meisters ein. „O du ungläubiges Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein und mit euch leiden?“
Und schon fällt der Knabe zu Boden, verreißt das Gesicht, der Geifer schäumt von den Lippen, und mit grässlichem Geschrei tobt der Geist der Besessenheit in ihm.
Der Wunderbare berührt die Schulter des Vaters. „Wie lange hat er diesen Geist?“
„Von Kind an“, jammert der Unglückliche. „Und er wird von ihm ins Feuer und Wasser geworfen, auf dass er ihn umbrächte. O erbarme dich seiner, Herr.“ Die erschreckten Augen flehen den Meister an.
Und dieser spricht kraftvoll: „Alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt.“ Weiß er doch, dass seine Jünger mit ihren zweifelnden Gemütern vergebens an die Pforte des Heils gepocht hatten, ja dass sie sich sogar mit den Pharisäern beraten hatten über ungeistige Mittel, Beschwörungen und Salbungen, um nur dem Knaben irgendwie zu helfen. Ein Gram überlief des Erhabenen Herz, das sich nun wieder in die Qual menschlicher Schwachheit hineingerückt sah. Wie haltlos und gottgeistig verlassen waren doch die, die sich die Seinen nannten, wenn er nicht leiblich bei ihnen war. Und wenn er nun für immer von ihnen ginge? Eine Welt der Verlorenheit musste er zurücklassen, in der seine Jüngerschaft mit notüberladenen Seelen hilflos vor der leidenden Menschheit stehen musste. Trauer umflorte sein Auge.
Da schreit sich plötzlich der Vater des gemarterten Knaben, der nun wie tot am Boden lag, in das Herz des Galiläers hinein: „Ich glaube, Herr! Hilf meinem Unglauben!“ In einem Atemzug vermengte er Sicherheit und Zweifel!
Da stieg göttliches Erbarmen mit des Mannes Schwachheit in die Augen des Herrn. Das drängende Volk sieht, wie Jesus sich über den verkrampften Körper beugt, mit Sanftheit seinen rechten Arm berührt, ihn langsam emporhebt und vor den gaffenden Menschen aufrichtet. Der Knabe öffnet die Augen, blickt wie traumbefangen um sich und wirft sich dann dem Vater schluchzend an die Brust. Dieser führt ihn stammelnd, lallend aus der Menge, die außer sich gerät.
Petrus und Johannes zerstreuen die lärmenden Leute. Die anderen Jünger, etwas ferner stehend, haben den Vorgang mit verhohlenem Ärger über sich selbst verfolgt. Oh, wie klein waren noch ihre Gedanken und wie irre gingen sie. Manch einer von ihnen wollte schier verzagen, da er sich kraftlos fühlte und glaubte, nicht einmal die erste Stufe der Heilsleiter besteigen zu können. Ein unsägliches Gefühl der Verlassenheit überkam die Getreuesten.
Ihr Meister aber gab den Auftrag, die Zelte abzubrechen, er wolle nach Kapernaum, seiner Stadt.
Da ging abermals ein heimliches Grollen durch ihre Gemüter. Und Jesus nahm auf dem Weg nur die drei Jünger vom Berge an seine Seite, die er allein mit liebevollen Worten tränkte. Wolken über Wolken verdüsterten die Stirnen der anderen.
Aber auf dem Weg erwiesen sich selbst diese drei Auserwählten seiner nicht wert. Als der Herr vor ihnen in Gedanken versunken daher schritt, stritten sie sich leise, wer unter ihnen wohl der Bevorzugteste sei. Er aber hörte ihr albernes Reden und beschloss, sie besinnlich zu machen.
Als sie wegmüde in seiner Stadt ankamen, setzte er sich auf den Stein vor dem Schulhaus und schüttelte den Staub von den Füßen. Und es drängte sich wieder allerlei Volk, Juden, Griechen und Römer, an ihn heran, und viele Kinder schlüpften in ihrer Neugierde zu ihm. Und da griff der Erhabene eines der Kinder heraus; das mit seinem Schmutznäschen und seinen hilflosen Blicken sein Herz besonders rührte, pflanzte es vor sich auf, streichelte über sein Haar und senkte seine Ehrfurcht vor der unschuldigsten Kreatur Gottes in die Worte: „Wahrlich, es sei denn, dass ihr euch wandelt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr in das Reich Gottes kommen. Wer sich zum Kinde macht, der ist der Größte im Himmelreich.“ Und sein Blick zielte nach den drei Jüngern, die sich um dieser Sache willen gestritten hatten. Und wieder nahm er die Kindesseele in seine besondere Hut: „Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf und den, der mich gesandt hat. Und wer der Kleinen einen ärgert, dem wäre es besser, es hinge ein Mühlstein an seinem Hals und er würde ersäuft im Meer, wo es am tiefsten ist.“
Das alles hämmerte sich gewaltig in die früher noch so selbstbewussten Herzen der Apostel ein. Sie sollten zu Kindern werden! Um groß zu werden im Reiche Gottes. Werden sie´s können? Ach, im fahlen Licht der abendlichen Dämmerung war es schwer, einander eine klare, befriedigende Antwort zu geben. Sie kannten weder ihren Meister noch sich selbst. Hatten sie nicht bisher sorglos und irreführend viele Worte aus seinem Mund weitergegeben, in die sie in eitler Selbstbespiegelung ihre eigenen Gedanken verquickt hatten? So entstanden allerlei verkleinernde Zutaten, und sie nannten das alles zusammen eine Art Vermächtnis des größten Menschen. Nur manchmal raffte sich ein Apostel auf, um das Leben seines Meisters in einem Brennpunkt zu sammeln.
An diesem Abend sagte Petrus zu Johannes: „Sein Leben ist Geist, Seele und Leib, alles unter den Willen Gottes gestellt, es ist die einfachste Wahrheit. Hätten wir nur seine Lehre und nicht sein Leben, ich wollte nicht sein Jünger heißen.“
„Und er ist der Liebe überfülle“, schwärmte der immer empfindungsvolle Johannes. In keinem der Jünger war das Wort des Meisters „Liebet euch untereinander“ so lebendig wie in seinem Herzen, denn er fühlte, dass dieses Wort eine Umwälzung der Welt bedeutete, wenn es in die Tat umgesetzt werden würde.
An diesem Abend blies auch Judas wieder seine mephitischen Gedankendünste in einer Herberge von sich, wo er mit Thomas und Matthäus nächtigte. „Er ist ein Mensch, der sich selbst erniedrigt, statt sich zu erhöhen. Er lässt sich nicht Sohn Davids nennen, nur eines Menschen, nicht eines Königs Sohn. Kein Wunder, dass weder Juden noch die Heiden, weder Könige noch Fürsten an ihn glauben. Er lebt sozusagen nur von den Armen, Kranken, Beladenen und von den Kindern, denen er die Hände aufs Haupt legt. Aber so werden wir Apostel von den Menschen nie ernst genommen werden.“
Thomas streift ihn mit einem grimmigen Blick. „Du bist ein Wühler. Er gibt dir lebensstarke Worte, und deine Antwort ist Zweifel. Er sagt zu dir: Ich bin! Und zurück hallt es aus der Hohlheit deines Herzens: Du bist nicht Christus.“
Auch Matthäus schlägt sich auf die Seite des Empörten. „Ja, züchtige ihn nur, es ist eine Krämerseele. Und was die Juden anbelangt, ei, der Meister ist, meine ich, gar nicht gekommen, um dieses Volk aus dem selbstgeschaffenen Elend zu erlösen, sondern er will alle Menschen, so sie guten Willens sind, zu Gott führen. Der inbrünstige Schrei der ganzen Erde ruft nach ihm. Und es werden junge Völker sein, Heiden vielleicht, die ihn als erste auf den Thron des Geistes erheben werden.“
„Was kümmern mich die jungen Völker?“, schüttelt sich Judas. „Ich will als Jude erlöst werden. Die Verbrechen der jüdischen Könige und der römischen Statthalter rufen nach einem vergeltenden Christus. Aber Jesus schwingt die Geißel nur im eigenen Tempel statt in dem Göttertempel der Römer.“
„Dein wuchernder Verstand verschlingt das Getreide deines Herzens.“ Matthäus wendet sich angewidert von ihm.
Da kläfft sich ein Hündlein herein in die Stube. Judas, der Rauherzige, tritt mit dem Fuß nach ihm. Laut winselnd verkriecht sich das Tier zwischen den Beinen des Thomas.
Der Jünger hebt drohend die Faust gegen den Rohling. „Unmensch! Was tat dir die Kreatur?“
„Es ist nur ein Hund“, geifert Judas.
„Wenn du nach einem Hund schlägst, schlägst du der Treue ins Gesicht. Nur ein Ungetreuer kann das tun. Weißt du, was der Meister sagte, als wir am See wandelten? ,Wenn du der Blume Daseinswert erkannt hast, bist du einen Schritt näher zu Gott; wenn du das Tier liebst, weil es eine Kreatur Gottes ist, bist du wieder einen Schritt näher zu Gott; und wenn du den Menschen, auch den schlechtesten, liebst, bist du wieder einen Schritt näher zu Gott!‘ Seitdem ich das Wort gehört, habe ich Achtung vor dem Tier, denn wenn ich ein Tier anblicke, blicke ich Gott selbst ins Auge; denn in ihm ist der göttliche Keim des Lebens schlechtweg.“ Und Thomas hob das geschreckte Hündlein auf seine Knie und liebkoste seine feuchte kleine Schnauze.
Judas schielte mit Ingrimm im Herzen nach dem liebenden Jünger, zog dann die Decke über die Ohren, und sein Ärger verrannte sich im Labyrinth seiner bösen Gedanken. Manchmal durchwühlten diese den Almosenbeutel, der unter seinem zusammengerollten Mantel lag; ihm war, als führten die Münzen darin klingende Tänzlein auf, die seine raffgierigen Augen wollüstig verschlangen.
Drittes Kapitel
Mit ungeheuren Worten, deren Gewalt die schwachen Seelen zu Boden warf, die starken aber noch mehr kräftigte, goss der Meister in diesen Tagen seine Lehre in das Volk. Er sprach von dem Ärgernis der Welt und dass der gottsuchende Mensch Hand und Fuß abhauen müsse, wenn sie ihn ärgerten. „Und so dich dein Auge ärgert, reiße es aus und wirf´s von dir.“ Der Mensch, sagte er, mit zwei gesunden Augen, aber dem höllischen Feuer in der Brust, tauge Gott nicht. Das gleichnisweise gedachte Bild war zu viel für die menschlich schwachen Schultern. Sie nahmen alles wörtlich und bangten ernstlich um Auge, Hand und Fuß.
Petrus wagte sich mit einer Frage an den Herrn heran. „Wie oft muss ich meinem Bruder, so er sich gegen mich versündigt, verzeihen? Ist´s genug siebenmal?“ Er wollte in seiner rechnerischen Vorsicht nicht zu hoch gehen.
Da führte ihn Jesus ab. „Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal sollst du ihm vergeben.“
Das war auch für Petrus zu viel. Konnte er je eine solche Vergebungskraft gegenüber seinen Mitbrüdern aufbringen? Hasste er nicht diesen Judas, der sich mit nörgelnder Zudringlichkeit an des Meisters Füße heftete? War dieses Vergebungswort wirklich von Gottes Odem durchweht? Übernahm sich der Herr nicht durch einen solchen Kraftaufwand?
In diesen Tagen wurde es unruhig um den Nazarener. Es schieden sich aber auch die Geister um ihn. Die da niedergedrückt wurden durch die Wucht seiner Forderungen, fielen von ihm ab; die da aber innerlich erhoben wurden, schlossen sich noch enger an ihn an. Dazu kam, dass die Stadt von Gerüchten überweht wurde, die selbst Jesus aufhorchen ließen. Herodes Antipas, hieß es, der augenblicklich in Jerusalem saß, sehe verärgert auf das unruhige Volksgewoge in seiner Tetrarchie, die Pharisäer trügen ihm allerhand unsinnige Mären über den Aufwiegler zu, der den Tempel stürzen wolle und den Ungehorsam gegen die Mächtigen predige. Und dieses ferne Grollen vom Vierfürstenhof herüber machte den Meister stutzig. Er durfte sich von niemandem vor der Zeit aus seinem heiligen Auftrag reißen lassen, denn seine Stunde wusste er noch nicht gekommen. Er entschloss sich, von Kapernaum aufzubrechen und nach Süden zu wandern. „Saget dem Fuchs Herodes“, rief er seinen Warnern zu, „ich triebe die Geister des Wahns aus und heile die Menschen heut und morgen, und am dritten Tag werde ich selbst gerichtet werden. Ein Prophet kann nur in Jerusalem umkommen.“
Das warf abermals Bestürzung in die Seelen der Jünger, und sie klagten einander ihr Leid, das ihnen aus der geheimnisvollen Anspielung Jesu erwuchs.
Als die Zelte gepackt waren, kam ein Weib vor die Tür des Nazareners, staubbedeckt, müdgewandert, das Herz vollgefüllt mit mütterlicher Liebe. Maria von Nazareth hatte sich aufgemacht, ihren Sohn zu suchen. Ihre anderen Söhne hatten sich nicht gerade von ihr losgesagt, aber ihr stetes Weinen um den Erstling, den sie für abtrünnig hielten, hatte sie doch innerlich abwendig von ihr gemacht. Ihr Haar war leicht ergraut, ihre Wange verbleicht, ihre Lippe tränenfeucht geworden. Sie hatte alle Nachrichten, die ihr über den Sohn zugeflogen kamen, mit zwiespältigem Herzen verarbeitet. Halb grollend, weil er nicht zu ihr kam, halb erfreut über die Erfolge seiner gottgewollten Sendung im galiläischen Lande schleppte sie sich durch der Tage Mühsal hin, immer bestrebt, den geliebten Sohn vor den Anwürfen der Brüder in Schutz zu nehmen. Seine Heilungen flogen wie Wundermären in ihr Herz und machten es zittern vor Freude. Ihre Gedanken vergruben sich in seine Kindheit, in das wunderbare Werden seines Wesens, sie erquickten sich an den Erinnerungen an die Engelsverheißung und an die Geschehnisse der frühen Zeit. Sie wob ihre Träume mit Erfüllungen aus, die alle Verkündigungen von oben her bestätigten, und die Gestalt ihres herrlichen Sohnes erhob sich lichthell aus dem Düster der Tage und wurde zum Fanal, nach dem ihr mütterliches Sehnen drängte. Und so machte sie sich auf, schnürte ihr Bündel und zog nach der Stadt, aus der die Kunde kam, Jesus durchackere die Seelen, die dort lebten.
Nun sitzt sie ermattet vor dem von Menschen umstandenen Haus, von dem man ihr gesagt, hier predige der Meister.
Und sie hört seine Stimme hinter der Tür laut tönen: „Dein Reichtum ist die Armut deines Bruders, Mensch. Habe nichts und du hast alles. Sage nein zur Sorge und ja zum nackten Leben aus Gott.“
Dann Stimmengewirr, als besprächen die Hörer das Wort.
Und wieder die mahnende Stimme: „Wer verlässt Häuser, Bruder, Schwestern oder Vater und Mutter um meines Namens willen, der wird´s hundertfältig nehmen und das ewige Leben haben. Die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein.“
Da erschauerte Maria und ersehnte, das letzte Weib auf Erden zu sein, um als erste in seine gottgefällige Nähe zu rücken.
Und wieder ertönte die Stimme hinter der Tür: „Was heißest du mich gut? Niemand ist gut denn der einige Gott.“
Niemand ist gut! Das bricht wieder den Glauben Marias an seine heilige Sendung entzwei. Sie birgt ihr Haupt in das Brusttuch, das sie von den Schultern zieht, und weint bitterlich. Niemand ist gut – also auch er nicht, ihr sündentilgender Sohn?
In ihr schneidendes Weh hallt jetzt eine andere Stimme, die sie als die des Johannes erkennt. „Meister, wir sahen einen, der in deinem Namen Teufel austrieb, ohne dir zu folgen, deshalb verboten wir´s ihm.“
Und wieder die warmklingende Sohnesstimme: „Ihr sollt es ihm nicht verbieten. Denn wer eine Tat in meinem Namen ausübt, redet nicht so bald übel von mir. Und wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Wer aber euch tränket mit einem Becher Wassers in meinem Namen, darum, dass ihr Christo angehört, wahrlich, ich sage euch: Es wird ihm nicht unvergolten bleiben.“
Da ward eine wundersame Stille hinter der Tür, als flössen heilige Ströme durch die Brüste der Versammelten.
Und plötzlich ging die Tür auf. Ein buckliger Pharisäer trat mit einem Leviten heraus, und Maria hörte den ersten sagen: „Der Mensch will uns unserem Jahve entfremden. Ich will nimmer in sein Auge sehen, denn er zerschlägt die Form unseres Gesetzes.“
Da öffnet sich abermals die Tür, und er tritt heraus, ihr Sohn. Marias Herz schreit auf. Und als er nun über die Schwelle schreitet, streckt sie ihm die Hand entgegen.
Der Erhabene nimmt sie in seine Arme und küsst ihre vom Schmerz um ihn geheiligte Stirn und die welken, blutarmen Lippen. Und in einem einzigen Augenblick erfasst sie seine hohe Sendung an die Menschheit und verzeiht ihm siebzigmal siebenmal die Vernachlässigung ihrer Person. Bleibt er ihr ja doch als geheimnisvolles Sohnesgeschenk des Himmels verbunden, und keine wie immer geartete Macht konnte ihn von ihrem Herzen reißen. Inbrünstig streichelt sie über das goldbraun schimmernde Haar, und ihr Blick saugt die auf seiner Stirn liegende Trauer ein. Denn es war eben geschehen, dass er die Städte mit Weh beschrien hatte, die da seine Lehre missachteten, wiewohl er ihnen das Heil in lebendiger, vorbildlicher Tat hingepflanzt hatte. Chorazin, Bethsaida und Kapernaum! Sie waren zum Teil abgefallen, und darüber hatte sein Herz zu bluten begonnen.
„Wir ziehen ins Jordanland, Mutter, denn hier dräun allzu viele Wolken über uns.“
Und Maria setzte willig ihre Füße in den Staub und wanderte demütig mit den Frauen mit, die ihm folgten. Johanna, des Chuza Weib, und Maria Magdalena, die mit herzverwirrender Liebe ihrem Herrn fortwährend die Myrten ihrer wiedergewonnenen Reine ausstreute, nahmen die Gebenedeite in ihren besonderen Schutz und stützten ihren Fuß auf den steinigen Wegstrecken. Wenn Jesus mit den Jüngern voranging, liebkosten die Mutteraugen seine Gestalt, und ein ununterbrochenes Segnen seiner Rede durchflutete ihr Herz, das nun ganz mit Opferreichtum und Hingabe an den Helfersohn der Menschheit erfüllt war. Ihr begreifliches Anrecht auf den Sohn gab sie für das Geschenk des Geistes hin, das er an die Menschheit verschwendete, und alles, was jetzt von ihm ausströmte, empfand sie als Gnadenflut, die ihr selbstsüchtiges Sehnen verschlang. Aus ihrem eigennützigen Herzen war er fortgegangen, um in das Allherz der Menschheit einzuziehen. Dieser Verlust war für sie gottgewollt, und das Opfer ihrer Mutterschaft schien ihr von Gott geweiht zu sein. Es war ein seliges Wandern unter dem Geleite der Sohnesgnade.
Viertes Kapitel
Während in den Gassen Jerusalems dämmerdunkle Schatten liegen, strahlt der Palast des Herodes Antipas in tagheller Pracht. Nur ein paar Tage hält sich der Tetrarch hier auf, übermorgen schon will er nach Tiberias reisen, um dort die Feier des Laubhüttenfestes zu begehen.
Um die Mauern schleicht das verängstigte Volk herum, um vielleicht einmal den gefürchteten Tyrannen sehen zu können, der sich dem Volke nur selten zeigt.
Zwölf schwelende Fackeln beleuchten die Fassade des Quadernbaues. Zwischen den Toren schreiten die kappadozischen Leibwächter des Tetrarchen auf und ab; ihre Gesichter gleichen den starren, ausdruckslosen Köpfen ägyptischer Statuen, ihre schwarzen Augen irrlichtern über den Platz und in die angrenzenden Gassen hinein, als suchten sie nach verdächtigem Volk. Ab und zu schaukeln Sänften mit dem römischen Adler vorbei oder halten vor einem Tor, der Sportello wird aufgerissen, römische Frauen steigen aus und verschwinden im Palast. Es sind die Damen des Prokuratorengefolges, die im Herodespalast ihren Abendbesuch machen. Auch die syrischen Frauen der Edlen am Hof des Statthalters Quirinus kommen von Zeit zu Zeit nach Jerusalem, um dem Tetrarchen ihre Huldigung darzubringen. Sie kommen auf Kamelen geritten, begleitet von einer Schar Beduinen, deren wilde Gesichter das Volk der Juden in die Häusertore scheuchen.
Herodes Antipas geht unter dem Druck dunkler Stimmungen in seinem Prachtgemach auf und ab. Er will die Leute nicht sehen, die da anlässlich des Laubhüttenfestes Jerusalem und den Tempel belagern, die die plumpe Neugier nach dem Palast treibt und ihn umlärmt. Er hat genug von dem Hofgetriebe, in dem die Juden aufdringlich den Ton angeben wollen und sich nicht scheuen, sogar die stolzen Römlinge an die Wand zu drücken. Herodes ist schon verbittert, dass er die vorsprechenden Sadduzäer und Pharisäer von seinen Höflingen abweisen lässt, noch ehe sie ihre Bitten vorgebracht haben. Er kennt die Namen der allzu Dreisten, die immer wieder vorgelassen werden wollen, um irgendeine Forderung durchzusetzen. Nun lassen sie sich in Abordnungen anmelden, um die Wichtigkeit ihres Anliegens besonders zu betonen. Aber Antipas durchschaut ihre Finten.
Diesen Abend hat sich wieder ein Ausschuss angemeldet, der Herodes in einer besonders wichtigen religiösen Angelegenheit sprechen will. Eben kündigt der Kämmerer Basilius das Erscheinen der Pharisäer an.
„Hast du versucht, sie abzuweisen?“, fragt der Tetrarch missgelaunt. Er hatte heute eine Unzahl eifersüchtiger Sticheleien seitens seiner Geliebten, der Römerin Calpurnia aus der gaulanitischen Stadt Julias, zu ertragen gehabt, deren Vorwürfen er hilflos gegenübergestanden war.
Basilius zuckt die Achseln. „Man kann diese Querulanten mit Steinen zur Tür hinausjagen, sie steigen lächelnd beim Fenster wieder herein. Es ist angezeigt, sich ihrer zu erbarmen, man ist sie dann wenigstens für eine Zeit los.“
„Man vermaure die Fenster! Dann werden sie nachgeben. Lass sie noch eine Weile warten, damit sie saure Gesichter bekommen. Salome ist in den Tempel getragen worden?“
„Wie immer, begleitet von vier Frauen und zwölf syrischen Wächtern. Das Volk drängt allzu neugierig an ihre Schönheit heran.“
Der Tetrarch wendet sich mit verzogenen Mundwinkeln ab. „Ruf mir rasch den neuen Philosophen Lysippos.“
Der kam wie ein magerer Windhund gelaufen. Er war klein, zartgegliedert, und seine Stirn schien das Aushängeschild seines beweglichen Geistes zu sein. „Ihr befehlt, mein Fürst?“
„Du bist der Vertraute meiner Stieftochter, Salome. Bemerktest du in der letzten Zeit eine Veränderung ihres Wesens?“
„Sie starrt viel nach dem Mond und flüstert den Namen ihrer unglücklichen Mutter Herodias geheimnisvoll in die Lüfte. Sie scheint verliebt zu sein und sucht dies durch ihr sonderbares Schwärmen zu bemänteln. Ihr Herz glüht, scheint es, für den Hauptmann der kappadozischen Leibwache Bardonai, der ihr immer den Fächer nachträgt, wenn sie in den Tempel getragen wird.“
„Hat sie dir Andeutungen darüber gemacht?“
„Ihre Seufzer und Blicke sind verräterischer als Worte.“
„Wenn die Sache zu arg wird, benachrichtige mich, und ich will den Hauptmann ertränken lassen. Salome taugt nur für einen Mann aus syrischem Edelgeblüt. Bardonai ist ein gewöhnlicher Krieger. Seine Vermessenheit mag loser Schwärmerei taugen, für eine ernstliche Verbindung ruft sie mein fürstlicher Wille zur Verantwortung. Ich höre, dass das Land um den Jordan die Ankunft dieses Aufwieglers erwartet.“
„Des Jesus von Nazareth? Eben um dieses Mannes willen sind die Ältesten des Pharisäerrates gekommen.“
„Das ist bedeutsam. Führe sie vor.“
In dem von kostbaren Vorhängen bedeckten Empfangsgemach warten drei düstere Gestalten; Patriarchenköpfe mit fanatisch flammenden Augen, asketisch fahlen Wangen und langen, starren Bärten. Elkana, Abinoam und Joras, Vertrauenspersonen des Synedriums, des hohen Gerichtshofes von Jerusalem. Die zwei ersten Greise kennen den Nazarener gar wohl, denn sie waren Zeugen seines beunruhigenden Auftretens am See Genezareth, sie hatten die Unzufriedenen gesammelt und zu einem galiläischen Klüngel geeint, der die Saat des Widerspruchs gegen die Lehre des Nazareners im Lande ausstreute. Überall waren sie am Werk, den Abfall der Anhänger Jesu zu betreiben. Joras aber bereitete in Juda selbst den Boden für das Unkraut vor, das den reinen Weizen überwuchern sollte. Mit rühriger Geschäftigkeit ritt er von Ort zu Ort und warnte die Juden, die verderbliche, gegen den Tempel gerichtete Lehre in ihren Herzen aufzunehmen. Er drohte mit den Machtmitteln des jüdischen Gesetzes, das eine solche aufrührerische Tat verdammen musste. Das Volk sollte in der althergebrachten Abhängigkeit vom Tempel erhalten werden. Das Neue war zugleich der Feind des Alten.
Herodes besah sich die drei vom Hass gezeichneten Gesichter. Er brauchte nicht zu bangen, dass sie mit ihrer Meinung hinterm Berg halten würden.
„Hoher Tetrarch“, begann Elkana, der Sprecher, „unendliches Leid bedrückt die Juden des ganzen Landes. Es ist einer aufgestanden, der mit seinem wühlenden Geist das Gesetz und die Propheten in den Staub wirft. Du weißt, von wem ich spreche, Herr?“
Der Tetrarch nickt, ohne die Lippen zu öffnen.
„Jesus von Nazareth setzt mit seiner eifernden Lehre die Herzen frommer Juden in Brand, alles Volk läuft ihm nach und entzündet an der Fackel seines Geistes die Holzscheiter des Glaubens.“
„Ja, ja, es gehen allerlei Gerüchte über den seltsamen Mann um“, unterbricht ihn nun Herodes. „Die einen sagen, er sei Gottes Sohn, die anderen, er sei ein Prophet, die dritten wieder halten ihn für den auferstandenen Täufer.“
„Das ist er nicht. Aber er bedroht nicht nur uns Juden, sondern auch dich, den Tetrarchen. Du wolltest es nie wahrhaben und hast gelächelt, wenn Leute von uns dich warnten. Wir haben jetzt Männer zu ihm gesandt, die ihn in deinem Namen mit dem Tod bedrohen sollten –“
„Fürwitzige Narren, was unterfangt ihr euch? In meinem Namen, sagt ihr? Ich könnte euch hängen, ans Kreuz nageln lassen, wenn es mir um Stricke und Nägel nicht leid täte. Was wolltet ihr damit?“
„Dass er vor deinem Zorn aus dem Lande fliehe. Aber als wir´s ihm hinterbrachten, jagte er uns von dannen, schalt dich einen Fuchs und sprach etwas von einer rätselhaften Vollendung seines Werkes am dritten Tag und dass ein Prophet in Jerusalem sterben müsse.“
„So hat er euch und eure Machenschaften durchschaut. Und das ist gut so. Ihr tatet so, als wolltet ihr ihn warnen vor mir, er aber blickte auf den Grund eurer heuchlerischen Seele. Was wollt ihr noch bei mir, da eure Böswilligkeit sich selbst richtet?“ Antipas überflammte sie mit seinen drohenden Blicken.
Aber sie ließen nicht locker. „Der Aufruhr in den Herzen der Juden wächst von Tag zu Tag. Der Nazarener hat Galiläa verlassen und befindet sich schon in deinem Peräa, an den Ufern des Jordans. Nun bangt unserem Hohepriester Kaiphas, dass das Übel in Eilschritten sich Jerusalem nähern könnte.“
„Kaiphas? So, so! Der rechnerische Mann mit dem flinken Gehirn? Oh, wir kennen ihn. Er ist es aber nicht selbst, durch dessen Mund die Geschicke der Judenschaft gelenkt werden. Der treibende Geist sitzt hinter ihm in Gestalt seines Schwiegervaters Hannas, des Sohnes Seths, des alten Tigers, der erbarmungslos seine Zähne in das Fleisch seiner Feinde hakt und doch so tut, als wäre er gar nicht mehr in der Welt. Oh, keine Einwendungen, wir kennen Kaiphas und Hannas. Der alte Tempelsünder will noch immer den Hohepriester spielen, und die Hannassippe hat ihre Krallen stets nach der hohen Würde ausgestreckt. Fünf Söhne saßen hintereinander im hohepriesterlichen Amt, und nun muss ein Schwiegersohn herhalten, da das eigene Blut erschöpft ist. Solange dieser Sadduzäerkopf in eurer Hierarchie noch Gedanken formt, wird Juda stets grimmig hassen, was sich gegen seine Sünden aufbäumt.“
„Darüber magst du deine eigenen Gedanken haben, hoher Herr, aber wir können sie nicht teilen. Nicht Hannas´ hütender Geist sorgt sich um Juda, das Volk selbst ist empört über die zersetzende Lehre des Nazareners. Du hast uns schon einmal geholfen, als der böse Feind sich im Herzen Judas erhob, du hast ihn abgeschüttelt von uns, als du diesen Johannes töten ließest –“
„Weg mit dem Totenbild!“ Herodes brüllt es in die mahnenden Gestalten. Er geht zum Fenster und starrt in den sinkenden Abend. Sein Atem keucht durch die plötzliche Stille. Dann spricht er über die Achsel zurück: „Was habt ihr gegen den Nazarener?“
„Er ist ein falscher Messias, wirft mit Wundern um sich, die aus des Scheols Bereich stammen. Wie Theudas einst die natürlichen Gesetze zerbrechen wollte, so wandelt dieser Galiläer die Erscheinungen der Natur durch seinen Zauber um. Man raunt sich Ungeheuerliches zu. Er soll die kleinen syrischen Pferde in riesige Kamele verwandelt haben, mit denen er dann das Land überziehen wolle.“
„Narrt euch selbst, aber nicht mich mit solchen Kamelalbernheiten.“ Das Blut des Tetrarchen wallt auf. „Die Ausstreuer solcher Lügenmären sollte man dem Jus gladii des Landpflegers überantworten.“
Elkana prustet es anklägerisch heraus: „Des Teufels Spiegelfechterei hat von einer wunderbaren Geburt in Bethlehem gefabelt, wo Jesus zur Welt kam. Von dort kam das Übel auf, das sich gottbegnadet gebärdet und in Wahrheit des Satans Gebräu in sich wallen lässt. Du hättest hören sollen, wie er unser Volk besudelt hat. Ungläubige Klötze hieß er uns und sagte, ein Hurer gehe leichter in das Reich Gottes ein denn ein Jude.“
Dem Abinoam machte das Lügenfeuer seines Mitbruders Mut. „Ja, hoher Tetrarch, und er sagte, der Tempel sei nutzlos, und Moses sei nichts ohne ihn, den Nazarener.“
Und Joras geiferte: „Der Tempel, soll er gesagt haben, so wahr ich da steh – der Tempel diene den Priestern mehr als den Gläubigen. Der lebendige Tempel im Herzen überrage den steinernen auf Zion. Und nur wenigen Auserkorenen gelänge es, sagte er, den Herzenstempel zu bauen, und die Bausteine seien die Tugenden der frommen Menschen. Das ist geistiger Firlefanz. Und wie schaut dieser Mensch die Zukunft? Er sagt, es werden einst Hohepriester kommen, die in seinem Namen sündigen werden, indem sie mit dem Geld der Gläubigen Tempel bauen und ihren Namen verehren lassen werden statt Gottes Namen.“
Herodes zuckte die Achsel. „Wer kann sagen, ob er nicht recht hat? Aber nur weiter mit deiner Sudelei.“
Elkana bläht sich auf. „Er stößt die Beschlüsse der Synagoge um und leugnet die Kraft des Gesetzes. Er verdammt die, die nicht an seine göttliche Herkunft glauben, und hält die Heiden für ein auserwähltes Volk, nicht uns.“
Herodes stößt eine Lache aus. „Das geht euch freilich wider den Strich, ihr hochmütigen Seelenverweser.“
„Auch das Opfer hat er uns verleidet. Weiß er denn nicht, dass wir Priester am Opfer hängen müssen, dass wir dazu erzogen sind und von ihm leben? Was soll uns das Gebet des einzelnen in der Kammer, wie er´s verlangt? Davon können wir uns nicht ernähren, es macht uns am Ende überflüssig. Opfer, heilige Handlungen, Zeremonien, Bräuche, alles verdammt er, und in Kapernaum sagte er: ,Nicht mit toten Lippen sollst ihr Gott ehren, er verlangt ein blutvoll schlagendes Herz.‘ Was beginnen wir mit solchen Worten? Sie scheuchen allmählich das Volk aus den Tempeln und Synagogen und machen es selbständig, ja vielleicht gar sündenlos. Aber was machen wir mit einem sündenlosen Volk?“
Wieder schüttelt sich Herodes vor Lachen. „Ja, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Was macht ihr Priester mit einem sündenerlösten Volk? Ihr lebt doch von seinen Sünden und seiner Angst vor dem Scheol. Und dazu erfindet ihr noch Gesetzesfeinheiten, Übertretungen und dergleichen mehr, die ihr dann Sünde nennt. Ich blicke nun klar, das Licht des Nazareners leuchtet in eure Finsternis, deckt manches Faule auf, und ihr fürchtet euch vor diesem Licht und löscht es daher lieber aus. Die Liebe, die er predigt, bräche euren Hass entzwei. Diese Liebe allein entfernt ihn von euch Juden. Geht, geht, ihr solltet vorsichtiger denken. Einst sagte König Ahab, dass Elias das Volk verwirre, und doch habt ihr Elias als Propheten vergöttert. Ihr könnt das gleiche mit Jesus tun. Ich weiß nicht, wer er ist. Vielleicht ist er wahnbesessen, vielleicht ein armer Schlucker, der auf diese Weise in der Leute Mund kommen will. Ich kann und will nicht an ihn heran. Werdet selbst mit ihm fertig, und zwar auf eine Weise, die die Nachwelt unterschreiben kann. Sei er nun Gott, Teufel, Mensch, Untier, ein Höherer mag ihn richten, dem ihr die Fähigkeit dazu ruhig überlassen könnt. Ihr selbst seid dazu untauglich.“
Die drei Dunkelmänner wollten sich vor Scham verkriechen. Aber noch immer gab Elkana die Hoffnung nicht auf, sich durchzusetzen.
„Du hast keinen Honig auf deiner Lippe, Herr. Erfahre noch, was er sich zu sagen erkühnte. Das menschliche Gesetz – und des Tetrarchen Landesgesetz und die römischen Gesetze sind doch menschlich gedacht – dürfe man straflos umgehen, wenn es sich gegen Gott wende. Hörst du, Tetrarch? Das ist doch offensichtlich Aufwiegelei gegen die Obrigkeit. Und von dieser sagte er, sie sei eine Einrichtung, die mit den Schwächen der Menschen rechne, ohne den Willen zu haben sie aufzuheben.“ Elkana blickte triumphierend seinen Herrn an.
Aber Antipas wehrte den vermeintlichen Hieb ab. „Man hat mir erzählt, einige Pharisäer hätten ihn gefragt, ob es recht sei, dem römischen Kaiser Tiberius die Steuer zu bezahlen.“
Die drei jämmerlichen Ankläger frösteln zusammen. Freilich wussten sie davon. Ihre Gesichter ziehen sich in die Länge.
„Und was hat euer fürchterlicher Aufwiegler darauf geantwortet? ,Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist.‘ Damit schlug er eure heuchlerische Ausholung in den Wind. Geht, geht, meine Köche haben die Hühner fertig gebraten. Mich verlangt´s, was Besseres zwischen den Zähnen zu haben als eure zähen Klagen. Der Abend ist verpfuscht, widmet man sich eurer Beschwer. Geht in euren Tempel und betrügt das Volk weiter. Mit dem Nazarener verschont mich.“ Und zu seinem Kämmerer: „Auf! Auf! Die Köche herbei! Ihre Hirne an die Arbeit! Sie sollen aus nichts etwas machen, zarten Zuckerbrei auf meine Zunge! Das Geschwätz hat meinen Gaumen trocken gemacht! Mamertinischen Wein her! Der Nomenklator soll mir die Liste der Gäste vorlegen!“
Da geben sie alle Hoffnung auf. Der Tetrarch erinnert sie an einen sauren Apfel, in den zu beißen kein Vergnügen ist. Vielleicht ließe sich bei Pontius Pilatus, dem Feind des Tetrarchen, ein gnädigeres Ohr erwarten.
Fünftes Kapitel