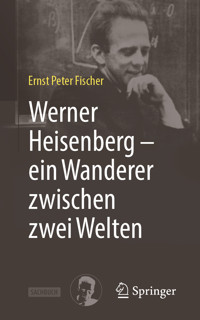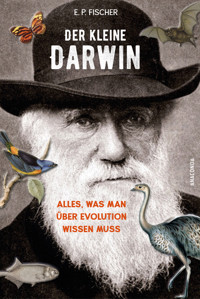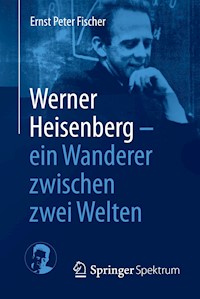Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Religion und Naturwissenschaft – ein ewiger Gegensatz? Nein, sagt der renommierte Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer. Das Gegenteil ist richtig: Religion und Wissenschaft ergänzen sich. Die eine kann nicht ohne die andere. Alle Wissenschaftler – von Thales bis heute – haben gewusst, dass der Glaube an die Götter zu den Menschen gehört. Ernst Peter Fischer nimmt den Leser mit auf einen faszinierenden Gang durch die Geschichte des menschlichen Erkenntnisgewinns: Vom Ursprung der Welt über das Wesen des Menschen bis hin zur Rolle Gottes. Ganz nebenbei erfahren wir mehr über Isaac Newton und die Hintergründe seiner Gravitationslehre, wir lernen, warum es ohne Rasiermesser keine Wissenschaft gibt und was es mit dem Maxwell'schen Dämon auf sich hat, wir begleiten den ausgemachten Atheisten Charles Darwin auf die Galapagos-Inseln und erfahren auch, warum Sigmund Freud wahrscheinlich doch nicht recht hatte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Peter Fischer
Gott und der Urknall
Religion und Wissenschaft im Wechselspiel der Geschichte
Textnachweis:
>Seite 7: EINE FESTSTELLUNG, aus: Erich Kästner, KURZ UND BÜNDIG, © Atrium Verlag 1948 und Thomas Kästner.
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2017
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster, Belgern
ISBN (E-Book) 978-3-451-80930-9
ISBN (Buch) 978-3-451-32986-9
Inhalt
EinblickDer Himmel der Vögel und der Engel
1. »Alle Dinge sind voll von Göttern«Die Anfänge des Wissens in der Antike
2. »Der Philosoph hat zu beweisen, was er sagt«Die Harmonie von Wissenund Glauben im Mittelalter
3. »Wie nun der Schöpfer gespielet …«Wissenschaft als Gottesdienst in der Neuzeit
4. »Das Erfahren von Wahrheit ist das Ziel«Alchemisten und Augen im arabischen Haus der Weisheit
5. »Gott dauert für immer, auch ist Er überall anwesend«Der Aufstieg der modernen Physik und seine gläubigen Betreiber
6. »Meine Speziestheorie ist mein Evangelium«Die Evolution des Lebens und die Reaktionen der Gläubigen
7. »Das Losungswort lautet: Hin zu Gott«Auf dem Weg in das Innerste der Welt und an ihren äußeren Rand
8. »Zigeuner am Rand des Universums«Zur Gottlosigkeit der Molekularbiologen in Zeiten des Urknalls
Ausblick»Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, der hat auch Religion« (Goethe)
Angaben zur Literatur und Zitaten
Zeittafel
Über den Autor
Namensregister
EinblickDer Himmel der Vögel und der Engel
»Imagine there’s no heavenabove us only sky«
John Lennon
Wir haben’s schwer,Denn wir wissen nur ungefähr, woher,jedoch die Frommen wissen gar, wohin wir kommen!Wer glaubt, weiß mehr.
Erich Kästner, Eine Feststellung
Wer tagsüber an den Himmel schaut, erblickt oftmals Wolken, die als gestaltfreudige und meist weiße Ansammlungen von Wassertröpfchen und Eiskristallen vor einem blauen Hintergrund schweben, ohne herunterzufallen (was kein Wunder ist, sondern erklärt werden kann und einen Versuch lohnt). Wer nach Einbruch der Dunkelheit an den Himmel schaut und dies in Regionen unternimmt, die nur gering oder gar nicht mit Straßenbeleuchtung ausgestattet sind, kann in einer wolkenlosen klaren Nacht anfangen, die Sterne am Himmelszelt zu zählen, die mit bloßem Auge sichtbar sind. Menschen benutzen diesen Ausdruck »Himmelszelt« gerne für das kosmische Gewölbe, das sich augenscheinlich über ihnen spannt und das früher auch als Firmament bekannt war und in dieser Form Eingang in die Dichtung gefunden hat. Der alte und heute vielleicht noch in Liedern gebräuchliche Name erklärt sich daher, dass die Menschen sich in vorwissenschaftlichen Zeiten vorstellten, an diesem Firmament, das sich sprachlich vom lateinischen Ausdruck für »Befestigungsmittel« ableitet, seien die Himmelskörper angebracht, deren funkelndes Licht die Augen erreicht, von dem die Menschen erst verzückt und dann zu Beobachtungen angeregt werden. Hinter diesem soliden Gebilde läge dann der eigentliche offene Himmel, der zwar einer sinnlichen Erfahrung entzogen bleibt, den Menschen aber schon früh im Verlauf ihrer kulturellen Geschichte als einen wirklich vorhandenen höheren Ort für etwas Überirdisches auserwählt haben. Diese himmlische Vorstellung lässt sich ohne Umschweife auch als eigenständige und wirkmächtige Sphäre des Überirdischen oder Göttlichen beschreiben, wie gleich noch genauer erläutert wird.
Wer tagsüber seinen Blick nach oben richtet, kann auch heute dort zwei Arten von Himmel sehen oder wahrnehmen wollen, die in der englischen Sprache als »sky« und »heaven« unterschieden werden und mit denen der als vergänglich erlebte Aufenthaltsbereich von Menschen von dem als ewig angesehenen Gemach für das Göttliche abgetrennt wird.
Aus der deutschen Romantik ist die Idee bekannt, dass Menschen über zwei Augenpaare verfügen und beim Betrachten der Welt mit den sinnlichen Sehorganen im Kopf erst das auf sie zukommende äußere Licht wahrnehmen, bevor sie mit den inneren – seelischen – Augen im Dunkel das Eigentliche erkennen. Mit dem ersten (organischen) Augenpaar in ihrem Gesicht sehen die Menschen den einen Himmel, den sky, aus dem die Luft kommt, die sie atmen, und in dem unter anderem Vögel, Fußbälle und Flugzeuge umherfliegen. Und mit dem zweiten (ätherischen) Augenpaar in ihrem Inneren sehen die Menschen den anderen – höheren – Himmel, den heaven, und in dem »muss ein lieber Vater wohnen«, wie der Chor in Schillers »Ode an die Freude« überzeugt ist und jubelnd mit der Musik von Beethoven singt. Dort »überm Sternenzelt« muss man den Schöpfer suchen, wie der Dichter vorschlägt und verkündet, und viele Menschen schauen tatsächlich dankbar in die empfohlene Richtung, wenn ihnen etwas Besonderes gelungen ist, wie etwa bei Fußballspielern nach einem erfolgreichen Torschuss beobachtet werden kann. Sie recken die Arme in die Höhe und blicken verzückt auch an einen wolkenverhangenen oder künstlich beleuchteten Himmel und versuchen dabei keineswegs, im erdzugwandten Bereich des Himmels Sterne zu zählen. Sie hoffen vielmehr, dass dort oben ein »lieber Vater« in seiner über- oder außerirdischen Sphäre bemerkt, wie sie mit strahlenden Augen zu ihm hinaufschauen, weil sie sein huldvolles Wirken und gnädiges Eingreifen beim erfolgreichen Torschuss bemerkt haben – allerdings ohne sich zu fragen, was der gerade überwundene Torhüter der gegnerischen Mannschaft jetzt von dem »lieben Vater« zu halten hat, der ihm doch wohl gründlich die Laune verdorben und seinem Team den möglichen Sieg vermasselt hat.
Im siebten Himmel
Übrigens: Wer Grund zu übergroßer Freude hat, fühlt sich manchmal »im siebten Himmel« oder »auf Wolke sieben«, wie jeder schon einmal gesagt und hoffentlich auch erlebt und empfunden hat. Diese Siebenzahl leitet sich aus dem Denken des griechischen Philosophen Aristoteles ab. Bei ihm kann auf der einen Seite die kosmische Zweiteilung des Weltalls gefunden werden, die oben als irdische und überirdische Bereiche eingeführt worden ist. Aristoteles richtet sein Denken dabei am Mond aus und unterscheidet eine sublunare Sphäre mit den Menschen und ihren Zufälligkeiten von einer supralunaren Sphäre ohne sie. In ihr soll eine Art vollkommene Regelmäßigkeit herrschen, wie sie nur Göttern zu verdanken sein kann. Bei Aristoteles findet sich aber auch eine Einteilung des Himmels in sieben durchsichtige Gewölbe (Schalen), wobei deren Zahl durch die Menge der damals bekannten Planeten zu erklären ist, von denen noch die Rede sein wird. In dem skizzierten Schema gibt es also einen siebten Himmel, und mit ihm kommt die antike Welt zu einem Abschluss. Im siebten Himmel endet in dieser heidnisch kosmischen Konstruktion die materielle Welt, und das Reich der Wünsche und Träume öffnet seine Tore, ganz wie es sich die Menschen damals und heute erhoffen und immer wieder ausdrücken.
Die Vorstellung von sieben Himmeln findet sich übrigens nicht nur in der zitierten heidnischen Philosophie der griechischen Gelehrten, sondern auch im hebräischen Talmud und im muslimischen Koran. Trotz dieser Universalität soll die Siebenzahl hier nur vorübergehend erwähnt werden, weil das ungeteilte Augenmerk der erwähnten, nach wie vor unübersehbaren und durchgängigen Dopplung des Firmaments gelten soll, und solch eine Dichotomie oder Dualität ist nicht nur an dieser Stelle der menschlichen Geschichte zu finden. Sie macht offenbar einen Grundzug im humanen Denken aus, auch wenn viele Menschen darüber gerne hinwegsehen. So zeigt sich die Zweiteilung in einen weltlichen und einen göttlichen Himmel unter anderem in dem Mit- und Nebeneinander von heidnischen und christlichen Kulturen. Sie zeigt sich weiter in dem Gegenüber von säkularen und religiösen Haltungen und Vorgehensweisen, und sie tritt ganz allgemein in dem durchgehenden Wettstreit von Glauben und Wissen in der menschlichen Kultur in Erscheinung, der in seinem historischen Verlauf das Thema dieses Buches sein soll. Seine These lautet:
Menschen suchen immer das Eine, und sie finden es, wenn sie das Andere nicht vergessen, das dazugehört und zu ihm hinführt.1 Um zu verstehen, wie das Eine und das Andere sich den Menschen gezeigt haben, lohnt der Blick auf einen besonderen Wendepunkt in der Kulturgeschichte, der im Folgenden vorgestellt wird.
Die Achsenzeit
Die Menschen, die heute leben, können als Nachfahren von Volksgruppen oder Gemeinschaften betrachtet werden, die das erfahren und durchlebt haben, was seit den Tagen des Philosophen Karl Jaspers als Achsenzeit bekannt ist und was von Historikern und Philosophen seit diesem Anfang erst allmählich und inzwischen immer intensiver erforscht wird. Wie Jaspers in seinem 1949 erschienenen Buch »Vom Ursprung und Ziel der Geschichte« anmerkt, kommt es in den Jahren zwischen 800 und 200 vor Christus (vor der modernen Zeitrechnung) zu einer besonderen Entwicklung bei dem Werden von Menschen und dem Erwachen ihres Denkens. In den damaligen Hochkulturen – in Indien ebenso wie in Iran, in China genauso wie in Palästina und Griechenland – kommt weltweit das überlieferte mythische Denken mit seinen sagenhaften Erzählungen zu einem Ende, und es wird umfassend abgelöst und ersetzt von systematisch vorgehenden Reflexionen über die Grundbedingungen des menschlichen Daseins, die dann zu Fragen nach dem rechten Handeln führen. Es kommt – nach einem Vorschlag des Soziologen Hans Joas – zu einer scharfen quasi-räumlichen Trennung zwischen dem Weltlichen (sky) und dem Göttlichen (heaven), und bei diesem Umbruch tauchte aus nach wie vor geheimnisvollen Gründen und auf bislang rätselhaft bleibenden Wegen die Vorstellung auf, »wonach es ein jenseitiges, eben transzendentes Reich gebe«. Während zuvor, so Joas, »im mythischen Zeitalter, das Göttliche in der Welt und Teil der Welt war, also keine wirkliche Trennung zwischen dem Göttlichen und dem Irdischen stattgefunden hatte und die Geister und Götter direkt beeinflusst und manipuliert werden konnten, weil sie eben Teil der Welt waren oder das Reich der Götter zumindest nicht viel anders funktionierte als die irdische Welt, tut sich mit den neuen Erlösungsreligionen und Philosophien der Achsenzeit eine erhebliche Kluft auf zwischen beiden Sphären. Das Göttliche – so der zentrale Gedanke – ist das Eigentliche, das Wahre, das ganz Andere, dem gegenüber das Irdische nur defizitär sein kann.«
Es dauerte nach diesem historischen Wendepunkt eine geraume Zeit, bis Menschen vor allem in Europa im frühen 17. Jahrhundert dem Irdischen erneut einen Wert bemessen und ihr Nachdenken verstärkt auf die Natur und ihre Abläufe richten, um mehr Wissen über sie zu erwerben mit dem Ziel, Einfluss auf die Dinge der Welt nehmen zu können. Sie träumen davon, »die Bedingungen der menschlichen Existenz zu erleichtern«, wie Bert Brecht seinen Helden im »Leben des Galilei« ausrufen lässt. Er definiert mit diesen Worten, was als Ziel der modernen Wissenschaft verstanden werden kann, die in den kommenden Epochen neben der Religion entsteht und zu ihrem ständig an Überzeugungskraft gewinnenden Konkurrenten heranwächst. Seit den Tagen von Galilei und seinen Zeitgenossen gilt für Menschen, was Robert Musil den Helden in seinem Roman »Mann ohne Eigenschaften« in doppelter Verneinung formulieren lässt, nämlich »man kann nicht nicht wissen wollen«. Und seitdem stehen die Mitglieder der Spezies Homo sapiens – und vor allem ihre heute lebenden Exemplare – vor einem Dilemma.
Auf der einen Seite streben alle Menschen von Natur aus nach Wissen, wie bereits Aristoteles zu Beginn seiner »Metaphysik« festgestellt hat, weil sie Freude an der Welt unter ihren Füßen haben, die ihnen sinnlich zugänglich ist, was sie neugierig macht und sie anregt, sie verstehen zu wollen. Auf der anderen Seite glauben sie an das Vorhandensein einer göttlichen Sphäre, der gegenüber das irdische Jammertal belanglos, unwesentlich und überwindungsfähig erscheint und mit der sie in Kontakt kommen oder bleiben wollen, weil sie von dort Hinweise auf den Sinn des Lebens erwarten.
Sowohl die Möglichkeiten des unerschütterlichen Glaubens an einen Himmel voller Engel als auch das Potenzial, immer mehr Wissen über einen Himmel voller Planeten und Kometen zu erlangen, gehören gemeinsam und untrennbar zu den grundlegenden Fähigkeiten von Menschen und entfalten sich durch ein spannendes Wechselspiel im Verlauf ihrer Geschichte. Dabei gibt es Zeiten, in denen der Glaube dominiert. Und sie werden abgelöst von Zeiten, in denen mehr dem Wissen ein höherer Wert zugeschrieben wird. Es gibt im Leben des Einzelnen und im Leben der Gattung Mensch immer die zwei erwähnten Augenpaare der Romantiker, die sowohl das Eine als auch das Andere sehen, wobei in diesem Buch eine schärfere Formulierung vorschlagen und vertreten wird. Sie lautet, dass das ersehnte Eine überhaupt erst durch das erlebte Andere entsteht. Das Eine, das zum Beispiel als Einheit des Wissens oder als Einheit des Glaubens lockt und angestrebt wird und in dem sich der menschliche Wunsch nach einer – wörtlich verstandenen – Einfachheit zeigt, kommt nur dadurch und in dem Moment zustande, in dem »das Eine durch das Andere« gesehen wird, in dem – mit anderen Worten – das Eine als etwas begriffen wird, zu dem zwei gehören – der eine Himmel zum Beispiel als Ort der Wolken und als Reich des Herrn, der eine Jesus aus den biblischen Erzählungen als Sohn Gottes und als Kind von Maria und Josef, und der eine Mensch, der heute als Homo sapiens die Erde bevölkert und als Lebewesen sowohl seinen freien Willen auslebt als auch durch eine göttliche Vorbestimmung oder gar die Vorsehung an einen Herrn im Himmel gebunden zu sein glaubt. Diese Zusammengehörigkeit drückt sich in dem Wort »religiös« aus, das von einer Rückbindung kündet, einer Religion eben.
Das Eine durch das Andere – das gehört längst auch zum Erkenntnisprinzip der Naturwissenschaft, mit dem etwa das eine Licht, das den Menschen leuchtet, nicht nur als Erscheinung einer Welle, sondern auch als Bewegung von Teilchen erfasst, und mit dem eine Person, die jemand ist, auf der einen Seite als individueller Körper und auf der anderen Seite mit gleicher Berechtigung als Teil einer Gemeinschaft zu verstehen ist, ohne die es den Menschen nicht gibt. Die Einsicht in die Doppelnatur des Lichtes geht auf Albert Einstein zurück, der in diesem Zusammenhang 1905 auch bemerkt hat, dass mit diesem Gedanken etwas Besonderes in die Welt der Wissenschaft gelangt. Denn wenn Licht sowohl Welle als auch Teilchen und beides zugleich sein kann, dann können Menschen nicht mehr eindeutig sagen, was es ist. Licht bleibt somit trotz aller Wissenschaft und technischen Verfügbarkeit geheimnisvoll, und das sollte man dankbar zur Kenntnis nehmen. Denn damit erlaubt die exakte Wissenschaft den Menschen, ein Gefühl für das Geheimnisvolle der Welt zu entwickeln, und das ist das Schönste, was ihnen passieren kann, wie Einstein ebenfalls in diesem Zusammenhang bemerkt und festgehalten hat.
Aber nicht nur die Wissenschaft kann auf diese wunderbare Weise die Welt verzaubern. Der Religion gelingt dies auch – und wahrscheinlich sogar unmittelbarer und deshalb für viele Menschen überzeugender –, denn »das Christentum ist die Sprache eines Weltgefühls, das den Überschuss [im Welterleben] als das Aufleuchten göttlicher Gegenwart in der Welt versteht«, wie Jörg Lauster in seiner Kulturgeschichte des Christentums anmerkt, der er den Titel »Verzauberung der Welt« gegeben hat. Religion und Wissenschaft, sie beide verzaubern die Menschen und gehören allein deshalb zusammen. »Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft blind«. So hat erneut der unvermeidliche Einstein den Gedanken auf wunderbare Weise formuliert, wobei er über sich selbst die Auskunft gegeben hat, dass er bei seinem Weg zum Erkennen so etwas wie eine kosmische Religiosität empfindet. Das Eine geht nicht ohne das Andere. Das Eine braucht das Andere – wie in jedem Dialog, der sich mit Bildung abmüht. Bildung meint etwas, das (gebildet) ist, und etwas, das (gebildet) wird. Darum geht es auf den kommenden Seiten. Es geht um das Weltbild, das entsteht, wenn die Religion die Wissenschaft hervorbringt und die Wissenschaft die Religion beeinflusst. Ein spannendes Spiel, bei dem die Menschen Zuschauer und Mitwirkende zugleich sind.
1 An dieser Stelle sei der privat anmutende Hinweis erlaubt, dass sich auch die Sexualität in dieses Denkmuster einfügt. Wie es so heißt, wollen Menschen dabei immer nur das Eine. Sie brauchen aber den Anderen oder die Andere dazu. Das Eine geht nur mit den jeweils Anderen.
1. »Alle Dinge sind voll von Göttern«Die Anfänge des Wissens in der Antike
»Religion ist die Bindung des Menschen an Gott«, wie es der große Physiker und Philosoph Max Planck in einer persönlich gehaltenen Rede ausgedrückt hat, für die er im Mai 1937 in das Baltikum gereist ist. Der erklärte Begriff ist heute sehr gebräuchlich und leicht verständlich, aber ein Wort für die von Planck gemeinte Art von »Religion« stand weder der vorchristlichen Zeit noch der lateinischen Sprache zur Verfügung, wie der Kirchenvater Augustinus mehr als tausend Jahre vor Planck in seinen Schriften beklagt hat. Die Betrachtung des Wechselspiels von Religion und Wissenschaft muss somit in einer Zeit beginnen, in der es weder das eine noch das andere in dem heute vertrauten und definierbaren Sinne gab. Gemeint ist die griechische Antike, in der bekanntlich die Geburt der Philosophie – das Aufflackern der menschlichen Liebe zur Weisheit – zu feiern ist und in deren Verlauf unabhängig von der genannten sprachlichen Situation viele herausragende Individuen eine Fülle von Wissen erwerben konnten. Und während sie dies taten, ließen ihre Zeitgenossen weiter in ihren Hinterköpfen den Gedanken zu, dass nach wie vor zahlreiche Götter tätig waren und auf die Geschicke der Welt und ihrer Bewohner sehr persönlich Einfluss nahmen.
Etwa im Jahre 700 vor Christi Geburt hat der griechische Dichter Hesiod eine Schöpfungsgeschichte vorgelegt, die als Theogonie bekannt ist und vom Auftreten der Götter berichtet, die auf diese Weise in eine von Menschen bewohnte Welt kommen und sich anschließend in ihr umtun und auf sie einwirken. Hesiod stellt sich nach einem als Chaos bezeichneten Anfang der Welt als Ganzes den Auftritt von einigen Urgottheiten vor, zu denen unter anderem ein Wesen namens Nyx gehört, das als Göttin der Nacht fungiert. Mit ihr erklärt sich auf diese höchst personale Weise das allmähliche Hereinbrechen der Dunkelheit am Abend, das moderne Menschen eines wissenschaftlich geprägten Zeitalters humorlos als Schatten der Erde verstehen.2 Mit den angesprochenen »göttlichen« Erklärungen erhebt die aufkommende griechische Philosophie ihr kluges Haupt, um sich bald von mythologischen Inhalten zu lösen und versuchen, statt phantasievoller Erzählungen natürliche Erklärungen für den aus dem Chaos gebildeten Kosmos zu liefern. Sie raubt damit den fernen Göttern einen Teil ihrer Macht und weist den nahen Menschen eine aufklärende Rolle zu. Anzumerken ist, dass es den frühen Naturphilosophen nicht um das Finden von Naturgesetzen ging, von deren Existenz sie weder etwas wussten noch etwas wissen konnten. Selbst wenn man ihnen gesagt hätte, dass es zum Beispiel so etwas wie ein Gesetz der Schwerkraft gibt, hätten sie sich – anders als moderne Zeitgenossen – darüber sehr gewundert und sich erkundigt, wer solch ein Gesetz denn erlassen und in die Welt gebracht habe. Eine gute Frage, zweifellos, und mit ihr sind die Menschen nach wie vor beschäftigt, wie im Verlauf der kommenden Darstellungen immer wieder betont und verdeutlicht wird.
Der erste Astronom
Den ersten Erwerb des frühen Wissens in moderner Form schreiben die Historiker dem Auftreten und Wirken eines Mannes namens Thales von Milet zu. Der antike Urvater der Wissenschaft lebte um 600 vor Christus, und als er zum Beispiel über Geometrie nachdachte, erkannte er bei seinen Bemühungen, dass ein Dreieck, das man in einen Halbkreis einzeichnet und dessen Grundseite der dazugehörige Durchmesser ist, dort einen rechten Winkel bekommt, wo das Dreieck mit seiner Spitze den Kreisbogen berührt. Dieser vielleicht kompliziert klingende, aber leicht zu veranschaulichende »Satz von Thales« gehörte in meinen Tagen noch zum Schulstoff – und ich erinnere mich bis heute an seinen Beweis –, während er zu Lebzeiten des Geometers kaum besonderes Interesse gefunden hat. Es gab zu viel anderes, das die philosophische Aufmerksamkeit und das Denken der Griechen fesselte (Abb. Der Satz von Thales und sein Beweis).
Der Satz von Thales und sein Beweis
Zum Beweis des Satzes von Thales zieht man eine Gerade von der Spitze des ursprünglichen Dreiecks auf die Mitte M der Grundseite. Dadurch bekommt man zwei kleinere Dreiecke, in denen jeweils zwei Seiten gleich lang sind – so lang wie der Radius r des Kreises. Der Winkel, auf den es ankommt, kann als Summe (α + β) von zwei Winkeln berechnet werden, die es in den beiden gleichschenkligen Dreiecken zweimal gibt. Da die Winkelsumme in jedem Dreieck 180° ausmacht und die beiden Winkel bei M ebenfalls 180° ergeben, ist leicht auszurechnen, dass dann auch 2α und 2β dieselbe Winkelsumme zusammenbringen. Mit anderen Worten, α + β zusammen bilden einen rechten Winkel, was zu beweisen war – quod erat demonstrandum (qed).
In seinen irdischen Tagen berühmt geworden ist der antike Philosoph und Forscher durch eine Leistung, über die der Geschichtsschreiber Herodot in seinen vielgelesenen Historien berichtet. Ihm zufolge konnte Thales für den 28. Mai 585 vor Christus mit Erfolg das Auftreten einer Sonnenfinsternis vorhersagen – ein Phänomen, das die Menschen heute noch beeindruckt und das damals ganz sicher ungeheure Aufmerksamkeit auf sich lenken konnte, selbst wenn oder gerade weil man auf eine kommende Konfiguration am Himmel hinweisen und das Geschehen auf diese Weise gedanklich beherrschen konnte. Und wenn auch nicht überliefert ist, mit welchen Methoden dem Mann aus Milet die himmlische Prognose gelungen ist, so zeigt sich mit diesem Hinweis doch, dass er hauptsächlich als Astronom tätig war und Erfolg hatte, wie man heute sagen würde. Das heißt, Thales von Milet profilierte sich in der ältesten aller Wissenschaften, die sich kurioserweise mit den am weitesten entfernten Objekten abgibt. Es heißt zwar als Redensart: »Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.« Aber die fernen Sterne am Himmel zogen trotzdem die erste wissenschaftliche Aufmerksamkeit der Menschen auf sich, weil sie in der hier verhandelten Zeitepoche der griechischen Antike das zugleich bestimmte und geheimnisvolle Gefühl bekamen, in einem Kosmos zu leben. Gemeint ist mit dem ansprechenden Wort eine schöne Welt, deren Ordnung sich als etwas herausstellte, das den Menschen und ihrer Vernunft zugänglich war. Und wenn sie dies so empfanden, dann konnte in ihnen die Idee auftreten, dass die Götter, die den Kosmos aus dem Chaos geschaffen hatten, ihren Geschöpfen auf der Erde mit den strahlenden Formationen am Horizont und darüber hinaus etwas mitteilen wollten. Als Folge davon entstand eine Astrologie, die sich bemühte, die göttliche Botschaft – also den Logos – zu deuten, die in den Sternen stecken musste und für ihre Beobachter zu lesen sein sollte. Der zweite Teil des alten Namens Astrologie lebt merkwürdigerweise in der modernen Wissenschaft mit dem ursprünglichen Kosmos in Form einer Kosmologie fort, die längst nicht mehr nach Botschaften im Weltall Ausschau hält. Sie würde daher besser Kosmonomie heißen und damit wie die Astronomie klingen, die es seit den Tagen von Thales gibt. Ihm ging es nicht um das Lesen göttlicher Nachrichten, sondern um das Verstehen natürlicher Gegebenheiten und Abläufe, die sich am Himmel zu erkennen gaben, wie jetzt zu schildern sein wird, wobei gleich anzumerken ist, dass es noch mehr als 2000 Jahre dauern wird, bis die Menschen die Naturgesetze erkennen und in geeigneter mathematischer Form aufschreiben konnten, mit denen sich die Verläufe der zahlreichen Himmelskörper bestens verfolgen und gut berechnen lassen.
Die Qualitäten und Einsichten des Thales von Milet sind nicht in eigenen Schriften überliefert, sondern in Texten von Zeitgenossen zu finden, die bis in die heutige Zeit überlebt haben und emsig tradiert und ediert werden. Gemeint sind unter anderem die Werke der Philosophen Aristoteles und Platon. In ihnen finden sich zwei Anekdoten über das Leben des Thales, die beide Hinweise auf die Art und Weise geben, wie Menschen agieren können, wenn sie Lust an einem Wissen bekommen haben, das offenbar stimmt und die Neugierde befriedigt, was sie vor allem dazu bringt, ihren Blick immer wieder und weiter zu den Sternen am Himmel zu richten.
Bei Aristoteles geht es – nachzulesen in seiner Schrift zur Politik – darum, dass Thales aufgrund von astronomischen Beobachtungen in der Lage war, nicht nur eine seltene Sonnenfinsternis, sondern auch den Umfang der jährlich kommenden Olivenernte vorherzusagen. Und dieses Können hat der erste Astronom geschickt genutzt, wie Aristotles beschreibt:
»Als man ihm [Thales] wegen seiner Armut den Vorwurf machte, als ob die Philosophie nichts tauge, habe er, sagen sie, da er aufgrund seiner astronomischen Kenntnisse vorausgesagt hatte, dass die Olivenernte reichlich sein würde, noch im Winter mit dem wenigen Geld, das ihm zur Verfügung stand, als Handgeld, sämtliche Ölpressen in Milet und Chios für einen niedrigen Preis gemietet, wobei niemand ihn überbot. Als aber die Zeit [der Ernte] gekommen war und auf einmal und gleichzeitig viele Pressen verlangt wurden, da habe er seine Pressen so teuer verpachtet, wie er nur wollte und auf diese Weise sehr viel Geld verdient: zum Beweis dafür, dass es für Philosophen ein leichtes ist, reich zu werden, wenn sie dies wollen, dass es aber nicht das ist, was sie wollen.«
Es bleibt für heute lebende Menschen schwierig zu sagen, was Thales wirklich wollte. Bekannt ist nur, dass er den Sternen zugeneigt und der sich in ihnen zeigenden himmlischen Ordnung verfallen war, wie der Vorfall verdeutlicht, von dem Platon in seiner Schrift »Theaitetos« berichtet:
»Es wird erzählt, … dass Thales, als er astronomische Beobachtungen anstellte und dabei nach oben blickte, in einen Brunnen gefallen sei und dass eine witzige, reizende thrakische Magd ihn verspottet habe: Er strenge sich an, die Dinge am Himmel zu erkennen, von dem aber, was ihm vor Augen und vor Füßen liegen, habe er keine Ahnung.«
Platon ergänzt diese Anekdote noch durch den Hinweis, »derselbe Spott aber passt auf all diejenigen, die sich mit der Philosophie einlassen«.
Das Lachen der Thrakerin hat Menschen bis in das 21. Jahrhundert hinein veranlasst – unter anderem den Philosophen Hans Blumenberg, der ein ganzes Buch darüber verfasst hat –, über die Besonderheiten von zerstreuten Professoren oder anderen Intellektuellen nachzusinnen, die komplizierte Theorien über Gott und die Welt entwerfen und im einfachen Alltag verloren gehen, wenn sie etwa in einem Supermarkt Papiertücher einkaufen und an der Kasse bezahlen sollen. Doch da die oben vorgeführte Geschäftstüchtigkeit des Thales es unwahrscheinlich macht, dass er den Brunnen – und damit das, was ihm im Alltag vor Augen kommt und zu beschäftigen hat – in tiefe Gedanken versunken übersehen hat, lohnt die Überlegung, ob nicht eine andere Deutung der Geschichte in Frage kommen könnte. Sie besteht darin, dass die lachende Magd gar nicht verstanden hat, wie und warum Thales in den Brunnen gekommen ist. Er ist vielleicht überhaupt nicht in den Schacht hineingefallen, sondern hat sich gezielt in ihn hineinbegeben, weil sich aus der Perspektive und Tiefe eines Brunnens die Sterne besser beobachten lassen. Es waren schließlich deren Regelmäßigkeiten, die Thales interessierten und mit deren Verständnis er den Menschen einige Ängste nehmen konnte – zum Beispiel die vor einer verfinsterten Sonne, die man jetzt nicht mehr fremden (göttlichen) Mächten überlassen musste, sondern die man vorhersagen und erwarten und damit in gewisser Weise beherrschen konnte. Mit anderen Worten, Thales nutzte jede Gelegenheit zur wissenschaftlichen Tätigkeit, um auch denen zu helfen, die über ihn lachten, während er sich unter ungewöhnlichen Umständen abmühte. Wer vom Wunsch nach Wissen gepackt ist, kann ihn nicht zu einer bestimmten Stunde des Feierabends oder durch verständnislose Betrachter abstellen. Er muss diesem seinem ganz persönlichen und zutiefst menschlichen Wollen vielmehr sein Leben widmen, und Thales unternimmt genau diesen mutigen Schritt mit aller Konsequenz. Wer über ihn lachen will, sollte sich das genau überlegen. Es gehört sich eigentlich nicht.
»Alles ist aus dem Wasser und voll von Göttern«
Es muss eine mit dramatischen Gefühlen verbundene ungeheure Entdeckung gewesen sein, als Menschen zu erkennen begannen, dass sie in der Lage sind, den sie umgebenden und sie aufnehmenden Kosmos verstehen und vorhersagen zu können. Und es muss den ersten Vertretern von rationalen Analysen der empirischen Welt ein immenses Glückgefühl verschafft haben, als ihre Einsichten durch die Naturvorgänge bestätigt wurden, die genau so eintraten, wie man sich das gedacht und vorgestellt hatte. Es ist möglich, dass einige von ihnen diese ihre erschütternde Einsichtsfähigkeit als göttliche Offenbarung erlebt haben. Und es ist psychologisch verständlich, wenn sie sich unter diesen Vorgaben und mit wachsender Zuversicht daran machten, umfassende Theorien der Welt zu entwerfen, die möglichst rational nachvollziehbaren Gesichtspunkten folgten. Im Falle von Thales tauchte in ihm die grandiose Idee auf, dass Wasser der Ursprung aller Dinge sei, wie Aristoteles in seiner Schrift »Metaphysik« berichtet. Das Land, so soll Thales nach Worten aus dieser Schrift gelehrt haben, »ruhe auf dem Wasser«, und Aristoteles erläutert:
»Den Anlass zu dieser Ansicht bot ihm wohl die Beobachtung, dass die Nahrung aller Wesen feucht ist, dass die Wärme selber daraus entsteht und davon lebt; woraus aber jegliches wird, das ist der Ursprung von allem.«
Aristoteles ist dabei nicht entgangen, dass diese Ansichten von Thales nicht neu waren und
»… schon die Uralten, die lange Zeit vor dem gegenwärtigen Zeitalter gelebt und als die ersten in mythischer Form nachgedacht haben, die gleiche Annahme über die Substanz gehegt hätten. Diese bezeichneten Okeaonos und Tethys als die Urheber der Weltentstehung und das Wasser als das, wobei die Götter schwören.«
Wenn man will, kann man Thales als jemanden ansehen, der dadurch, dass er am Anfang des wissenschaftlichen Vorgehens steht, zugleich auch die Abkehr von traditionellen mythischen Erklärungen vorantreibt. Mit anderen Worten, Thales steht und agiert an einem Wendepunkt im abendländischen Denken, und verdeutlicht findet sich dieser Umschlag in dem Satz, mit dem er sowohl die Existenz einer Ursubstanz als auch die Allgegenwart des Göttlichen ausdrückt: »Alles ist Wasser, und die Welt ist voller Götter«, so soll der erste Forscher abendländischer Prägung gesagt haben, was unter anderem zeigt, dass schon bei ihm umfassend an eine zweigeteilte Wirklichkeit gedacht wird. Der philosophische Satz von Thales bedeutet auch, dass die Menschen in den Göttern stecken und sich in ihnen aufhalten. Die christliche Religion wird diesen Grundsatz umkehren und ihren Gott in die Menschen hineinbefördern, aber für diesen Schritt braucht es noch einige Jahrhunderte, und erst einmal haben die griechischen Philosophen aus heidnischen Tagen das Wort, was die Frage erlaubt, ob und wie weit man ihnen trauen kann. Anders ausgedrückt: Trifft das Wissen zu, das antike Autoren vortragen? Stimmen ihre Behauptungen? Oder spekuliert da jemand und denkt sich einfach mal etwas aus, das ihm passt und vernünftig erscheint? Welches Wissen von Thales kann als sicher verbucht werden – von den beweisbaren geometrischen Angaben über die rechten Winkel von Dreiecken, die in Halbkreisen entstehen können, einmal abgesehen? Worauf basierten seine Ein- und Ansichten?
Keine Frage: Thales hat irdische und himmlische Abläufe so vorhergesagt, wie sie eingetroffen sind. Aber es ist nicht überliefert, dass er irgendwelche Gesetze des Himmels gekannt hat, und die zitierte Idee mit dem Wasser wird niemand in unseren Tagen als zutreffend oder hilfreich bewerten. Somit stellt sich erneut und genauer die Frage: Was haben Thales und seine Mitstreiter in der griechischen Antike gewusst, und zwar in dem Sinne, wie er auch in der Gegenwart des 21. Jahrhunderts akzeptiert würde? Und wie haben sie es erfahren, gefunden und geprüft? Damit ist zum Beispiel gemeint, dass heute bekannt und verstanden ist, dass Gegenstände zu Boden fallen, weil es eine Schwerkraft gibt, die dafür sorgt, dass sich Massen gegenseitig anziehen. Ebenso gilt heute als verstanden, dass die Wärme (Temperatur) von Objekten durch die Bewegung ihrer Bestandteile (letztlich Moleküle und Atome) zustande kommt, selbst wenn man die nicht unmittelbar sehen kann.
Eine Einsicht, die weniger auf Gesetze und mehr auf die von den Griechen so geschätzte Geometrie abzielt, betrifft die Gestalt der Erde, die bereits in den vorchristlichen Jahrhunderten von den gebildeten Menschen nicht mehr als Scheibe angesehen wurde, auch wenn manche Schulbücher bis heute mit dieser Behauptung Geld verdienen und, viel schlimmer noch, ihre jungen Leser damit dumm halten. Bereits bei Pythagoras, der wenige Jahre nach der von Thales vorhergesagten Sonnenfinsternis geboren wurde, zeigte sich – wahrscheinlich anfänglich vor allem aus ästhetischen Gründen – davon überzeugt, dass die Erde als Kugel im Kosmos zu denken ist. Und spätestens Aristoteles hat diese Ansicht naturwissenschaftlich unterstützt und raffiniert begründet, indem er zum Beispiel auf den kreisförmigen Erdschatten hinwies, der sich bei einer Mondfinsternis am wolkenlosen Himmel zeigt, wobei der griechische Philosoph als guter Geometer zielsicher wusste, dass nur eine Kugel – im Unterschied etwa zu einem Zylinder – aus jeder möglichen Position heraus einen kreisförmigen Schatten entstehen lässt.
Natürlich stellt die Einsicht in eine kugelförmige Erde keine Lösung, sondern vor allem ein Rätsel dar, denn noch kennt in jenen Tagen niemand die vielfältigen Bewegungen und Drehungen des Heimatplaneten der Menschen, und auch weiß niemand über die oben erwähnte Schwerkraft Bescheid. Dies legt den Gedanken nahe, dass sich die Völker der Antike vorgestellt haben müssen, oben auf der von ihnen besiedelten Erdkugel zu wohnen, die selbst in Ruhe blieb und ihre Position hielt. Man kann sich dann den für Menschen zugänglichen Teil der Kugel sogar als eine Art Scheibe vorstellen, die in dem mit den äußeren Augen erkennbaren und den eigenen Gliedmaßen begehbaren Ausmaß kaum gekrümmt ist und an dem Horizont so etwas wie einen Abschluss findet. Das heißt, gewusst haben die griechischen Philosophen vor allem, dass sie mit ihrem Wissen ganz am Anfang steckten und noch nicht sehr viel wussten, was schließlich der berühmteste von ihnen – also Sokrates – kurz und bündig in dem ewig zitierten Satz zusammengefasst hat: »Ich weiß, dass ich nicht weiß.« Anzumerken ist dabei, dass es bei Sokrates nicht heißt, »Ich weiß, dass ich nichts weiß«, wie gerne zitiert wird. Denn eines wusste der weise Mann doch, dass er nämlich neugierig war und wissen wollte. Nur stand er zuletzt nach allem Suchen mehr vor offenen Fragen als vor abgeschlossenen Antworten, und selbst mit denen wusste er eben immer noch nicht, was er eigentlich wissen wollte, als er mit dem Fragen einsetzte.
Neben der Kugelgestalt der Erde gab es noch etwas Weiteres, das den Menschen in der Antike als Wissen deutlich vor Augen stand, weil sie es aus empirischen Beobachtungen und sorgfältigen Notizen gewonnen hatten. Diese Kenntnisse bekommen ihren besonderen Reiz, weil sie etwas Unerwartetes und vielleicht sogar Unerhörtes zu verstehen geben. Zu den umfassenden Überzeugungen der Antike gehörte die Ansicht, in einem Kosmos zu leben, also in einer geordneten und gottgefälligen Welt, die man auf diese Weise einer planenden Instanz – eben einer Göttersphäre – zuschreiben konnte, die dann auch dafür sorgte, dass die Himmelskörper auf Kreisen umliefen. Auf was für Bahnen denn sonst? Götter treten als perfekte Geometer in Erscheinung und lassen ihre Hervorbringungen auf Kreisen zirkulieren, und zwar regelmäßig und in voller Harmonie, wie man meinen sollte – doch zum allgemeinen Entsetzen traf genau dies nicht zu. Tatsächlich wurde im Verlauf der Himmelsbeobachtungen – die natürlich mit unbewaffnetem Auge und ohne eine Art von Fernrohr unternommen wurden – nach und nach deutlich, dass es Objekte im Weltall gab, die sich nicht an die erwartete göttliche Ordnung und ihr Gleichmaß hielten und sich stattdessen anders bewegten und am Himmel entlangwanderten. Diese Wanderer heißen heute Planeten, weil die Wurzel des dazugehörigen griechischen Wortes genau dies bedeutet. Zu diesen Planeten rechneten die antiken Astronomen neben Sonne und Mond noch fünf sichtbare Himmelskörper namens Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, und deren am Firmament beobachteten Verläufe brachten gravierende Probleme mit sich (siehe unten: Die Namen der Planeten). So irritierte es die alten Astronomen, »dass die zuletzt genannten fünf Planeten ihre nach Osten gerichteten Bahnen in auffällig unbeständigen Zyklen vollendeten, dass sie in Relation zu den Fixsternen periodisch schneller oder langsamer zu werden, manchmal sogar völlig stillzustehen und die Richtung zu wechseln schienen, während sie gleichzeitig mal mehr und mal weniger hell strahlten. Aus unerklärlichen Gründen setzten sich die Planeten über die perfekte Symmetrie und kreisförmige Einförmigkeit der Himmelsbewegungen hinweg«, wie sich zusammenfassend bei dem amerikanischen Philosophen Richard Tarnas in dessen Buch nachlesen lässt, in dem die Wege des westlichen Denkens unter dem Titel »Idee und Leidenschaft« beschrieben werden.
Immerhin – die griechischen Astronomen kannten diese Abweichungen und Unregelmäßigkeiten, auch wenn damit der Beweis hinfällig wurde, mit dem Platon die Existenz des Göttlichen im Universum zeigen und festnageln wollte. Die Wanderbewegungen der Planeten gefährdeten den platonischen Glauben an die harmonische Göttlichkeit des Universums, was den Philosophen auf eine Idee brachte. Er drehte den Spieß um und behauptete schlicht und einfach, dass sich die Planeten im offenen Widerspruch zum empirischen Augenschein tatsächlich in einheitlichen Kreisbahnen von perfekter Regelmäßigkeit bewegten, auch wenn er außer seinem Glauben an die Göttlichkeit der Himmelskörper keinen einzigen Hinweis auf diese spekulative Volte finden und anbieten konnte. Platon rief dafür seine Kollegen auf, mit ihren Überlegungen ihm recht zu geben und herauszufinden, »welche die einheitlichen und geordneten Bewegungen sind, durch deren Annahme die offenbaren Bewegungen der Planeten erklärt werden können«. Ein merkwürdiges Unterfangen, bei dem der Wunsch Vater des Gedankens war und das wenig mit wissenschaftlichem Vorgehen zu tun hat.
Die Namen der Planeten
Die Planeten spielen in der Geschichte des Wissens und der Wissenschaften eine besondere Rolle, beginnt doch die moderne Astrophysik damit, dass Johannes Kepler im 17. Jahrhundert drei Gesetze für die Bewegungen der Himmelswanderer aufzustellen in der Lage ist, wie an entsprechender Stelle noch erzählt wird. Deshalb lohnt der Hinweis, dass die Namen der Planeten eng mit Religion und Mythologie verbunden sind und einen Blick in den tiefen Brunnen der Vergangenheit erlauben, der Menschen seit jeher reizt. Planeten tragen heute Namen von Gottheiten, die als Erbe aus der Römerzeit stammen, in der die geläufigen Göttinnen und Götter der Antike umgetauft wurden. Aus Aphrodite wurde Venus, aus Zeus wurde Jupiter, und aus Hermes wurde Merkur, um nur drei Beispiele zu nennen. Während die Namen wechselten, blieben die Mythen gleich, und an sie kann man weiter denken, wenn von den Planeten gesprochen wird und ihre Namen genannt werden, auch wenn sie heute nach physikalischen Gesetzen umlaufen.
Es waren bereits die Babylonier, die die sieben den Griechen bekannten Planeten nach Wochentagen benannten – also die Sonne nach dem Sonntag, den Mond nach dem Montag, den Mars nach dem Dienstag (französisch Mardi) und so weiter, wobei es wohl kein Zufall ist, dass der sechste Tag, an dem Gott Mann und Frau mit ihrer Sexualität geschaffen hat, nach der Venus benannt, was im Französischen deutlicher wird, wo der Freitag als Vendredi bezeichnet wird, dem zuletzt der Samstag folgt, der im Englischen Saturday und im Französischen Samedi heißt, was eindeutig auf den Planeten Saturn verweist.
Übrigens: Natürlich rechnet die Neuzeit die Sonne und den Mond nicht mehr zu den Planeten, die als Himmelskörper definiert sind, die ein Zentralgestirn umrunden und nicht Satelliten eines anderen kosmischen Objektes sind. Und zudem kennt man heute mehr als die klassischen Sieben, aber erst seit dem 18. Jahrhundert, als die Instrumente der Himmelsbeobachtung immer weiter reichten. 1846 hat dabei der Planet Neptun seinen Namen bekommen. So hieß ursprünglich der römische Meeresgott, den die alten Griechen Poseidon nannten. Man kann es wenden, wie man will – aber der Blick an den Himmel zeigt sowohl eine Welt voller Planeten als auch eine Welt voller Götter. Da ist nicht nur ein »sky«. Da ist immer auch ein »heaven«, weil Menschen es so wollen und mögen.
Die Sophisten
In der Schule und anderen Bildungseinrichtungen kann man zwar sehr viel über die antiken Philosophen erfahren, und jede Pennälerin und jeder Pennäler wird von Aristoteles, Platon und Sokrates gehört haben. Es gab aber auch Männer – leider kaum Frauen –, die sich weniger mit spekulativen Konstruktionen abgaben und dafür mehr handfestes Wissen zu erwerben versuchten. Die Historiker sprechen in dem Fall von den Sophisten, und wenn es auch schwer ist und eigentlich unterlassen werden sollte, das gesamte Wirken dieser umfassenden Gruppe von Intellektuellen in wenigen Worten darzustellen, so kann man doch anmerken und für die hier verhandelten Zwecke feststellen, dass sie eindeutig Stellung gegen die Götter bezogen und sich mehr um die Natur kümmerten, die ihnen zugänglich war. So kann man etwa bei Protagoras lesen, was das menschliche Nichtwissen, das Sokrates so betont, konkret bedeutet, nämlich dies:
»Über die Götter allerdings habe ich keine Möglichkeit zu wissen, weder dass sie sind, noch dass sie nicht sind, noch wie sie etwa an Gestalt sind; denn vieles gibt es, was das Wissen hindert: die Nichtwahrnehmbarkeit und dass das Leben des Menschen kurz ist.«
Der Naturphilosoph Demokrit, dem die Nachwelt die wunderbare und mutige Aussage verdankt: »Nur scheinbar hat ein Ding eine Farbe, nur scheinbar ist es süß oder bitter, in Wirklichkeit gibt es nur Atome im leeren Raum«, vertrat die Ansicht, dass der Glaube der Menschen an Götter nichts weiter als den Versuch erkennen ließ, außergewöhnliche Ereignisse wie Unwetter oder Erdbeben durch übernatürliche Kräfte oder Einwirkungen höherer Mächte zu erklären, was ihm höchst unbefriedigend vorkam. Menschen – so meinten die Sophisten – verfügten überhaupt über ausreichend Verstand und Vernunft und Geistesgaben, um auf dem damit zugänglichen rationalen Weg zu entdecken, was in der Welt und ihrer Wirklichkeit vorhanden war.
Was natürlich ganz sicher vorhanden war, das waren die Menschen, die jetzt angefangen hatten, über ihren Ort im Kosmos und ihr Verhältnis zu höheren Wesen nachzusinnen. Dabei vertraten die Sophisten in der Person des Protagoras die berühmte und oft zitierte Position: »Der Mensch ist das Maß aller Dinge«, was Platon in dem entsprechenden Dialog ausdrücklich ablehnt und umkehrt.3 Für ihn ist nicht der Mensch, sondern der Gott das Maß aller Dinge, wobei man sich klarmachen muss, dass Platons Gott nichts mit dessen christlichem Nachfolger zu tun hat, weil er selbst zur Natur gehört und nicht im Himmel über ihr schwebt. Dieser platonische Gott taucht, übrigens, in der unentwegt zu kurz zitierten Inschrift am Apollotempel in Delphi auf, die beim Eintreten zu lesen ist und in der es zu Beginn heißt: »Erkenne dich selbst«, wie immer wieder zu lesen und zu hören ist. Nach dem dritten Wort der Aufforderung findet sich aber kein Punkt, sondern ein Komma, und die vollständige Anweisung der antiken Geisteswelt lautet: »Erkenne dich selbst, folge dem Gott.« Wer will, kann das etwas ausführlicher ausdrücken, indem er sagt, dass Menschen zuerst einsehen sollen, was für schwache und hinfällige Geschöpfe sie sind, um sich danach zu entschließen, ihrer irdischen Enge durch göttliche Gebote mehr Weite und Würde zu verschaffen. »Folge dem Gott« – hinter dieser Aufforderung lauert schon die Sorge, als Mensch nicht selbst entscheiden zu können, was das richtige Handeln im privaten und öffentlichen (staatlichen) Rahmen ist, und seit der Achsenzeit weiß man ja, dass überm Sternenzelt ein guter Vater wohnt, zu dem es bald möglich wird, engeren Kontakt aufzunehmen, weil er seinen Sohn auf die Erde schickt, damit er sich der Menschen und ihrer sündhaften Fehlbarkeit annehme und ihnen helfe.
Die Suche nach dem Anfang
Bei allen Bemühungen des erwachenden Denkens schwebte stets die hartnäckige Schwierigkeit im Hintergrund, den Anfang von allen Dingen, den Anfang von etwas und allem auf logische und systematische Weise zu erfassen, wobei man darauf verzichten wollte, ihn zu erfinden und als sagenhafte Erzählung zum Besten zu geben und somit zum Mythos werden zu lassen. Der christliche Glaube sollte später einen Gott einführen, der den unzugänglichen Anfang ausfüllte und übernahm. Er sprach zum Beispiel als Erstes in die Finsternis hinein: »Es werde Licht«, um anschließend in sieben Tagen die ganze Schöpfung zu bewerkstelligen. Aber bei den Griechen ging das weder so schnell noch so einfach, da sie ihre Gottheiten nicht außerhalb der Natur angesiedelt hatten, sondern sie als Teil davon betrachteten. Sie ließen dann eigens Titanen auftreten, um auf der kosmischen Heimstätte namens Erde die olympischen Götter zu erschaffen, die dann mit allen möglichen Mächten ausgestattet wurden, ohne aber über der Natur zu stehen. Nicht die Götter waren ewig, sondern die Ordnung der Natur, wie die vorchristlichen Zeiten meinten, und diese Ordnung galt es dann auch zu erkunden – und zwar mit dem Verstand. Selbst Zeus ist nicht von Anfang an der verlässliche Lenker der Welt. Er ist zunächst mit einigen Ehebrüchen beschäftigt und entwickelt sich erst im Laufe seiner Zeit zum Gott der Ordnung und Beschützer der Gerechtigkeit, wobei nicht zu übersehen ist, dass das griechische Denken eine Welt voller Kämpfe und Auseinandersetzungen vor Augen hatte: Der Kampf der Götter schafft die Welt, der Kampf zwischen den bei Homer auftretenden Göttern bestimmt die Geschichte, und der Kampf zwischen göttlichen Kräften wie Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit, Vernunft und Begierde schafft das philosophische Verständnis der Welt. Mit anderen Worten, der Kampf gegen die Götter steht am Anfang der menschlichen Kultur, die von nun an eine ungeheure Dynamik entfaltet.
Der unbewegte Beweger
Da gerade von Dynamik die Rede war, ist ein weiterer Blick auf Aristoteles erlaubt und möglich, der wahrscheinlich von allen berühmten griechischen Philosophen in dem Sinne am meisten gewusst hat, dass er nicht nur metaphysische Überlegungen angestellt und spekulative Ansichten »Über den Himmel« notiert hat, sondern der darüber hinaus das Leben und sein Werden fleißig beobachtet und im Detail zu verstehen versucht hat. Aristoteles hat unter anderem Flussfische studiert und bei der Art namens Wels bemerkt, dass sich die Weibchen nach dem Laichen auf und davon machen, während die Männchen die Stelle bewachen, an der sich viele Eier gesammelt haben. Sie wollen andere Fische daran hindern, die Keimlinge zu rauben, und sie halten ihre Stellung, bis die Jungen nach gut vierzig Tagen ausgewachsen sind und ihren Jägern entkommen können. Aus Anerkennung für derartige Beobachtungen hat die Zunft der Fischforscher im Jahre 1906 einer Welsart den Namen Parasilurus aristotelis gegeben, wobei hinzufügen ist, dass der griechische Philosoph das Konzept einer Art natürlich noch nicht kannte und also auch nicht nutzte. Er glaubte aber an eine Einheit der lebendigen Geschöpfe und sprach von einer »scala naturae«, durch die alles verbunden war, einer Stufenleiter des Lebens, die Aristoteles zufolge den Menschen eine ununterbrochene Aufeinanderfolge der Natur zeigte, die »von den unbelebten Objekten über die Pflanzen bis zu den Tieren reicht«, wie er in seinen biologischen Schriften mitgeteilt hat.
Was das Leben insgesamt angeht, so hat Aristoteles ihm eine Zweiteilung zugesprochen wie er es bei der Welt insgesamt unternommen hat, die bei ihm ja nicht als Uni-, sondern als Duoversum erscheint, wobei in der sublunaren Sphäre die irdischen Gesetze gelten, während jenseits des Mondes göttliche Einflüsse dafür sorgen, dass die Planeten auf Kreisbahnen unterwegs sind. Was die Zweiteilung des Lebens angeht, so unterschied Aristoteles das, was heute mit einer lateinischen Wurzel – materia – als Materie bekannt ist, von dem, was dem Stoff seine Gestalt gibt und wofür er das griechische Wort »eidos« verwendete. In der »materia« steckt natürlich das Wort für Mutter, was zwar beim ersten Hören erfreulich klingt, beim genauen Hinsehen aber die Frauen diskriminiert, sollte das schwache Geschlecht doch bei dem gemeinsam gezeugten Nachwuchs nur das niederwertige Material beisteuern, während das eigentliche Lebenselement mit seiner kreativen Kraft, das »eidos«, vom Mann gespendet oder geliefert wurde.
Wie dem auch sei – das »eidos« des Aristoteles soll die formgebende Dynamik erfassen, die Organismen zu eigen ist, wobei die Moderne an dieser Stelle kein allgemein akzeptiertes deutsches Wort – analog zur Materie – kennt, mit dem sie sich verständigen kann. Es ist im 20. Jahrhundert vorgeschlagen worden, »eidos« als »genetisches Programm« zu verstehen, aber mit der Maschinenmetapher muss man sich nicht anfreunden. Es könnte doch auch sein, dass die formbildende Fähigkeit des Lebens dessen besondere Kreativität erkennen lässt, was im Verlauf des Buches noch genauer angesprochen wird, wenn mehr über die Evolution der Organismen und ihre Gene bekannt ist.
Was seine Überlegungen zum Leben angeht, so faszinierte Aristoteles vor allem, dass sich im Prozess des Werdens etwas entfaltete, das zuvor nicht erkennbar war, wohl aber vorhanden sein musste. In und mit einer Eizelle musste die Form erst entstehen, die deshalb am Anfang der Entwicklung nicht als Wirklichkeit, sondern nur als Potenzial vorhanden war. Aristoteles sah im Werden eine eigenständige Realität, was sich verkürzt so ausdrücken lässt, dass das Sein des Lebens sich in seinem Werden zeigt und aus dieser Dynamik besteht. Damit konnte die traditionelle Zweiteilung aus Sein und Nichtsein durch ein Möglichsein ergänzt werden, was jeden Dialektiker erfreut, der wünscht, dass aus These und Antithese eine Synthese hervorgeht. Der wahrnehmbaren Wirklichkeit trat eine anfänglich verborgene, dann sich aber entfaltende Möglichkeit gegenüber, und Aristoteles stellte sich vor, dass es einer besonderen Qualität bedurfte, um das dynamisch konzipierte Mögliche wirklich in Erscheinung treten zu lassen. Diese Fähigkeit schrieb er einer eigenwilligen und besonderen Kraft zu, die er »energeia« nannte und womit der das Wort in die Welt setzte, aus der heute der Name für das Konzept der Energie geworden ist, von deren Verständnis und Umgang die Zukunft der Menschen in aller Welt abhängt.
Noch befindet sich dieser Text weit unten im Brunnen der tiefen Vergangenheit, und hier bemüht sich Aristoteles, das Werden der Welt zu verstehen, also ihre Bewegung. Wie erwähnt, findet sich auch hier das Problem des Anfangs, denn eine Bewegung, die einmal in Gang gekommen ist, kann das Geschehen zwar weiterführen und die Welt am Laufen halten. Aber wie ist alles losgegangen? Wie kommt nicht nur das Leben zu seiner Dynamik? Wie kommen die himmlischen Körper in der supralunaren Sphäre in ihren beständigen Umlauf? Was versetzt überhaupt die gesamte Fixsternansammlung in die Drehung, die sich am Nachthimmel mit eigenen Augen beobachten lässt (wobei der Philosoph wie alle seine Zeitgenossen und alle seine Mitmenschen bis in das 15. Jahrhundert hinein meinten, dass die Erde ruhe)?