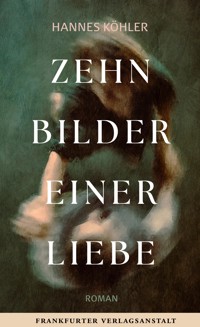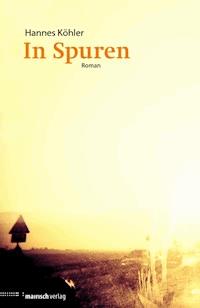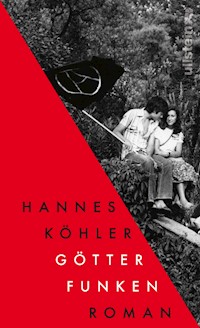
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein vielschichtiger Roman über politische Ideale und Freundschaft, Verrat und Treue – gegenüber anderen, aber auch gegenüber sich selbst. Sie nennen sich der Spanier, der Franzose und der Alemán. Toni, Germain und Jürgen treffen sich Mitte der 70er Jahre in Barcelona, entschlossen, Widerstand gegen das faschistische Franco-Regime zu leisten. Sie planen eine Aktion, der Anschlag gelingt. Doch jemand muss sie verraten haben. Germain kann fliehen, Toni wird festgenommen und verurteilt. Und Jürgen? Viele Jahre später meint Toni den Deutschen auf der Hochzeit seiner Tochter gesehen zu haben. Er will endlich wissen, was damals geschehen ist, und kontaktiert Germain. Der wiegelt ab, um den aufgebrachten Toni zu beruhigen. Doch dann steht Germain selbst eines Abends unvermittelt vor Jürgens Tür. Kunstvoll verwebt Hannes Köhler in Götterfunken die Biographien seiner Protagonisten zu einem europäischen Tableau des linken Widerstands in den 1970er Jahren und folgt ihnen bis in unsere Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Götterfunken
Der Autor
Hannes Köhler, geboren 1982 in Hamburg, lebt als Autor und Übersetzer in Berlin. Studium der Neueren deutschen Literatur und Neueren / Neuesten Geschichte in Toulouse und Berlin. 2011 erschien sein Debütroman In Spuren, 2018 der Roman Ein mögliches Leben.
Das Buch
Sie nennen sich der Spanier, der Franzose und der Alemán. Toni, Germain und Jürgen treffen sich in Barcelona, entschlossen, Widerstand gegen den Franquismus zu leisten. Gemeinsam mit Tonis Freundin Mireia planen sie einen Anschlag und schreiten zur Tat. Doch jemand muss sie verraten haben. Germain kann fliehen, Mireia taucht unter, Toni aber wird festgenommen und weggesperrt. Und Jürgen? Viele Jahre später meint Toni den Deutschen auf der Hochzeit seiner Tochter gesehen zu haben. Die Begegnung reißt alte Wunden auf und so entschließt sich Toni, das Geheimnis um Jürgens Verschwinden endlich ans Licht zu bringen.Götterfunken verwebt die Biographien seiner Protagonist*innen zu einem europäischen Tableau des linken Widerstands in den 1970er Jahren und folgt ihnen bis in unsere Gegenwart.
Hannes Köhler
Götterfunken
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2021 by Ullstein buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: Sabine Wimmer, BerlinUmschlagmotiv: akg-images / Pilar AymerichAutorenfoto: Israel FernándezE-Book-Konvertierung powered by PepyrusAlle Rechte vorbehalten.ISBN 978-3-8437-2346-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Franco ha muerto (I)
Kopfgeburt (I)
Ceux qui rêvent les yeux ouverts (I)
Franco ha muerto (II)
Kopfgeburt (II)
Ceux qui rêvent les yeux ouverts (II)
Franco ha muerto (III)
Kopfgeburt (III)
Ceux qui rêvent les yeux ouverts (III)
Franco ha muerto (IV)
Kopfgeburt (IV)
Ceux qui rêvent les yeux ouverts (IV)
Dos días del verano
Transiciones (I)
Chez ces gens-là (I)
Im Herzen (I)
El otro lado (II)
Chez ces gens-là (II)
Im Herzen (II)
Chez ces gens-là (III)
Im Herzen (III)
El otro lado (III)
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
A mi familia de Barcelona y siemprePaula
Prolog
Wir stehen am Meer, an einem der alten Orte. Auch wir sind alt, alle drei, die Gesichter faltig, die spärlichen Haare grau. Der Rompeolas aber, auf dem wir stehen, ist noch der große Wellenbrecher der Siebziger: eine breite Straße, darauf geparkte Autos und Mopeds, Spaziergänger auf dem Weg zum Essen im Porta Coeli. Von den schweren Steinbrocken aus strecken sich die weiß getünchten Holzplanken der Angler über die Brandung. Einen Augenblick später sitzt jeder von uns auf einer dieser Brücken, unter unseren Füßen die Gischt. Die Stadt ist alt, aber die Gedanken kommen aus dem Heute. Das Hotel fehlt, denken sie, wo ist das Hotel Vela, wo sind die Kreuzfahrtschiffe?
Ich habe Kohlestaub in der Nase, den Lärm alter Frachter im Rücken, die Füße über dem Wasser, sehe glitzernde, flitzende Fische. Ich bin Teil dieser drei und bin ihr Beobachter. Drei alte Männer auf ihren Anglerbrücken am Meer, Toni, der Spanier, Germain, der Franzose, und Jorge, der Alemán. Wir sind immer noch gefangen in dieser Zeit, sind nie davon losgekommen. Im Blinzeln der Augen sind wir wieder jung, für einen Moment nur, im Blinzeln der Augen ist da ein grelles Licht, im Blinzeln der Augen höre ich vertraute Stimmen, erfühle mit meinen eigenen Händen den gestärkten Stoff eines Bettlakens, das leicht über meinen Beinen und Armen liegt. Ich halte die Augen geschlossen, ich rieche den Diesel der Motoren, höre das Rauschen der Wellen. Und lasse mich ziehen. Ich bin fast wieder hier, fast im Jetzt. Aber am Ende, denke ich, will ich zurück, habe ich immer zurückgewollt.
Franco ha muerto (I)
[El Clot, Barcelona, Spanien, August 1974]
Es klopfte.
»Verschwinde!«
Einen kurzen Moment war es still, aber kurz darauf klopfte es erneut, diesmal öfter, dringlicher.
»Ich hab dir gesagt, dass du verschwinden sollst!«
Antonio hörte Diego im Flur atmen, sah seinen Schatten durch den Spalt zwischen Türkante und Schwelle. Er sprang aus dem Bett, griff sich die Stoffhose vom Boden und zog sie sich über. Er öffnete die Tür einen Spaltbreit, schob sich hinaus in den dunklen Flur, in dem sein Mitbewohner auf ihn wartete. Diegos Blick war auf seine Füße gerichtet, nur seine schwarzen, zerzausten Locken boten sich Antonio dar.
»Was ist los, joder?«
Für einen Augenblick nur hob Diego den Kopf. Seine Augen leuchteten weiß, Antonio hörte ihn ausatmen, hörte dieses leise, unterdrückte Schnaufen, das an manchen Tagen seine einzige Form der Kommunikation sein konnte. Der Bart überwucherte sein ganzes Gesicht, vom Kinn bis unter die Augen; in der Gruppe nannten sie ihn nur noch El Lobo, den Wolf. Er spürte Diegos warmen Atem auf der Brust, er roch das Haschisch und ärgerte sich, dass der Lobo die neue Lieferung bereits ohne ihn angebrochen hatte.
»Was ist los?«
Diego ließ ihn stehen, lief den Flur hinab Richtung Wohnzimmer und nur mit einer knappen Handbewegung auf Höhe der Hüfte forderte er Antonio auf, ihm zu folgen. Eines der Hosenbeine seiner karierten Stoffhose war zerrissen. Es machte den Eindruck, als humpele er. Antonio schaute zur geschlossenen Tür seines Zimmers, er legte eine Hand und die Stirn auf das Holz.
»Ich bin gleich wieder da«, sagte er. Drinnen blieb es still.
Als er das Wohnzimmer betrat, saß der Lobo im Schneidersitz auf dem Sofa, hatte sich bereits einen neuen Joint gedreht und hielt ihn gerade über eine der vielen Kerzen, die auf dem kleinen Tisch in der Mitte des Raumes brannten. Aus dem Kofferradio, das auf dem Boden neben dem Sofa stand, versicherte der Nachrichtensprecher dem spanischen Volk, dass sich ihr großer Führer Franco, der erhabene Caudillo, bei bester Gesundheit befände, alle anderslautenden Gerüchte seien Lügen kommunistischer Provokateure. Franco, so der Sprecher, habe die Zügel des Landes weiter fest in seinen Händen. Antonio lächelte. Wenn sie schon im Radio über seinen Gesundheitszustand sprachen, musste es übel um den alten Mistkerl stehen. Diego beugte sich vor, schaltete das Radio aus. Im Raum jetzt Stille. Die bunten Tücher, die sie vor die Fenster genagelt hatten, wehten leicht im Abendwind und ließen nur spärliches Licht einfallen; von draußen dröhnte und knatterte der Verkehr auf der sechsspurigen Avenida Meridiana, der ihn seit der ersten Nacht bis in seine Träume verfolgte. Schlangen aus Lastwagen und Motorrollern krochen durch seine Nächte, endlose Runden drehend, niemals still, niemals ruhend. Selbst im fünften Stock war die große Ausfallstraße eine Mitbewohnerin, die sich in jedem Zimmer breitmachte, die immer ihren Raum einforderte, der man zuhören musste. Er schob ein paar Teller mit dem Fuß zur Seite, hatte das Gefühl, auf Fleisch zu treten, vielleicht auf ein altes Stück Tortilla. Der Boden im Halbdunkel eine Ruinenlandschaft, Stoffberge, Kissen, Tassen, Teller, über denen der Staub tanzte. Er ließ sich gegenüber dem Sofa auf das Sitzkissen fallen. Seine langen Beine ragten wie die Extremitäten einer Spinne in den Raum, er suchte vergeblich nach einer angenehmen Sitzposition. Diego reichte ihm den Joint, er zog daran, gutes Haschisch, das musste man ihm lassen, direkt aus Marokko, von einem seiner Kontakte am Hafen. Der Lobo spielte mit dem Kreuz, das vor seiner haarigen Brust hing, er nahm es zwischen Daumen und Zeigefinger und drehte die Kette, bis sie sich nah um seinen Hals schloss.
»Du musst das mal einschmelzen«, sagte Antonio.
»Warum?« Diego fror in der Bewegung ein, hielt die gezwirbelte Kette vor sich wie eine zu kurz geratene Hundeleine.
»Das Kreuz, Jesus, Gottes Sohn, darum.«
Er deutete auf die Marienstatue in einer Nische des Wohnzimmers, die von ihren Vormietern zurückgelassen worden war und der sie am Abend ihres Einzugs den Kopf abgesägt und vor die Füße gelegt hatten. Auf ihrer Brust ein rotes A. Diego zuckte mit den Schultern und ließ die Kette los. Der kleine Heiland drehte sich ein paar Mal um die eigene Achse, bis er wieder im Brustpelz des Lobo lag. Die ganze politische Sache, glaubte Antonio, die Bewegung, auch das mit der Religionslosigkeit, all das war seinem Freund ziemlich egal. Während der Treffen mit der Gruppe in den letzten Wochen hatte er selten mehr als ein paar Worte gesagt und auch dann meist nur, wenn es um die Organisation von Feiern ging. Er reichte ihm den Joint zurück. Immerhin das Haschisch, das brachte er. Aber vielleicht war auch das nur ein persönlicher Nutzen, den er aus den Aktivitäten der Gruppe zog. Die Wohnung hatte er immerhin gefunden. Und das war wichtig genug. Er dachte an sein Zimmer, an sein Bett.
»Also, was willst du? Ich hab Besuch.«
»Mireia?«
Diego grinste. Frauen, das interessierte ihn doch.
»Geht dich nichts an.«
»Also Mireia«, sagte Diego.
»Willst du mir nur auf die Eier gehen, oder was wird das?«
Diego inhalierte, die glühende Asche hing wie eine dünne Zunge herab. Schatten unter seinen Augen, trockene Haut, Schlafmangel, er senkte den Blick, ließ den Rauch langsam durch die Nase ausströmen.
»Die Sache ist die«, sagte er. Und danach eine Weile nichts mehr; saß einfach still, den Joint im Mund, die Augen geschlossen, so als habe er seine eigenen Worte vergessen. Draußen fuhr ein Laster vorbei. Die Vibrationen waren durch den Fußboden bis in Antonios Rücken zu spüren.
»Ich kriege die Scheiße vom Fuchs nicht weg.«
»Die was?«
»Die Scheiße. Vom Fuchs«, wiederholte Diego. Antonio hob die Handflächen in Richtung Decke.
»Ernsthaft, Lobo? Warst du wieder im Wald?«
Immer wieder kam es vor, dass sein Freund in seinen ausgeblichenen gelben Citroën-H-Transporter stieg und für Tage verschwand. Wenn er zurückkam, sah er noch wüster aus als zuvor, er roch nach Erde, verbranntem Holz, nach altem Schweiß, und fast immer hatte er erlegte Kaninchen dabei, ab und an einen Fasan. Zu Beginn des Jahres, als sie noch in der Bruchbude am Berghang oberhalb der Stadt gewohnt hatten und Diego fast jedes Wochenende geflüchtet war, hatten sie oft zusammen Wildschwein gegessen. Seine Wilderei war vielleicht die klarste Form des Widerstandes, auf die der Lobo sich einließ.
»Mh-mh«, machte er und schüttelte den Kopf.
»Diego, por favor!«
Antonios Stimme mit dem verzweifelten Klang von Señor Sánchez, Diegos Vater, wenn er auf den Stufen vor seinem Krämerladen in der Calle Mayor ihres Dorfes stand, die Hosenträger über dem massiven Bauch gespannt, die kleinen Hände in die Hüften gestemmt. Und vor ihm Diego, die Hose zerrissen oder die Hände blutig, den Blick gesenkt wie auch jetzt wieder, diese Geste, die etwas Unterwürfiges und zugleich etwas Spöttisches hatte, die immer gerade so ehrlich wirkte, dass man sie akzeptieren musste. Und der Zorn des Vaters war stets in wenigen Augenblicken verpufft, hatte sich auf einige Floskeln von der Mutter beschränkt, die ihm schon einbläuen werde, was es für Mühen bedeutete, die Hose zu flicken oder die Hände zu verarzten. Und Antonio, in einigem Abstand, als kleiner Steppke oder später als schlaksiger Jugendlicher, hatte den Freund um diese Gabe beneidet, Menschen ihren Zorn abspenstig zu machen, auch um den Vater, den freundlichen, verständnisvollen, so weich wie die süßen chuches, die er in den kleinen Glaskästen in seinem Laden verkaufte.
»Diego, por favor!«
»Er hat sich losgerissen, hat das Leder durchgekaut, was weiß ich. Jedenfalls komm ich nicht ran. Ich schaffe das nicht allein.«
»Was schaffst du nicht?«
»Ihn wieder einzufangen. Er pisst alles voll. Scheißt auch. Wenn der Gestank zu groß wird, werden sie die Polizei rufen.«
Antonio schloss die Augen.
»Diego, wo ist der Fuchs?«
»Was?«
»Dieser Fuchs, wo ist er?«
»Auf dem Dachboden.«
Er hätte aufstehen und Dinge nach dem Lobo werfen, ihm eine verpassen können. Aber er würde dadurch vermutlich nicht viel ändern, sie würden nur Zeit verlieren. Oder es war das Haschisch, vielleicht war es das, vielleicht blieb er deshalb so ruhig. Das Sitzen, der Joint, clever eingefädelt. Vielleicht unterschätzten sie ihn alle. Toni dachte an sein Zimmer, an sein Bett.
»Wenn die Polizei kommt«, sagte Antonio leise, »sind wir beide so was von am Arsch. So oder so. Der Fuchs allein reicht vielleicht schon, bei unserer Vita. Und mit Marcos’ Paketen erst recht. Scheiße, Lobo, wirklich? Wir haben Marcos’ Pakete und du schleppst einen Fuchs an?«
»Ich weiß«, sagte Diego. Und nach einer Pause, in der er sich langsam, fast methodisch den Bart gekratzt hatte: »Aber wir haben den Fuchs schon länger als Marcos’ Pakete.«
Der Gestank war überwältigend. Es roch nach Kot, Urin, dazu ein intensiver, übersättigter Geruch nach Kreatur, süßer als menschlicher Schweiß und den dunklen, niedrigen Bereich unter den Dachbalken so vollständig ausfüllend, dass er glaubte, der Fuchs ströme ihm mit jedem Atemzug in die Lungen. Im Licht einer einzelnen, schwachen Glühbirne, die an einer Wand zu ihrer Rechten befestigt war, streckten sich ihnen die Schatten der Stützbalken wie Finger entgegen. Er schaute an sich herab, auf seine Schuhe und auf die dicke Lederschürze, die auf seinem nackten Körper lag. Diego hatte die beiden Schürzen aus seinem Zimmer geholt, hatte sie vor ihm auf den Boden geworfen.
»Ausziehen!«
Er hatte auf Antonios Hose gedeutet.
»Er kratzt, er pisst. Den Gestank wirst du nicht wieder los. Die Schürzen sind vom Matadero, da geht nichts durch.«
Antonios Resignation, seine Zustimmung, alles geschah langsam, bedächtig, ohne Widerworte, während der Ausblick auf die gemeinsame Fuchsjagd auf dem Dachboden den Lobo zu vitalisieren schien, er lief zwischen Zimmer und Salon hin und her, er redete viel, zumindest für seine Verhältnisse.
»Gummistiefel«, hatte er gesagt, »Gummistiefel wären perfekt gewesen, aber die Jungs beim Schlachter haben so schon schräg geschaut, haben gelacht. ›Lobo, was willst du schlachten?‹, haben sie gefragt.«
Und Antonio hatte im Wohnzimmer gestanden, nackt, nur mit einer Schürze bekleidet, sein Schwanz drückte unangenehm gegen den harten Stoff; je aktiver Diego wurde, desto weniger war er in der Lage, sich zu rühren.
»Komm schon, Toni, komm schon!«
Er hatte ihn vor sich hergeschoben. Ins Zimmer, dachte Antonio, er hätte ins Zimmer gemusst, er hätte es Mireia erklären sollen, es war völlig verantwortungslos, sie so zurückzulassen. Während er auf Zehenspitzen durch das Halbdunkel schlich, den haarigen Arsch seines besten Freundes vor sich, konnte er nur an Mireia denken, wie sie dort lag, in seinem Zimmer, auf seinem Bett. Wenn die Polizei kam, dachte er, waren sie alle erledigt, absolut, vollständig erledigt.
»Da ist er«, flüsterte Diego, schaute über die Schulter zu Antonio zurück und deutete in eine Ecke. Er trat neben ihn, seine Schuhe rutschten über etwas Weiches, Glitschiges. Er griff nach Diegos Schulter. Der Lobo hatte den hölzernen Stab, an dessen Spitze er eine Lederschlaufe befestigt hatte, neben sich abgesetzt, er war ein halb nackter, erbärmlicher Picador ohne Pferd, ohne leuchtende Montur. Sein Gegner war kein Stier, sondern ein stinkender, räudiger Fuchs. Ihm selbst fiel die Hauptrolle zu, die des Matadors. Und das, dachte er, waren im Zweifelsfall diejenigen, die auf die Hörner gingen.
»Es ist ganz einfach«, hatte Diego gesagt, als sie vor der hölzernen Tür zum obersten Stockwerk standen und er den Schlüssel in das Vorhängeschloss fingerte, »wir halten ihn gemeinsam in der Ecke, ich fange ihn mit dem Stab ein, dann legst du ihm die Kette um, drückst ihn zu Boden, bindest ihm den Maulkorb vor die Schnauze.«
Den weichen, warmen Maulkorb in einer Hand, die kalte Kette in der anderen, beobachtete Antonio das Tier. Das Fell, das er sich leuchtend rot vorgestellt hatte, war schmutzig, fast braun, die Spitze des langen, buschigen Schwanzes aber korrespondierte mit den weiß leuchtenden Augen. Der kleine Kopf zuckte bei jeder ihrer Bewegungen, das Tier machte langsame Schritte rückwärts, während sie sich aufteilten, Diego sich von links, er sich von rechts näherte. Der Fuchs fauchte, er zeigte seine Zähne, er begriff, dass sie es auf ihn abgesehen hatten, zwei sonderbare Gestalten, ein dünner Riese und ein Wolfsmensch.
Schritt für Schritt verringerten sie die Distanz, sie gingen auf Zehenspitzen, obwohl der Fuchs sie längst bemerkt hatte, sie tanzten, alle drei, einen alten, archaischen Tanz. Je näher sie kamen, desto intensiver wurde der Geruch des Tieres, desto mehr wurde er ein Teil von ihnen. Und zugleich war da ein Gefühl, als schwebe Toni, als liefe er auf Federn.
Diego sprang vor, er versuchte mit der Schlaufe den Kopf des Tieres zu fangen, aber der Fuchs wich aus, fauchte, biss nach dem Leder, erwischte es, Diego zog daran, er bewegte den Stab vor und zurück, versuchte das Tier mit dessen Spitze zu stoßen, aber der Fuchs war zu schnell, er sprang zur Seite, ohne seine Zähne von der Schlaufe zu lassen. Der Lobo versuchte den Stab gen Decke zu heben, er ächzte, die Vorderpfoten des Fuchses hoben sich, er hielt sich nur noch auf den Hinterläufen, wie zwei wilde Halbwesen standen sich die beiden für einen Augenblick gegenüber, bevor Diegos Kräfte schwanden und er den Stab wieder sinken ließ.
»Toni, Scheiße, ich krieg ihn nicht, Toni!«
Die Kette klirrte, als Antonio sie aus den Fingern gleiten ließ, nur noch das Ende um seine Hand gewickelt. Er riss seinen Arm nach vorne, die Kette folgte seiner Bewegung, sie schabte über den Boden, glitt vorwärts wie eine metallene Schlange. Noch ignorierte der Fuchs sie, also machte Antonio einen Schritt, noch einen und noch einen, er zog die Faust zurück, beschrieb einen Halbkreis, die Kette folgte seiner Bewegung, er ließ sie seitlich an sich vorbeischaben, dann riss er den Arm vor, so als boxe er die Schatten vor sich. Die Kette flog durch den Raum, donnernd schlug das Metall auf den Holzboden. Staub wirbelte auf. Der Fuchs ließ die Schlaufe los, er wandte sich Antonio zu, er fauchte, zeigte seine Zähne, er ging in die Hocke, als setze er zum Sprung an. Aber er verharrte so, die Augen aufgerissen und den Blick auf sein Gegenüber gerichtet. Speichel troff ihm aus dem Maul, ließ die Reihen der Zähne glänzen. Noch einmal zog Antonio die Faust zurück, noch einmal sauste die Kette. Der Fuchs biss danach, doch er war zu langsam, wurde von der Spitze am Kopf erwischt. Das Jaulen des Tieres ging Antonio in die Knochen. Er schloss die Augen.
»Ich hab ihn, ich hab ihn!«
Diego war vorgesprungen, hatte die Schlaufe über den Kopf gestülpt und zugezogen, mit der Spitze des Stabs drückte er den Kopf des Tieres zu Boden, der Picador hatte seine Arbeit getan.
»Nimm die Kette, pack die Beine, ich hab ihn! Wir haben ihn!«
Triumph in der Stimme des Lobo. Und Antonio ein trauriger Matador, als er auf das Tier zuschritt, das am Boden lag, hechelte und winselte. Als er die Hinterläufe packte und sie zusammenkettete, dann die Vorderläufe, leistete der Fuchs noch Widerstand. Aber seine Kräfte schienen zu schwinden. Als es daranging, ihm den Maulkorb überzuziehen, war das Tier gebrochen, es fletschte nicht einmal mehr die Zähne. Antonio sah, wie es nach Luft rang, er sah die Angst und Verzweiflung in seinen Augen, und als der Maulkorb festgezogen war, strich er dem Tier über das völlig verdreckte Fell, durch den verhärteten Kot, er ließ die flache Hand auf seiner Seite liegen, summte leise eine Melodie, er spürte das Heben und Senken der Rippen, spürte das schlagende Herz.
[Castell D’Empordà, Spanien, April 2017]
Sie streckte die Hand aus, legte sie ihm auf die Brust, hielt ihn auf Abstand. Er trat einen Schritt zurück, die Finger noch an der Gürtelschnalle, die zu öffnen er angesetzt hatte, das Hemd halb aufgeknöpft, das Sakko hinter sich auf dem Boden. Er sah sie an, sah, wie ihr Kopf sich langsam bewegte, wie sie ihn schüttelte, wie ihre wunderbaren schwarzgrauen Haare dabei wippten. Er wusste, dass der Moment vorbei war, er sah das Mitleid in ihren Augen, hasste diesen Ausdruck, verharrte trotzdem noch einen Moment regungslos, so als könne sie es sich anders überlegen.
»Toni, es tut mir leid«, sagte sie, »das war eine Schnapsidee, wirklich, du weißt, dass wir das nicht machen können.«
Sie saß auf der dunkel glänzenden Holzkommode, auf die er sie vor wenigen Augenblicken gehoben hatte, nachdem er ihr in ihr Zimmer gefolgt war, nachdem sie ihn geküsst und an den Arsch gefasst hatte, draußen im Flur. Er war aus dem Fahrstuhl und auf sie zugeeilt, nur diesen einen Satz im Kopf: Der Deutsche, der Deutsche ist hier, der Deutsche von damals. Er hatte sich durchgefragt nach ihr, ein Kellner hatte gesagt, dass die Brautmutter gerade nach oben gefahren sei, er war in den Fahrstuhl gestiegen und ihr gefolgt. Und anstatt ihn sprechen zu lassen, hatte Mireia ihn an sich gezogen und geküsst, einfach so, ohne Vorwarnung. Und jetzt saß sie auf diesem alten, vermutlich unbezahlbar teuren Möbelstück, das Kleid verrutscht, der Lippenstift verschmiert, und sah immer noch aus wie die junge Frau, die vor ein paar Jahrzehnten alles in seinem Leben auf den Kopf gestellt hatte. Sein Atem ging stoßweise, beruhigte sich nur langsam. Er ließ den Gürtel los, stand einen Augenblick lang völlig verloren und hilflos vor ihr, auch er wieder der junge, schlaksige Kerl von damals, bevor er sich besann und das Hemd zuknöpfte. Hinter ihm das Doppelbett, auf dem sie heute Nacht mit ihrem Begleiter schlafen würde, darauf die geöffneten Koffer der beiden, ihr Kulturbeutel und ihre Unterwäsche, die Socken und Hemden des anderen. Er lachte leise.
»Wenn alle Dinge so einfach mit dir wären wie das«, sagte Mireia, »wenn es nur um eine schnelle Nummer ginge, wenn ich allein hier wäre.« Sie stützte sich mit den Händen auf, hob leicht ihren Hintern, schob sich vorwärts und glitt von der Kommode, griff sich ihre Schuhe. Sie ging barfuß an Antonio vorbei, legte ihm erneut die Hand auf die Brust, setzte sich auf das Bett und schnallte die feinen Riemen der Sandalen wieder fest. Als sie den Kopf hob und ihn anschaute, war die Traurigkeit in ihrem Blick zu viel für ihn.
»Alles in Ordnung bei dir?«
Er zuckte die Schultern.
»Natürlich, natürlich.«
Der Deutsche, dachte er, der Deutsche ist hier.
»Sei mir nicht böse«, sagte sie. »Als du mir im Gang entgegenkamst, dieser Zufall, wir beide hier oben, auf der Flucht vor der Feier der eigenen Tochter. Ich weiß auch nicht.«
»Es ist in Ordnung, Mire, wirklich.«
»Und unsere Tochter? Machst du dir keine Sorgen?«
Er lachte.
»Wenn Montse eines ist, dann immerhin eine Tochter, um die man sich nicht sorgen muss. Manchmal frage ich mich, von wem sie das hat.«
Mireias kratziges, warmes Lachen.
»Von uns bestimmt nicht.«
Er setzte sich neben ihr auf das Bett. Dass er ihr vom Deutschen erzählen sollte, dachte er. Dass er ihn an einem Tisch in der Ecke des Saals gesehen hatte, dass er ein Freund der Familie des Bräutigams war.
»Erinnerst du dich an den Fuchs?«, fragte er stattdessen.
»An wen?«
»Den Fuchs, den Diego gefangen und oben unter dem Dach gehalten hatte?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Davon weiß ich nichts. Wann war das?«
»Ich dachte, ich hätte dir davon erzählt. In der Wohnung an der Avenida. Kurz bevor der Deutsche und der Franzose auftauchten. Ich glaube, du warst da, an dem Morgen, als er ausgebrochen war und wir ihn wieder einfangen mussten.«
Sie kniff ihre Augen zusammen und schaute ihn an. Die junge Frau aus der Avenida war verschwunden, die Frau auf der Hochzeit zurückgekehrt und mit ihr die Falten in ihrem Gesicht. Auch Antonio war wieder der kahlköpfige, von den Jahren krumm gebogene Kerl.
»An die Postsäcke mit den Peseten erinnerst du dich«, sagte er.
»Natürlich«, sagte sie und lachte.
»Ich glaube, an diesem Morgen war es«, sagte er. »Der Lobo und ich und ein Fuchs.«
»An die Peseten erinnere ich mich«, sagte sie, »aber an keinen Fuchs.«
»Sonderbar«, sagte er, »ich hätte schwören können, dass ich es dir erzählt hatte.«
»Was weiß denn ich, Antonio. Die ganze Zeit, die Tage und Wochen damals, das ist alles ein großer Klumpen Erinnerung in meinem Hirn. Keine Ahnung, wo Anfang und Ende ist. Keine Ahnung, ob da Füchse sind, Wölfe, Bären, was auch immer.«
Der Deutsche ist hier, wollte er sagen, er wollte sie in den Speisesaal führen und ihn ihr zeigen, fragen, erkennst du ihn nicht? Der verdammte Deutsche, nach all diesen Jahren, kannst du das glauben? Dass er sich hierherwagt? Dass er keine Angst hat? Aber vielleicht ist er schon öfter hier gewesen, vielleicht hat er sich nie genug darum gekümmert, was aus uns wurde, vielleicht hat er sich nie schlecht gefühlt, hat nie Angst gehabt, vielleicht dachte er, man hätte uns endgültig aus dem Weg geräumt.
»Wir sollten zurück auf die Feier«, sagte er.
Mireia erhob sich.
»Du hast recht«, sagte sie, »wir sollten unserer Tochter diese Peinlichkeit ersparen. Die Eltern beim Stelldichein im Hotelzimmer. Wer will so was schon hören, zumal auf der eigenen Hochzeit.«
Er nickte. Ging zur Tür. Sie fing ihn ab, nahm seine Hand, drückte ihm einen Kuss auf die Wange.
»Danke«, sagte sie, »dass du nicht böse bist.«
»Ich konnte dir nie wirklich böse sein«, sagte er.
»Konntest du nicht«, sagte sie, zog ihm das Hemd zurecht, lächelte, öffnete die Tür, spähte in den Gang, nickte. Er trat hinaus, machte ein paar geräuschlose Schritte auf dem schweren dunkelroten Teppich des Hotelflurs. Die Holztür des Zimmers fiel dumpf hinter ihm ins Schloss. An den Wänden Ölgemälde der Empordà, Jagdszenen, Fischerboote an der Costa Brava. All dieser Luxus. Wenn ihm jemand vor Jahren gesagt hätte, dass seine Tochter so heiraten würde. Er wäre ausgeflippt. Aber die Familie des Bräutigams hatte zu viel Kohle, die Tochter und die Exfrau verdienten gut, nur er, nun ja, er war eben er, er hatte seinen Laden, verkaufte Wein und Delikatessen, fast nur noch an Touristen, die mittlerweile in Massen bis hoch nach Gràcia strömten, was schlecht war für das Viertel, aber gut für das Geschäft, so ungern er das auch zugab. Und immerhin, dachte er, hatte er deshalb seinen Anteil bezahlen können, immerhin. Es hatte ihm wehgetan, aber es war ihm ums Prinzip gegangen, den reichen Deutschen, die sich ausgerechnet dieses Luxushotel ausgesucht hatten, nicht alles zu überlassen. Er gelangte zum Fahrstuhl. Die Türen schoben sich auf, er trat ein ins Licht, trat sich selbst im Spiegel gegenüber. Antonio, der Kapitalist. Die Krawatte saß, das Gesicht darüber ein wenig schief, vom Alkohol verrutscht. Er glaubte etwas von Mireias Lippenstift auf seiner Wange zu sehen, er steckte den Daumen in den Mund und wischte darüber, kontrollierte anschließend sein Hemd. Es würde gehen. Niemand würde ihn beachten, den Brautvater von der traurigen Gestalt, außer Montse und David vielleicht, in einer ihrer Tanzpausen, aber es war fast überstanden. Nach der Hochzeit, dachte er, da würde er fragen, ganz beiläufig, ganz unschuldig, nach der Liste der Gäste, er hätte sich da ganz vorzüglich mit jemandem unterhalten, aber leider die Visitenkarte verloren. Die Dinge, dachte er, all diese alten, verkrusteten Geschichten, würden wieder in Bewegung geraten. Der Fahrstuhl summte leise, er spürte das kurze Gefühl der Schwerelosigkeit in den Beinen, als er hinabglitt. Er schloss die Augen. Atmete ein, atmete aus. Die Tür öffnete sich. Der Franzose, dachte er, als ihm Licht und Lärm der Feier entgegenschlugen, er musste dem Franzosen Bescheid sagen, unverzüglich. Er trat hinaus, ließ sich verschlucken von Menschen und Musik, durchquerte die Masse der Feiernden, machte sich auf den Weg zum Parkplatz.
Das Freizeichen war zu hören, wieder und wieder, bis Germains Stimme erklang und erklärte, dass er leider gerade nicht erreichbar sei und darum bat, man möge eine Nachricht hinterlassen. Er werde zurückrufen, sobald es ihm möglich sei.
»Scheiß Franzose!«
Antonio legte auf, warf das Telefon auf den Beifahrersitz, drückte den Hinterkopf gegen den Sitz. Er schloss die Augen, presste die Luft aus, ließ sie langsam wieder einströmen, wiederholte den Vorgang einige Male, bevor er die Lider hob. In seinem Sichtfeld die gelb leuchtenden Äste eines Ginsterbusches, dahinter die Reihen geparkter Autos der Hochzeitsgesellschaft. Er schwitzte, wischte sich einige Tropfen mit seinem Stofftaschentuch von der Stirn, schaute auf das schwarze Display des Telefons. Rechts neben ihm die Tür eines schwarzen Ungetüms, vermutlich eines Porsche, darunter machten es die meisten hier nicht. Er fragte sich, warum er überhaupt auf den Gedanken gekommen war, Germain anzurufen, nach all diesen Jahren, warum er nicht einfach zum Deutschen gegangen, ihn am Kragen gepackt, gegen die Wand gedrückt und unter Androhung von Schlägen zum Reden gezwungen hatte. Aber war das die Option? Vielleicht irgendwann, dachte er, aber nicht auf der Hochzeit deiner Tochter. Immerhin hatte der Franzose noch seine alte Nummer. Er versuchte sich zu erinnern, wann sie das letzte Mal miteinander telefoniert hatten: vielleicht zu seinem Geburtstag vergangenes Jahr, vielleicht ein Jahr früher, oder in dem davor. Er legte die Hände auf das Lenkrad, spürte, wie rutschig sein Griff war.
Er sollte zurückkehren, trinken, sich nichts anmerken lassen. Aber wie sollte das gehen, wenn da nach all den Jahren plötzlich dieses vertraute Gesicht auftauchte, an einem Tisch auf der Hochzeit der eigenen Tochter, diese gealterten, aber doch vertrauten Züge, die hellen, leicht ergrauten Haare, die blauen Augen, die nichts von ihrer Kraft verloren hatten, ein Schnurrbart, der war neu, aber auch der Mund und das kantige Kinn darunter warfen ihn direkt in jene Tage und Wochen zurück, in denen er geglaubt hatte, Teil von etwas Großem zu sein und an deren Ende er für diesen Glauben ordentlich gefickt worden war. Und zwar genau von diesem Kerl, der jetzt dort saß und mit dem Vater des Bräutigams anstieß, der den Wein soff, den Antonio mitbezahlt hatte. Germain würde ausflippen, wenn er das hörte. Er versuchte es erneut, aber wieder verklangen die Freizeichen im Nichts, wieder erklang Germains weiche, freundliche Stimme und bat um eine Nachricht. Er legte auf.
»Kommst du noch zurück?«
Er hatte das Gefühl, sein Herz würde explodieren. Mireia stand neben der Fahrertür, die Stimme dumpf wie durch einen Schalldämpfer. Jetzt klopfte sie mit ihrem Ring gegen die Scheibe.
»Sie wollen den Kuchen anschneiden. Alle warten auf dich. Bist du okay?«
Er fuhr die Scheibe herunter, streckte den Kopf raus.
»Gib mir fünf Minuten!«
Sie schaute zu ihm herab.
»Du bist doch sauer.«
»Ist alles in Ordnung, Mire«, sagte er, und legte ihr die Hand auf den Unterarm.
»Lass uns die Hochzeit einfach heil hinter uns bringen«, sagte sie, »die restlichen Begrüßungen, Toasts, Torten, Reden. Apropos.«
Sie ging in die Knie und streckte den Kopf ins Auto. Sie hatte ihre Lippen dunkelrot nachgeschminkt, ihre Augen schwarz umrandet, alle Spuren ihrer vorherigen Begegnung gelöscht. Ihre Locken drückten gegen die Decke des Wagens.
»Himmel, Antonio«, sie fuhr ihm mit dem Daumen über die Stirn, steckte ihn sich danach in den Mund. »Du schwitzt wie ein Schwein.«
Er schaute in den Rückspiegel. Ein Glanz auf der hohen Stirn, selbst der graue, kurz geschorene Haarkranz schien zu schimmern; ein Heiligenschein aus Schweiß.
»Ich wollte fragen, ob zuerst du oder ich. Aber wirst du überhaupt etwas sagen können?«
»Was?« Er drehte den Kopf.
»Unsere Reden.« Sie machte ein Victoryzeichen. »Zwei Reden. Eine vom Papa, eine von der Mama. Hast du was vorbereitet?«
Er nickte. Sie strich ihm mit der Hand über die Wange.
»Ich hatte gehofft, du würdest mir den Vortritt lassen.«
»Was immer du willst«, sagte er. »Wie immer.«
Sie lachte.
»Wenn das so wäre«, sie zog den Kopf zurück, »dann wären wir heute noch zusammen hier. Und müssten vermutlich nur eine Rede halten.«
»Fünf Minuten«, sagte er.
Sie nickte, drehte sich um und ging. Er blinzelte, starrte auf ihre schwarzen Strümpfe, die unter dem einfachen weinroten Kleid zum Vorschein kamen. Vor einer Viertelstunde hatten seine Hände ihre Schenkel noch auseinandergeschoben, bereit, ihr Höschen herunterzureißen. Und jetzt ging sie, ging schon wieder. Ihr Geruch hing noch im Auto, und als er sah, wie sie mit ihren hochhackigen Schuhen auf dem Kies des Parkplatzes zu kämpfen hatte, schwappte eine Welle der Wärme über ihn hinweg. Er hätte es ihr sagen können, trotz Trennung und allem. Sie hätte es verstanden, als einzige Person auf dieser Hochzeit, sie hätte vielleicht sogar gewusst, was zu tun ist. Stattdessen erreichte sie die Treppe am Ende des Parkplatzes, stieg zwischen zwei Lavendelsträuchern zur Terrasse empor und verschwand aus seinem Blickfeld. Er blieb zurück mit dem stummen Telefon.
Erneut wählte er, erneut nur das unbeantwortete Tuten der Leitung, bis der Anrufbeantworter ansprang. Diesmal wartete er die Ansage ab.
»Hier ist Antonio«, sagte er. Und nach einem kurzen Zögern. »Ich hab den Deutschen gefunden. Er ist aufgetaucht, vielmehr. Hat zu mir gefunden, nach all den Jahren. Ich glaube nicht, dass er mich erkannt hat, aber ich bin sicher, dass es der Deutsche ist. Melde dich, wenn dir noch etwas an der Sache liegt!«
[El Clot, Barcelona, Spanien, August 1974]
Er klopfte vorsichtig. Im Zimmer blieb es still. Er öffnete die Tür einen Spaltbreit, spähte ins Halbdunkel. Das Tuch mit den bunten indischen Mustern, das sich vor dem Fenster spannte, schlug leichte Wellen im Wind, seine rote Farbe weichte die Konturen auf, den Schreibtisch, die auf dem Boden herumstehenden Bücher, das Bett. Er trat ans Fenster, hob das Tuch ein wenig. Draußen die Sommerhitze, unter ihm die dröhnende Ausfallstraße, aber über die Dächer des gegenüberliegenden Gebäudes hinweg, in der Ferne, hinter den Schloten von Poblenou und den grauen Türmen von La Mina, glänzte das Meer. Er ließ das Tuch zurückfallen, drehte sich um. Sie schlief. Er trat leise näher, wieder mit der dünnen Stoffhose bekleidet, in der er den Raum vor ein paar Stunden verlassen hatte. Die Haut seiner Oberarme und Brust rot von den Striemen der Bürste, mit der er sich den Fuchs vom Körper zu schrubben versucht hatte, über den Spülstein in der Küche gebeugt, das kalte Wasser aus der Leitung spritzend. Trotzdem roch er ihn noch, trotzdem war das Tier noch überall an ihm, er hatte zu viel davon eingeatmet, fühlte sich wie ein Zwitterwesen. Und hier lag sie, auf der schmalen Matratze, hatte die Beuge des Ellenbogens über die Augen gelegt. Er hörte ihren leisen, gleichmäßigen Atem. Einer der beiden Bettkästen war noch hervorgezogen, er sah den geöffneten Postsack. Einige der Scheine, die sie vorhin achtlos zurückgestopft hatten, lagen auf dem Boden; das zerknitterte Gesicht von San Isidoro schaute von einem Tausend-Peseten-Schein zu ihm empor. Er ging in die Knie, hob den Schein auf, strich ihn mit den Fingern glatt. Direkt neben ihm war ihr braun gebrannter Körper, der nur halb von einem Laken bedeckt war. San Isidoro senkte beschämt den Blick unter seiner Bischofsmitra, auch die Reyes Católicos, die Antonio kurz darauf vom Boden fischte, starrten grimmig zur Decke, empört darüber, dass der nackte Körper dieser schönen Frau nicht ausreichend bedeckt war im Beisein von Majestäten. Er berührte sie vorsichtig mit den Fingerspitzen an ihrem Knöchel. Sie bewegte sich ein wenig im Schlaf.
»Komm schon, Toni«, hatte sie am Morgen gesagt, ihr spitzes Kinn auf seine Brust gelegt, »zeig mir das Paket, zeig mir die Kohle!«
Und er hatte gelacht und den Kopf geschüttelt, unmöglich sei das, Marcos würde sie umbringen, aber sie hatte einfach das Laken von seinem Körper gezogen, hatte sich auf ihn gerollt, ihre hellen Brüste auf seiner Brust, ihr Gesicht ganz nah vor seinem, ihre Locken der schwarze Rahmen seines Blickfeldes.
»Komm schon, Toni! Nur ein kurzer Blick!«
Und sie hatte die Ellenbogen gehoben und auf seine Brust gedrückt, ihr ganzes Gewicht daraufgelegt und ihm den Atem genommen.
»Du weißt, dass ich stärker bin!«
Und er hatte gelacht, hatte sie von sich geschoben, war aufgestanden und hatte die Schublade des Bettkastens aufgezogen. Dieses Leuchten ihrer Augen, als sie begriff, dass sie all diese Tage direkt über dem Geld geschlafen hatte.
»Du hast sie nicht alle!«
»Was denn? Du wolltest die Pakete, da sind die Pakete!«
Drei mittelgroße Postsäcke, die Königskrone und das Horn darauf gedruckt, die Öffnung mit einfachen Lederbändern zugebunden. Und als er vor dem Bett kniete und sie ihn auffordernd anschaute, da hatte er die Schlaufe eines der Säcke geöffnet, hatte hineingegriffen mit beiden Händen, hatte Scheine genommen und sie ihr gereicht. Und sie griff zu, sie lachte, und auch er lachte, als sie die Arme hob und die Scheine über seinen Kopf rieseln ließ, er lachte aus vollem Hals, etwas packte ihn, eine Leichtigkeit, die ihm in den letzten Wochen verloren gegangen war. Er nahm mehr Peseten, packte mit beiden Händen zu, zerknitterte das Papier, roch daran, sprang auf und legte eine kurze Tanzeinlage hin. Das Geld roch nach altem Pergament, es roch nach Abenteuer, ein Teil der Verwegenheit der Bankräuber färbte auf sie ab.
»Zum Teufel mit den Banken!«, hatte er gerufen, den Kopf gedreht und sie angeschaut.
Und sie hatte seinen Blick erwidert, hatte sich einen Schein auf die Lippen gelegt und ihn durch das Papier hindurch geküsst. Und er hatte sich gewünscht, jener Rebell sein zu können, jene Fantasie des eigenen Ichs, dem sie eigentlich in diesem Moment den Kuss gab.
Jetzt war er zurück, Stunden später, erschlagen und erschöpft. Er schnaufte leise. Verdammter Fuchs, verdammter Lobo. Sie drehte sich zur Wand.
»Komm ins Bett«, murmelte sie.
Er hob das Laken, drückte sich an ihren Rücken und bedeckte ihre beiden Körper mit dem weißen Stoff. Morgen würde er darüber nachdenken, was Marcos ihm antäte, wenn er davon erfuhr: vom Fuchs, von Antonios Umgang mit dem Geld. Und von Mireia. Aber bis dahin würde er schlafen. Schlafen war alles, wozu er noch in der Lage war.
Kopfgeburt (I)
[Vesterbro, Kopenhagen, Dänemark, April 2017]
Auf dem kleinen Platz vor der Maria Kirke die Penner und Säufer, ihr Gelächter, Geschrei, splitterndes Glas, Scherben im Abendlicht. Jonas bremste sein Rad, lehnte einen Fuß auf den Kantstein, verharrte. Der rote Backstein leuchtend in der Abendsonne, durch das erhellte, kreisrunde Fenster in der Kirchenfront ist die Silhouette des Kreuzes zu sehen, aber niemand außer ihm hatte einen Blick dafür, niemand schaute hinauf, alle Augen auf den Boden, auf sich selbst gerichtet, auf die anderen, im Gewühl, Gekröse. Eine Mitarbeiterin der Caritas vor der Tür der Essensausgabe, sie hob die Hände, sie beschwichtigte, ihre kräftigen Arme in sanften Bewegungen, auf und ab, eine Dirigentin der verlorenen Seelen. Kurze graue Haare, ein rundes rötliches Gesicht. Blutdruck zu hoch, eigener Abusus womöglich, obwohl das sonderbar wäre, die feine Linie, wenn es denn, wenn überhaupt, wenn denn überhaupt noch Linien existierten, nirgendwo, dachte er, nirgendwo Grenzen mehr, aber trotzdem wäre es zu viel, wäre es eine ungewöhnliche Kombination. Wobei, was wusste er schon, er wusste nur, dass alles möglich war, nichts undenkbar. Das verschissene Belohnungszentrum, dachte er, die gottverdammten, nein, wichtig: zufallsverdammten, darwinverdammten Endorphine, danach die Gewöhnung, wenn nur die Gewöhnung nicht wäre, an Freude, an Belohnung, an alles, beinahe alles. Man konnte etwas machen, man konnte tricksen, ersetzen, er wusste das besser als die meisten. Aber es war nicht dasselbe, war es nicht, niemals. Und es kostete Geld, es kostete Anstrengung, es brauchte Willen. Er stieß sich ab, folgte dem Strom der Radfahrer auf der Istedgade, ließ das Orchester der Trinker zurück. Und überhaupt Willen, mit dem Willen war das so eine Sache. Jeden Tag vor ihm in der Röhre löste er sich auf, zersetzte sich auf dem Bildschirm, in den Strömungen der Neuronen, Farbfeldern, Reaktionen, die so steuerbar waren, so planbar. Aber woran stattdessen, woran lag es, wovon hing es ab? Genetik? Zufall? Wer trinkt, wer dabeibleibt, wer davonkommt. Für eine Weile davonkommt, bis das Unausweichliche geschieht. Er machte eine schnelle Bewegung, umkurvte einen alten Mann mit Gehstock, der ohne zu schauen auf den Fahrradweg getreten war. Zufall, dass ich es bin, Zufall, dass ich aufmerksam bin, reagieren kann, ansonsten: Zusammenstoß, Metall auf Greis, Oberschenkelhalsbruch, Minimum, das war es in diesem Alter, das Todesurteil. Ein paar Tage, Wochen vielleicht noch Intensiv, das Piepen, die Schläuche, die Ärzte: Wir würden sie bitten, darüber nachzudenken, die lebenserhaltenden … Schalter umlegen; und aus. Er rauschte weiter, beugte sich tief über den Lenker seines Rennrades, überholte andere Radfahrer, eine junge blonde Frau auf einem Hollandrand, er bog in die Oehlenschlægersgade ein, rollte aus, stieg vom Fahrrad. Vibration in der Brusttasche seiner Jacke.
»alles in ordnung bei dir? Wir denken an dich!«
Jürgen, der besorgte Papa. Eine zweite Nachricht, nachgeschoben.
»du kannst dich jederzeit melden, jederzeit vorbeikommen.«
Ach Jürgen, ach ja. Morgen würde vermutlich eine Nachricht von Charlotte folgen, vielleicht auch ein Anruf. Das alles war gut gemeint. Gut gemeint seit Monaten. Aber gut gemeint konnte ihm im Moment und vielleicht überhaupt für immer gestohlen bleiben. Und außerdem, wie stellte sein Vater sich das vor? Einfach ins Labor gehen, Farvel, meine Freunde, dem Professor sagen, dass er dann mal weg war, dass sie die nächste Reihe ohne ihn starten müssten. Ach Jürgen, ach Charlotte, wie rührend ihr seid. Aber wie stellt ihr euch das vor?
Vor dem Puff unten im Haus stand eine der Damen, sehr breit, sehr vollbusig, in einer engen Lederhose, darüber ein rot-schwarzes Korsett mit ausufernden Spitzenrändern am Dekolleté. Schwarze, glatte Haare, die ihr weit über die Schultern fielen. Sie sah asiatisch aus und hatte gleichzeitig etwas unglaublich Nordisches an sich, je nachdem, wie das Licht gerade fiel, schien sie ihr Aussehen wandeln zu können. Vielleicht war sie, je nach Lichteinfall, nicht ein und dieselbe Person, vielleicht hatte sie eine Doppelgängerin, eine Schwester, ein zweites Ich. Sie rauchte, hatte die Kippe im Mundwinkel und schaute die Straße hinunter, ihre großen, schwarz umrandeten Augen, die künstlichen Lider klimperten in Richtung der Lichter von Coffeeshops, von Burgerbuden und Kleiderläden, dorthin, wo der Kommerz wuchs und glänzte, der saubere, glatt polierte, die Renovierungen, die Ordnung, die sie bald aus dem Stadtteil drängen würde. Neben ihr die offene Metalltür, dahinter ein kleines Separee, ein Barhocker, ein zurückgebundener Vorhang und ein dunkler, niedriger Gang, der ins Innere des Bordells führte. Über ihr das Schild: »Kærlighed hus«. Haus der Liebe. Kündigen hatten sie wollen, ihr und ihren Kolleginnen, Doppelgängerinnen, die ganze Hausgemeinschaft war sich einig gewesen, raus mit dem Schmutz, raus mit dem Liebeshaus, den schmierigen, mittelalten Typen in Lederjacken und Trenchcoats, die abends in die Oehlenschlægersgade einbogen und den herzförmigen Klingelknopf neben der Metalltür drückten. Plastiktüten voller Sperma im Hausmüll. Nicht, dass man sie sah, aber man wusste es doch, man ahnte doch, man wollte ja niemanden verurteilen, so war man ja nicht, aber die Hausgemeinschaft hatte sich besprochen, hatte entscheiden wollen, doch dann kam alles zum Stillstand: seinetwegen. Man musste gemeinsam, einstimmig, so sah das die Satzung, und was wäre man ohne Satzung, und so hatte er Stopp gesagt, einfach so, weil er alles bremsen wollte, alles anhalten. Der Retter der Damen des Kærlighed Hus, Held der traurigen Freier, wobei auch hier, gerade hier, der Zufall sein Recht auf die Lorbeeren hätte einfordern können. Des einen Leid, des anderen. Er nickte der Frau zu, wünschte einen guten Abend, schloss die Tür des Gebäudes auf, die an der bunt besprayten Wand den Mund eines Characters bildete, und so schulterte er sein Rad und stieg der kantigen Figur mit Basecap und Mikrofon in der Hand in den Rachen, die steile Treppe in den ersten Stock hinauf. Er stellte das Rad im Flur ab, nahm sich ein Bier aus dem Kühlschrank, einen Teller mit Pasta vom Vortag, er lief ins Wohnzimmer, stieg über einige Paar Schuhe hinweg, über auf dem Boden liegende Zeitschriften, Fotos, er musste die Fotos wegräumen, ließ sich auf das Sofa fallen. Der Fernseher surrte leise, das Bild schwarz: Intet signal registreret. Er warf eine Webserie auf YouTube an, in der man Schauspielern Hunderte von Stunden lang dabei zuschauen konnte, wie sie Dungeons & Dragons spielten. Er starrte, lauschte auf die verzerrten Stimmen der Charaktere, die ihm seit Wochen näher waren als alles, was in seinem Leben eigentlich Realität war. Das Bild verschwamm. Er schloss die Augen, leerte das Bier, stand auf, um sich ein neues zu holen. In der Küche brummte der Kühlschrank, aus dem Wohnzimmer das undeutliche Brabbeln im Fernseher. Und irgendwo dazwischen: er selbst.
Ihr Kopf und ihre Schultern hatten aus der Menge geragt, die im Klang der Musik wogte. So hatte er sie gefunden. Sie hatte herausgeragt wie ein Eisberg, dachte er, wie ein tanzender Eisberg in der gleißenden Sommersonne Aragóns. Ihre Haare waren fast weiß, ihr Hemd darunter war, wie die Kleidung aller Tanzenden, vom dunklen Rot des Weins getränkt und eng am Körper anliegend. Spitze Schultern hatte er gesehen, er hätte gerne seine Hände nach ihr ausgestreckt, damals und heute, aber sie war zu weit entfernt, die Menge war zu dicht gewesen, damals. Der Reggaeton stampfte, ein Sänger sang davon, dass er mehr Benzin brauche, dass ihm das Benzin gefalle, dass man ihm mehr davon geben solle und die Menge riss die Arme empor. Weit über ihnen die Wäscheleinen zwischen den Hauswänden, die Blumentöpfe auf den Balkonen, die hölzernen Läden der verrammelten Türen und Fenster all jener Anwohner, die sich schützten gegen die Hitze und gegen den Lärm der feiernden Menge. Wer nicht selbst trank, war vermutlich längst aus Huesca geflohen. Der helle Sandstein war leuchtend und sauber, vermutlich per Sandstrahl gereinigt in den letzten Jahren. Über ihnen auch, unbemerkt von den meisten, an einer Hausecke: eine Heiligenfigur, ein kleiner Mann mit erhobener rechter Hand, das fein gearbeitete Werk eines alten Steinmetzmeisters, sonderbar fehl am Platze, zumindest an diesem Morgen. Unter dem Heiligen johlten Menschen mit Wasserpistolen in allen Farben und Formen, aus denen der Wein schoss, begleitet vom Kreischen der Opfer, der Freude über die Abkühlung, über was auch immer. Geöffnete Münder, geschlossene Augen, Küsse, Umarmungen, Gelächter, Geschrei, Gefummel. Und Jonas schob sich vorwärts, die Arme eng am Körper, das grüne Halstuch durchtränkt und verrutscht, seine Füße sappschten in seinen Schuhen, sie schwammen im Wein. Jemand leerte von der Seite einen Eimer Rotwein über ihnen aus, der Alkohol klebte, er leckte ihn sich von den Lippen, von den Wangen, es brannte in den Augen, jemand fasste ihm ins Gesicht, an den Hintern, tastete nach seinem Schritt. Er aber war auf der Suche nach dem Eisberg, nach der Abkühlung, an die er sich hatte halten wollen. Er hatte versucht sie nicht aus den Augen zu verlieren, er sah, wie sie die Arme in den Himmel reckte, als der DJ ins Mikrofon brüllte und ihnen allen einen glücklichen Día de San Lorenzo wünschte. Er kam näher, er schwamm sich heran. Sonderbar, dachte er, dass er sich ausgerechnet dort in Huesca, wo er abseits des Unilebens von Saragossa, tief im Hinterland, wirklich ins spanische Leben und Feiern einzutauchen gehofft hatte, dass er sich ausgerechnet dort von einer Frau hatte anziehen lassen, die ganz offensichtlich ebenso fremd gewesen war wie er selbst.
»Where are you from?«, hatte er gebrüllt, als ein Schub ihn plötzlich direkt vor sie spülte. Sie schaute zu ihm herab, sie musste über einen Meter achtzig groß sein, war außerordentlich schlank, fast mager, ein Eindruck, der durch die weingetränkte Kleidung an ihrem Körper noch verstärkt wurde.
»Denmark«, rief sie und lächelte. Er sah, dass ihr die Spitze eines Schneidezahns fehlte. Sie bemerkte seinen Blick: »Those Spanish parties get to you«, brüllte sie, oder etwas in der Art. Er lachte.
»What are you doing here?«, fragte er sie, indem er seinen Mund nah an ihr Ohr bewegte.
»What are you?«, entgegnete sie, »what the fuck are we all doing here?«
So hatte es angefangen.