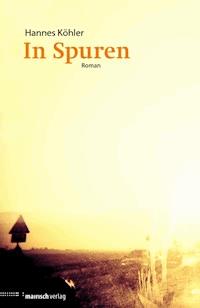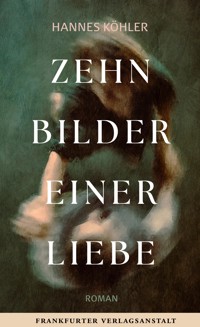
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Hannes Köhler ist mit seinem Roman eine der wohl schwierigsten Übungen gelungen: Von der Liebe erzählen, und zwar so, dass man es lesen möchte. Noch dazu wird auch das Thema der Elternschaft in gelungener Weise verhandelt. In der Beschreibung alltäglicher, aber doch prägender Momente des Lebens und der Liebe liegt die Stärke von Hannes Köhlers neuem Roman.« FAZ, Emilia Kröger Die große Liebe: Ist das ein Konzept, das überhaupt noch zeitgemäß ist? Und wenn ja, wie könnte eine große Liebe aussehen, die sich nicht von traditionellen Rollenbildern oder romantischen Idealen einengen lässt? David und Luisa begegnen sich zum ersten Mal auf Milos, nach einer gemeinsamen Nacht am Strand trennen sich ihre Wege. Jahre später treffen sie sich zufällig wieder, und diesmal bleiben sie zusammen. Mit Ronya, der Tochter der älteren Luisa, formen sie eine Patchwork-Familie. David wird immer vertrauter mit der Vaterrolle, wünscht sich schließlich ein eigenes Kind. Der Kinderwunsch wird zu einer von vielen Prüfungen, die das Paar bestehen muss. »Zehn Bilder einer Liebe« folgt einer Liebe in unserer Zeit; in stets doppelter Perspektive erzählt Hannes Köhler von den Gefahren, dem Werden und Wachsen einer Liebe, die sich immer neu finden und erfinden muss – und die genau darin ihre Schönheit entfaltet. Ein moderner Beziehungsroman, eine ungeschönte Bestandsaufnahme von Familie, ein schmerzlich-ehrliches und berührendes Paarporträt. »Hannes Köhler hat mit David und Luisa faszinierende Figuren erschaffen: komplex, widersprüchlich, klug. Mit jeder Seite habe ich mich mehr in die beiden – und ihre Liebe – verliebt. Ein großartiger Text!« Julia Wolf »Ein Liebesroman der Gegenwart, der nichts beschönigt und gerade deswegen so überzeugt. Mochte ich wirklich sehr!« Frank Menden, Buchhändler bei Stories! Die Buchhandlung und Blogger
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannes Köhler
Zehn Bilder einer Liebe
Roman
1. Auflage 2025
© Frankfurter Verlagsanstalt GmbH, Arndtstraße 11, 60325 Frankfurt am Main, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Der Verlag behält sich ebenfalls das Text- und Data-Mining nach § 44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlags untersagt ist.
Lektorat © Frankfurter Verlagsanstalt
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal unter Verwendung eines Motivs von © Natasza Fiedotjew/Trevillion Images
Herstellung: Laura J Gerlach
Satz: psb, Berlin
eBook: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main
eISBN 978-3-627-02336-2
Für Paula
Inhalt
Prolog
1 Der Fehlschlag April 2023
2 Der Morgen August 2012
3 Der Abschied Juni 2021
4 Angst Juni 2023
5 Das Neue April 2019
6 Der Alltag Juli 2023
7 Das Zusammen Juni 2020
8 Der Verlust August 2023
9 Das Gemisch September 2020
10 Das Weiter Oktober 2023
Prolog
Als er ins Schlafzimmer zurückkehrt, ist Luisa wach. Sie hebt das Laken an, er legt sich neben sie. Sie küsst ihn auf die Stirn.
»Ich hatte Angst«, sagt er.
»Jetzt?«
»Heute am Strand. Ich weiß nicht. Es fühlte sich an, als ob ihr verschwunden wärt. Einfach weg.«
»Wir sind hier«, sagt sie, legt ihre Hand auf seine Brust, »und wir gehen nicht weg.«
»Wir kriegen das hin, oder?«
Sie lacht leise.
»Was weiß denn ich, David. Ich bin wirklich keine Expertin für das Hinkriegen.«
»Ja«, sagt er, »das ist auch ein Scheißwort. Wie ein Regal zusammenbauen oder einen Test bestehen.«
»Aber so gerade eben«, sagt sie. »Was ich dir versprechen kann, ist, dass ich nicht bleiben werde, nur aus Bequemlichkeit. Wenn ich hier bin, dann, weil ich es will. Jeden Tag.«
1Der FehlschlagApril 2023
David
Als sich die Fahrstuhltür öffnete, wehte ihm Vivaldi entgegen. Er trat hinaus. Auf dem Flatscreen in der Ecke oberhalb der Rezeption schnellten Delfine aus einem satten blauen Meer empor und flogen durch sein Sichtfeld. Das Licht in der Praxis war angenehm gedämpft, hinter dem langen, L-förmigen Counter lächelten freundliche Gesichter. Er spürte, wie sich Wärme im Bereich seiner Leisten ausbreitete, tastete kurz danach, hielt den Kopf erhoben, drehte sich um und trat zurück an die Aufzugtür, die sich bereits geschlossen hatte. Er drückte den Knopf, um den Fahrstuhl erneut zu rufen. In der verspiegelten Tür vor sich konnte er den Fleck sehen, er spürte den Stoff seiner Jeans an seiner Haut kleben. Der Fleck war klein, aber er war sicher, dass die freundlichen Gesichter am Empfang ihn in Kürze entdecken würden.
Hektisch schob er seinen Pullover ein Stück nach oben, sah sofort, dass das Klebeband am Körper verrutscht war, der kleine Plastikbecher zur Seite gekippt. Der Deckel, ganz offensichtlich in der Nervosität nicht richtig festgeschraubt, war unter dem Druck zwischen Körper und Hose abgesprungen. Die Probe war verloren, der nächste Versuch gescheitert.
Die Tür des Fahrstuhls öffnete sich, und er trat ein, zog sich den Pullover über den Kopf und band ihn sich um die Hüften, um das Debakel zu verdecken. Als er gerade hoffte, die Tür würde sich lautlos und zügig schließen, näherte sich ihm ein Pärchen aus der Praxis. Er fror ein. Traute sich nicht, den Knopf zum Verschließen der Tür zu drücken. Die beiden Frauen traten zu ihm in den Fahrstuhl, lächelten ihn an, lächelten überhaupt pausenlos, hielten Händchen.
Das war der Gesichtsausdruck eines Paares, bei dem es geklappt hatte, das vielleicht gerade zum letzten Mal aus der Praxis gegangen war. Er starrte auf ihre Hinterköpfe, einen blonden, sehr langen Pferdeschwanz und einen dunklen Lockenkopf, und fragte sich, welche der beiden die Schwangere war. Es überraschte ihn, mit welcher Boshaftigkeit er die Schwangere dachte. Von den beiden hatte niemand einen Plastikbecher mit Sperma durch die Stadt tragen müssen. Das hatte ihr Spender für sie erledigt. Aber vermutlich war ein anonymer Spender auch jemand, der seine Probe nicht durch die Stadt tragen musste, sondern einfach freundlich lächelnd in die Praxis kam, seinen Namen nannte, einer Arzthelferin bis in den Raum mit dem Kunstledersessel, dem breiten Flatscreen, der Computermaus, den Pornoheften und den großen gerahmten Löwenfotografien folgte, um sich dort, ganz entspannt, einen runterzuholen.
Er fragte sich, ob es auch ihm möglich gewesen wäre in diesem hellen, sterilen Zimmer zu masturbieren, unter dem drohenden Blick des obersten Löwen, wenn es nicht um das eigene Kind ginge. Hätte ihn dieser Akt der Großzügigkeit in einen Zustand versetzt, in dem er nicht das Gefühl gehabt hätte, das majestätische Tier mit der wilden Mähne sei an diesem Ort völlig fehlplatziert?
Der Aufzug hatte das Erdgeschoss erreicht, die beiden Frauen verschwanden. Er wartete einen Augenblick, trat ebenfalls in das marmorne Vestibül. Vor ihm und vor der gläsernen Doppeltür des Bürogebäudes: der Strom der Passant*innen, Einkaufstaschen in den Händen, Telefone an den Ohren, die Blicke nach vorne gerichtet, konzentriert oder verloren in Gedanken. Niemand beachtete ihn. Er nahm das Plastikgefäß, schaute nach. Es war leer. Nicht einmal ein kleiner Rest war übrig, den er auf den Tresen hätte stellen können. Einfach seinen Teil der Abmachung erfüllen, wenn auch nur so gerade eben. Sein Part war der einfache. In einen Becher wichsen. Er musste sich nicht Hormone in den Körper spritzen, sich nicht von einer Ärztin auf bereitete Samen in die Gebärmutter setzen lassen. Nur seinen Schwanz in die Hand nehmen und machen, was er seit dem Beginn der Pubertät unzählige Male getan hatte.
»Willst du, dass ich mitgehe?«, hatte Luisa gefragt.
Und er hatte nicht einmal gewusst, wie sie das meinte. In die Praxis? Obwohl es danach Stunden dauern würde, bevor man seinen Samen für die Insemination aufbereitet hatte. In den Raum selbst? Wäre das überhaupt möglich gewesen?
Er öffnete die Tür und trat hinaus in den Lärm der Stadt. Er spürte die Vibration seines Telefons in der Hosentasche. Vermutlich Luisa, die ihn fragte, ob alles gut gelaufen sei. Genau wie beim ersten Versuch.
Dieses Mal war es Ungeschick gewesen. Und beim ersten Mal? Angst vielleicht. Er hatte sich immer wieder ermahnt, dass der Abbruch des Unterfangens peinlicher wäre als die Durchführung. Das Abgeben eines Bechers mit weißlicher Flüssigkeit an einer Labortür wäre nicht halb so unangenehm wie das Öffnen der Zimmertür, der Weg zurück zur Rezeption durch die gesamte Praxis, das Abstellen eines leeren Bechers und das Eingeständnis, dass er nicht dazu in der Lage gewesen war, in einen Becher zu kommen.
Er hatte die Tür hinter sich abgeschlossen, unsicher im Raum gestanden und auf den schwarzen Kunstledersessel gestarrt. Ob, wie und wer den Sessel nach jeder Nutzung saubermachte, war sein erster Gedanke gewesen. Da hatte er eigentlich schon verloren. Er hatte Papier von der neben einigen Pornoheften bereitgestellten Haushaltsrolle gezupft und auf die Sitzfläche des Sessels gelegt. Das Ergebnis hatte ausgesehen wie eine schlechte Kunstinstallation. Er hatte seine Hose ausgezogen, sie auf einen Haken neben der Tür gehängt und sich die Anleitung neben dem Waschbecken durchgelesen.
Händewaschen, Peniswaschen. Masturbieren. In dieser Reihenfolge. In den Becher kommen, nichts mit den Händen anfassen. Deckel drauf. Hände waschen, anziehen, Becher auf die Durchreiche der Labortür stellen. Das Ganze mit reichlich Ausrufezeichen versehen, so als traue das Praxisteam den Männern eine aufmerksame Lektüre nicht zu. Er stellte sich vor, wie Mitarbeiter*innen im Labor standen und darauf warteten, dass er fertig masturbiert hatte. Er setzte sich, bewegte die Maus, die auf der rechten Lehne des Stuhls platziert war, und öffnete einige Ordner auf dem ansonsten leeren Desktop. Es gab eine erstaunlich große Anzahl an Videos, die offenbar auf Premium-Pornoseiten gekauft worden waren. Es gab das volle Programm: lesbisch, Stiefmütter, Stiefschwestern, Dreier, auch queere Pornos. Sofort fragte er sich, ob es jemandem in der Praxis möglich war zu sehen, welches Video er anschaute. Er suchte einen Clip, der ihm möglichst gewöhnlich erschien: ein Paar, das miteinander Sex hatte. Er zog seine Unterhose ein Stück herunter und begann seinen Schwanz zu reiben. Als er kurz aufschaute, begegnete sein Blick jenem des Löwen. Sein Hintern schwitzte. Er spürte das Haushaltspapier an seinen Pobacken kleben. Auf der anderen Seite des Raums entdeckte er eine weitere Fotografie: Löwinnen im Schatten eines Baumes. Er musste lachen. Nachdem er einige Minuten lang vergeblich versucht hatte, sich in einen Zustand der Erregung zu zwingen, gab er auf.
Das Einzige, was half, als er einige Minuten später mit dem leeren Becher an die Rezeption trat, war die Reaktion der jungen Frau vor ihm. Sie nickte und sagte:
»Ja, das passiert. Wir geben Ihnen jetzt einen Termin, an dem Sie eine Probe von zu Hause mitbringen.«
Sie reichte ihm einen neuen Becher und dazu einen Zettel, lächelte und wünschte ihm einen schönen Tag. Noch im Aufzug hatte er die Anleitung gelesen, in der erklärt wurde, wie er sein Sperma am Tag der Abgabe morgens »gewinnen« und unmittelbar danach »möglichst mit Körperwärme« in die Praxis bringen konnte. Erleichtert hatte er Luisa angerufen, und zusammen hatten sie gelacht, auch später, als er neben ihr auf dem Sofa lag.
»Das nächste Mal helfe ich dir«, hatte sie gesagt, ihn geküsst, »aber dann legen wir auch Haushaltsrolle unter.«
Er stand hinter dem Bahnhof Friedrichstraße unterhalb der S-Bahn-Brücke über die Spree. Aus dem Bahnhof zog der Geruch nach altem Bratfett in seine Nase, unter ihm Dieselgestank.
»Ruf Luisa an«, sagte er seinem Telefon, und das Telefon tat wie befohlen, auch wenn er sich wünschte, es würde ihm den Gehorsam verweigern.
»Hey!«
Er konnte Straßenlärm im Hintergrund hören. Vermutlich hatte sie sich bereits auf den Weg gemacht.
»Hey«, antwortete er.
»Was ist passiert?«
»Der Becher hat nicht dichtgehalten.«
»Okay«, sagte sie, gefolgt von einem langen, tiefen Ausatmen, »dann machen wir nachher einen neuen Termin und besorgen einen besseren Becher.«
Und nach einer weiteren Pause:
»Kommst du nach Hause?«
Er bildete sich ein, dass sie sich ein »Nein« wünschte, wünschte, er würde abhauen, zumindest für einige Tage. So könnte sie darüber nachdenken, warum sie sich davon hatte überzeugen lassen, mit einem Typen ein Kind zu haben, der nicht einmal dazu in der Lage war, sein Sperma in einer Arztpraxis abzuliefern. Wie sollte so jemand sich um ein Baby kümmern, wie die Windeln wechseln, die schlaflosen Nächte durchstehen, wie die Müdigkeit am Tag, die Erschöpfung, den Ärger aushalten? Wie sollte so jemand Verantwortung tragen für die Erziehung eines Menschen, wie ihn schützen können und vor allem vorbereiten auf diesen Irrsinn, der ein kleines Geschöpf da draußen in der Welt erwartete?
»Ja«, sagte er. »Bin schon unterwegs.«
»Gut«, sagte sie.
»Vielleicht laufe ich«, schob er hinterher.
»Wie du magst. Dann bis später!«
Er steckte das Telefon in die Hosentasche, schloss die Augen und wünschte sich, dass sie ihn ausgelacht und verspottet hätte. Dann hätte er die Wut in seinem Bauch hinausschreien können, hätte ein Ventil gehabt. An ihrer schlecht verborgenen Enttäuschung konnte sein Zorn sich nicht festklammern, er rutschte ab, fiel zurück auf ihn selbst. Er wünschte sich, nie wieder in diese Praxis zurückkehren zu müssen, nie wieder mit Luisa über dieses Thema zu sprechen, nie wieder Versuche, ein Kind zu bekommen, nie wieder diese Enttäuschung, wenn die Regel kam oder schlimmer, wenn sie ausblieb und der eilig gekaufte Schwangerschaftstest negativ war. Obwohl sie die Unsichere, Zögerliche gewesen war, obwohl er sie hatte überzeugen müssen, es zu versuchen, mit ihm, mit einem Kind, standen die Erwartung und die Nervosität jetzt in ihrem Gesicht, bis ihr Ausdruck schlagartig wechselte, sie den Blick senkte. Stets gab es einen kurzen Moment, in dem er glaubte, sie würde weinen, aber sofort sammelte sie sich wieder, lächelte ihn an. »Das nächste Mal« war Luisas Formel geworden. Er hasste diesen Satz. Wenn es mit der Insemination nicht klappt, dachte er, würde es noch viel schlimmer werden. IVF, wochenlang Hormone für Luisa, Eizellenentnahme, Embryonenzucht, Einpflanzung. Das wollte er ihr ersparen. Ihnen beiden.
Er wandte sich in Richtung Bundestag und spazierte am Fluss entlang. Anzugträger*innen mit Aktentaschen eilten an ihm vorbei, Abgeordnete und Lobbyist*innen, stellte er sich vor, auf dem Weg, um wichtige Dinge zu erledigen. Und dazwischen er und sein Spermafleck.
Als Siebzehnjähriger hatte er sich, nachdem seine Eltern seine Marihuanavorräte entdeckt und die Toilette hinuntergespült hatten, einfach in den Bus zum Hauptbahnhof gesetzt, einen Rucksack mit achtlos hineingestopfter Kleidung über den Schultern. Im Gewühl auf den Gleisen hatte er sich für einen Regionalexpress in Richtung Bremen entschieden. In diesem sonderbaren Ausbruch hatte er sich selbst beobachtet, schon damals als eine dritte Person, die sich über die Schultern schaute, ein Begleiter der eigenen Handlungen. Er hatte Angst erwartet, Zögern. Aber nichts geschah. Als der Zug über die Elbbrücken fuhr, fühlte es sich an, als öffne sich ihm die Brust, als werfe er eine Last ab, von der er nicht gewusst hatte, dass sie ihm den Atem nahm. Und jetzt war diese Last wieder da. Damals war es die Schule gewesen, der vorgezeichnete Weg in ein Studium, von dem er wusste, dass er sich darin so fehl am Platze fühlen würde wie zwischen den gutsituierten Hockey- und Tenniskids seiner Schule. Was war es damals? Der Wunsch, seine Eltern zufrieden zu machen? Der Mangel an Alternativen oder vielmehr der Mangel an Wissen darum? Und auch heute war es wieder so, als hätte er sich mit der Entscheidung zu einem Kind, seinem Wunsch nach einem Kind, in eine Maschine begeben, aus der es kein Aussteigen mehr gab, eine komplizierte Apparatur aus Wünschen, Absprachen und Verpflichtungen, in der er gefangen war wie Charlie Chaplin in den Zahnrädern der Modern Times. Das Stoppen der Apparatur erschien ihm als ein solcher Kraftakt, dass es einfacher sein würde, sich durch die Bewegungen gleiten zu lassen oder aber, und dieser Wunsch wurde mit jeder neuen Monatsblutung, jeder neuen weiß bleibenden Fläche auf dem kleinen Plastikfenster eines Tests immer größer, oder aber einfach einen Ausweg zu suchen, einen Absprung, ein Loch im Boden, durch das er verschwinden konnte. Als er als Teenager in Bremen vor dem Hauptbahnhof gestanden und sich gefragt hatte, ob er dort übernachten oder sich einen weiteren Zug suchen sollte, war der Anruf seiner Mutter gekommen. Das Handy hatte in seiner Hand vibriert, er hatte es angestarrt und gewusst, dass er nicht die Kraft haben würde, sich zu widersetzen, wenn er abnahm. Und natürlich nahm er ab. Zwei Stunden später fuhr sein Vater mit dem Auto am Bahnhof vor. David stieg wortlos ein und fuhr zurück. Damals hatte er es nicht geschafft auszubrechen. Er würde es auch jetzt nicht schaffen. Weil er heute wie damals zwar dieses Gefühl spürte, aber nicht sicher war, ob er ihm wirklich trauen konnte.
Er spazierte in Richtung Pariser Platz und Brandenburger Tor. Das letzte Mal war er hier – nein, er wusste es nicht mehr. Vermutlich mit Besuch von außerhalb, vor ein paar Jahren. Wie immer sausten Radfahrer an überraschten Tourist*innen vorbei, die traumwandlerisch durch das Zentrum der Hauptstadt schlenderten. Er wünschte sich eine solche Selbstvergessenheit, einen Ort, durch den er laufen und an dem er einfach nur schauen und staunen konnte. Sie hatten verreisen wollen diesen Sommer. Weit weg, ans andere Ende der Welt, hatte er vorgeschlagen.
»Aber wenn es nichts wird mit den Inseminationen«, hatte Luisa gesagt, »werden wir das Geld brauchen.«
Künstliche Befruchtung, diese nächste logische Stufe in der Maschinerie des Kinderzeugens, von dessen animalischem Ursprungsakt sie sich mittlerweile so weit entfernt hatten, dass es David fast undenkbar erschien, dass Menschen einfach so miteinander schliefen und ein Kind zeugten. Natürlich taten auch sie das noch, miteinander schlafen, gelenkt von einem Kalender in einer App, die sie beide auf ihren Telefonen hatten. Aber wenn sie es taten, ging es nur noch um den erfolgreichen Erguss, ganz im Gegensatz zu all den Jahren vorher, in denen sie das Zusammensein genossen hatten, er sich vergessen konnte, wenn auch nur für wenige Momente. Jetzt ging es darum, dass er seine Spermien möglichst schnell in ihren Unterleib bekam. Er konnte Luisas Ungeduld spüren, wenn er länger brauchte. Er hatte eine Weile gehofft, dass der Weg in die Praxis sie entspannen würde, die Hilfe von außen ein Weg sein konnte, um den Druck zu reduzieren. Aber die Besuche bei der Ärztin waren nur eine weitere Quelle der Irritation geworden, ein Stressfaktor, der jetzt in diesem peinlichen Fehlschlag gemündet hatte.
In einer Viertelstunde würde er zu Hause sein, zwanzig Minuten, wenn er sich Zeit ließ. Luisa würde auf ihn warten. Sie würde darüber reden wollen. Er wollte nicht, würde es aber trotzdem tun, weil es leichter war, schneller vorbei sein würde als der Streit, den seine Weigerung ausgelöst hätte.
Sie macht das für dich. Sie muss das gar nicht machen. An der Kreuzung Anhalter Bahnhof Krankenwagen, Blaulicht, zwei Polizeiwagen. Eine Frau lehnte an der Motorhaube ihres Wagens und weinte. Ihr Gesicht war rot angelaufen, die Schminke in schwarzen Linien von ihren Augen geflossen, ihr ganzer Oberkörper schüttelte sich, sie schluchzte. Vor ihr stand eine Polizistin, offenbar unschlüssig, beide Hände an der Schutzweste, den Mund zu einer Art Lächeln verzogen. Als er den Unfall umlief, sah er das verbogene Fahrrad, das unter der Vorderseite des Wagens steckte, sah die Blutlache, eine große Blutlache. Im geöffneten Krankenwagen sah er die Sanitäter über einem Körper. Er wandte den Kopf, und sein Blick traf jenen der Autofahrerin. Darin: absolute Verzweiflung, Hunger nach einer Geste, einem Wort. Er schloss die Augen. Als er sich wieder traute zu schauen, hatte sie die Hände vor das Gesicht geschlagen, den Oberkörper noch weiter gekrümmt. Eine Ansammlung von Passant*innen bildete sich. Er eilte weiter, das Flackern der Blaulichter im Rücken.
An seine Eltern dachte er unwillkürlich, an Sonne und Meer und … eine Rückbank im Urlaub, eine Rückbank, von der aus er hinausschaute ins Blau, eine Rückbank, auf der er nicht mehr saß, nie wieder sitzen würde. Wie so oft, wenn er an sie dachte, an ihr Auto, die Sonne und das Meer, kroch der Druck seine Brust hinauf, legte sich ihm wie eine schwitzige Hand um die Kehle. Es konnte zu schnell vorbei sein, wusste er, er müsste wertschätzen, was er hatte, es beschützen, die Momente genießen, statt an dem zu leiden, was nicht da war, vielleicht nie kommen würde.
Wenn Ronya ihm gereicht hätte, dachte er. Was für ein hässliches Wort: gereicht. Wenn sie ihm jetzt reichen könnte, nachträglich, endlich. Aus der ursprünglichen Distanz und Skepsis, die gerne in offene Ablehnung umgeschlagen war, hatte sich etwas entwickelt, das er schwerlich benennen konnte. Das Wort Stiefvater mied er. Es klang nach Brüder Grimm, giftigen Äpfeln oder sonst was. Was fühlte er? Liebe. Sicher. Meistens. Liebe war ein unstetes Gefühl. Aber er konnte niemals, wirklich niemals diese Gewissheit ablegen, dass er austauschbar wäre für sie, wenn Luisa sich von ihm trennte. Kein Weinen in seinen Armen konnte das ändern, keine Stunden zu zweit auf dem Fußboden mit Lego oder vor der Konsole. Kein gemeinsamer Weg von ihren Karatestunden. Auch nicht Luisas Beschwörung, dass Ronya natürlich auch seine Tochter sei.
»Was denn sonst«, hatte sie gesagt.
Er wollte trotzdem ein gemeinsames Kind, ganz von Anfang, mit allem, was dazugehörte; eine Bande.
»Eine was?« Sie hatte die Augenbrauen gehoben. Und er hatte nicht recht gewusst, wie er das beschreiben sollte, diesen Wunsch, in einem Knäuel aufzugehen, in einem Chaos.
»Eine Bande, wie Räuberbande, eine Ronya haben wir ja schon.« Sie lachte, er griff ihre Hand. »Du bist nur mit Marta groß geworden, ich nur mit meinen Eltern. Ich habe immer gedacht, dass ich etwas anderes will, etwas mehr.«
»Dann hätten wir am besten gestern angefangen«, sagte sie. Versuchte ein Lächeln. »Lass mich darüber nachdenken, okay?«
Er hatte schon damals das Gefühl gehabt, es nicht vermitteln zu können, diesen Wunsch, diese vage Sehnsucht, die ihn stets begleitet hatte, wenn er Freunde oder Schulkamerad*innen mit ihren Geschwistern gesehen hatte. Jemanden, der immer da sein würde. Nähe, ohne Zwang, ohne althergebrachte Bilder davon, was eine Familie zu sein hatte. Aber eine Chance auf mehr als das, was er erlebt hatte. Er fragte sich, wie er von diesem Wunsch nach Glück an den Punkt gelangt war, an dem ihn der Kampf um ein weiteres Kind erstickte, ihn, Luisa und ihr Zusammensein.
Er überquerte den Kanal, fuhr ein kleines Stück durch den Gleisdreieckpark und stand kurz darauf vor der Tür ihres Gebäudes. Er kramte den Schlüssel aus der Hosentasche und hatte beim Weg hinauf unters Dach den Eindruck, dass die Luft mit jedem Schritt dünner wurde.
Luisa
Samthandschuhe. Sie stand vor der offenen Kiste mit der Winterkleidung und schüttelte den Kopf. Wie passend. Sie strich mit der Hand über den Stoff. Tatsächlich erstaunlich angenehm. Sie schob sie beiseite, grub beide Hände in die Berge aus Wolle, zog schließlich eine dunkelgrüne Strumpfhose hervor. Sie drehte sich um, hielt sie hoch.
»Die vielleicht?«
Ronya zuckte die Schultern.
»Wenn ich mich nicht totschwitze.«
»Robin Hood lebte in England, da regnet’s oft und ist kalt. Stell dir das einfach vor, wenn du sie anhast.«
Ronya zeigte ihr einen Vogel. Luisa warf die zusammengeknüllte Strumpfhose nach ihrer Tochter. Die fing den kleinen Stoffball und klemmte ihn sich unter den Arm.
»Was brauchst du noch?«
»Hut, Pfeil und Bogen, Gürtel und …«, sie dachte nach, »eine Truni…?«
»Eine Tunika«, sagte Luisa.
Ronya schnippte mit den Fingern.
»Sowas!«
Die Wohnungstür öffnete sich. David kam herein. Haltung wie einer der Geier aus dem alten Robin-Hood-Film von Disney, den sie am letzten Wochenende zusammen mit Ronya geschaut hatten. Sofort spürte sie den Ärger auf ihn, die Enttäuschung, aber sie zerdrückte diese Gefühle, wie man ein Papier zerknittert, presste sie in einen Hohlraum in ihrem Innern, der mit vielen solchen geknitterten Emotionen gefühlt war.
»Prinz John ist hier!«, rief sie laut, und Ronya stürmte mit wildem Geschrei in Richtung Wohnungstür und sprang David in die Arme.
»Gib mir dein Gold! Das bekommen die Armen!«
»Aber meine Steuern, meine lieblichen Steuern!«, rief David in einer Tonlage, die Luisa tatsächlich an Ustinov erinnerte.
»Eure Majestät«, sagte sie.
»Bruder Tuck«, sagte er und lächelte. Der Geiernacken reckte sich etwas. Er blieb kurz vor ihr stehen, gab ihr einen Kuss, vermied dabei aber längeren Augenkontakt. Dann trug er Ronya in ihr Zimmer.
»Und hier ist also die Höhle der Gesetzlosen«, hörte sie ihn sagen, dann wurde der Rest des Gespräches von der halb geschlossenen Tür des Kinderzimmers gedämpft. Luisa stand im Flur. Es rauschte in ihren Ohren, in den Leitungen der Nachbarn, oder die Luft rauschte, war aufgeladen. Alles war denkbar. Sie führte ihre Finger zusammen und erwartete beinahe, dass ihre Kuppen Funken schlugen.
Sie hatte sich gewünscht, dass Ronya sich nach dem frühen Schulschluss noch mit einer Freundin treffen könnte, draußen mit jemandem im Park zum Skaten, etwas, um das ihre Tochter an einem anderen Nachmittag gebettelt hätte. Heute nicht. Ronya war nach Hause gekommen und hatte David den perfekten Vorwand gegeben, um Luisa bis abends spät aus dem Weg zu gehen. Da hockte er jetzt also im Zimmer, als sei nichts passiert, und gab vor, sich für nichts mehr zu interessieren auf der Welt als für Robin von Locksley und seine Abenteuer. Ein gesetzloser Bandit, mit einer Geliebten, aber vermutlich ohne Kinder, oder wenn doch, dann solche, an deren Namen ihn Lady Marian vermutlich erinnern musste und denen er ab und an kurz den Kopf tätschelte, bevor er auf Abenteuer auszog. Und vielleicht, dachte sie, stimmte es sogar, vielleicht waren diese Minuten mit ihrer Tochter die wenigen Momente, die es ihm erlaubten, abzuschalten.
Sie ging ins Wohnzimmer, öffnete die Balkontür und trat hinaus, schaute in Richtung Park und lauschte auf das Lärmen vom Spielplatz. Ein leichter Wind ging, die Sonne senkte sich im Westen bereits langsam über das Grün des Gleisdreiecks, aber es war noch frühlingshaft warm. Sie setzte sich, nahm eine Zigarette aus der Schachtel, die sie hinter einem der Blumenkübel versteckte. Sie inhalierte, lehnte den Kopf zurück und legte die Beine auf das Balkongeländer. Schwanger würde sie in den nächsten Tagen nicht werden. Also warum nicht rauchen? Sie hätte sich dazu noch ein Bier aus dem Kühlschrank nehmen sollen, aber das Risiko, bei einer Rückkehr in die Wohnung David zu begegnen, war zu groß.
Sie schaute über die Dächer der Stadt. Sie schlich durch ihre eigene Wohnung wie ein eingesperrtes Raubtier. Wann hatte das angefangen? Anfangs, dachte sie, hatte es ein Zusammen gegeben. Als sich nach der Rückkehr aus Griechenland vor knapp zwei Jahren das erste Mal ihre Regel verspätet hatte, da hatten sie gemeinsam voller Vorfreude auf den Test gestarrt, und es hatte sie selbst überrascht, wie enttäuscht sie gewesen war über das Ausbleiben des zweiten Strichs. Sie hatten zusammengesessen, sich umarmt, sich aufgemuntert, beim nächsten Mal gesagt. Sie waren trotz der Traurigkeit, die ihnen seit Griechenland in den Knochen saß, voller Hoffnung gewesen. Aber die hatten sie verloren. Im Winter, als das zweite Mal die Regel ausblieb, diesmal sogar fast eine Woche lang, da weinte sie das erste Mal. Er hielt sie im Arm, aber sonderbar eckig und fest, starrte ins Leere. Dann hatten sie immer wieder Phasen, in denen sie glaubte, sie könnten es abschütteln. Ein Jahr nach dem ersten negativen Test waren ihre Zweifel immer stärker geworden, die Entscheidung, in die Kinderwunschklinik zu gehen, war ein Versuch gewesen, die Verkrampfung aufzubrechen, die sie beide umfasst hatte. Es war zu viel. Bis auf Ronya. Das war, was sie beide gerade gemein hatten: dass sie sich auf das vorhandene Kind stürzten und es mit Aufmerksamkeit überschütteten, weil die Stunden mit Ronya ihre Köpfe von all den Gedanken an das andere, das fehlende Kind befreiten. Sie warfen sich voller Hingabe in das Spielen, Basteln und Lernen mit Ronya, so als gäbe es nichts Wichtigeres in ihrem Leben.
David war es gewesen, der sich unbedingt ein zweites Kind gewünscht hatte: ein eigenes Kind, sein Kind. Fleisch und Blut. Das waren Wörter, die er nicht sagte, die aber im Raum standen zwischen ihnen. Er sprach vom Wunsch, mehr zu sein als nur diese Dreierkonstellation, in der sie beide groß geworden waren. Etwas anderes, Neues. Eine Bande. Sie hatte ihm nie gesagt, dass dieses Wort ihr Angst machte. Der Gedanke an Chaos. Ihm war nie aufgefallen, dass seine Annahme nicht stimmte. Vater-Mutter-Kind, das traf auf ihn zu, aber sie war in einer noch kleineren Einheit groß geworden. Sie und ihre Mutter. Bei aller Härte, die ihre Mutter an sich hatte, bei allen Kämpfen, die sie miteinander ausfochten, war dieses Gefühl eines Wir-zweigegen-die-Welt etwas, für das sie Marta bis heute dankbar war. Eine Front bilden, hatte ihre Mutter das genannt. Das hatte sich wichtig angefühlt, sie hatte sich wichtig gefühlt, hatte früh lernen müssen, für sich selbst zu sorgen, ohne jemals allein zu sein. Zwar hatte Marta ihre romantischen Beziehungen immer außerhalb dieses Mutter-Tochter-Kosmos gehalten, aber dafür waren da Freund*innen und Genossinnen und Genossen gewesen, die sich auch nach dem Mauerfall noch als solche bezeichneten. Gelächter und Stimmgewirr, ein Kommen und Gehen, Wochenenden in den Datschen dickbäuchiger Funktionäre, später, als die Funktionäre ihre Titel verloren hatten, auf FKK-Campingplätzen an der Ostsee. Sie hatte schon viel Bande gehabt, dachte sie, aber gleichzeitig immer die Möglichkeit, sich auf einen kleinen Kern zurückzuziehen. Ein eigenes Kind. David hätte nie gesagt, dass Ronya ihm nicht reichte, aber trotzdem. Sie konnte sich von diesem Gedanken nicht mehr befreien.
Sie warf eine Kippe vom Balkon, zündete sich direkt die nächste an. Wie naiv sie gewesen war zu denken, dass sie es einfach mal probieren konnten, das Kinderkriegen. Hatte mit Ronya ja auch geklappt, hatte sie gedacht. Und jetzt, nach knapp zwei Jahren ohne Erfolg, war ihr Sex zu verkrampften Befruchtungsversuchen verkümmert, und jede neue Monatsblutung ließ Davids Laune in den Keller stürzen. Sie hatte den Gang zur Ärztin vorgeschlagen, obwohl Freundinnen ihr davon abgeraten hatten. Aber sie war überzeugt gewesen, dass sich etwas ändern musste, weil sie sonst an der Situation zerbrechen würden. Und jetzt? War die Kinderwunschpraxis ein weiterer Teil der Erstarrung zwischen ihnen geworden, eine weitere Sache, die sich zwischen sie schob.
David war geschrumpft. Der selbstbewusste, gelassene Mann, in den sie sich vor Jahren verliebt hatte, jemand, der in der Werft und sich selbst angekommen zu sein schien, hatte sich von ihr zurückgezogen. Sein Körper war derselbe, aber wenn sie ihn anfasste, erreichte sie ihn nicht mehr, spürte nur die Haut und Haare einer anderen, hypernervösen Person, die neben ihr immer weniger Platz einnahm. Manchmal stellte sie sich vor, all die Gedanken, die er sich wegen des Kinderwunsches machte, all die Sorgen und Wünsche würden wie eine gigantische Blase über seinem Kopf aufquellen, aber nicht leicht und schwebend, sondern als ein täglich wachsendes Gewicht, das ihn von oben in Richtung Boden presste, ihn schrumpfen und verhärten ließ. Wieder und wieder hatte sie versucht, ihn zum Sprechen zu bringen, aber wenn er einmal sprach, dann waren da vor allem: Leerstellen. Einmal hatte sie das Wort Therapie in den Mund genommen, da war er so wütend geworden wie selten zuvor. Es hatte sie überrascht. Weil das nicht zu diesem Bild von ihm gepasst hatte. Vermutlich passte es nicht einmal zu dem Bild, das er von sich selbst hatte. Ein moderner, ein sensibler, ein einfühlsamer Mann. Aber das Scheitern an diesem simpelsten, archaischsten Akt schien einen anderen David hervorzuholen, einen, der ängstlich war, aber auch wütend. Sprachlos. Und heute hatte sie zum ersten Mal festgestellt, dass auch sie keine Lust mehr hatte zu sprechen. Sie wusste, dass das ein Alarmsignal war. Aber ihr fehlte die Kraft, gegen die eigene Empfindung anzukämpfen.