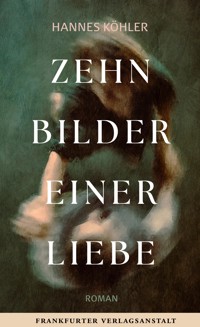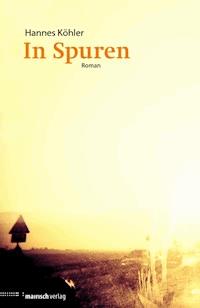
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mairisch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es beginnt mit einem Witz. Jakobs bester Freund Felix verlässt die fröhliche Runde, um Zigaretten holen zu gehen - und kommt nicht mehr zurück. Das Lachen vergeht, als Felix verschwunden bleibt. Jakob begibt sich auf Spurensuche. In Felix' Wohnung stößt er auf dessen Tagebuch, das eine seltsame und verstörende Wirkung auf ihn ausübt, denn es enthält nicht nur die Wahrheit über den Freund, sondern auch Variationen des eigenen Lebens. Wer war Felix in Wirklichkeit und wo ist er jetzt? Was passiert mit Jakob, der beim Lesen des Tagebuchs immer mehr auch an seiner Sicht auf die Dinge zweifelt? Kann vielleicht die Imitation eines fremden Lebens Zwischenräume öffnen und Antworten geben? Hannes Köhler stellt in seinem Debüt existenzielle Fragen nach Freundschaft, Liebe, Authentizität und Sinn - Fragen, die für jede Zeit neu gestellt werden müssen. Mit "In Spuren" gelingt ihm dies auf eindringliche Weise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
In Spuren - Teil 1
In Spuren - Teil 2
In Spuren - Teil 3
In Spuren - Teil 4
Hannes Köhler
Impressum
In Spuren - Teil 1
»Und andere nehmen sich einen Strick und hängen sich auf«, sagt Felix und hebt den linken Arm über den Kopf, die Faust um ein unsichtbares Seilende geschlossen. »Das muss man sich mal vorstellen.« Der Raum ist voller Rauch. »Der Nebel aus den Gläsern«, sagt Felix, der immer das Gespräch an sich ziehen muss, die Zigarette zwischen Mittel- und Ringfinger. Sein kratzendes Lachen.
»Nu mach mal langsam.«
Er steht auf, etwas unsicher auf den Beinen. Und lallt: »Kippen holen.«
Zehn Minuten. Zwanzig Minuten. Basti sagt: »Der is ins Klo gefallen.«
Wir lachen. Ich sage: »Ich geh mal gucken.«
In den Toiletten steht stechender Ammoniakgeruch. Aus dem Spiegel ist eine Ecke herausgebrochen, im Waschbecken ein langer Sprung, vom Abfluss bis zum Rand. Davor eine Pfütze, die sich in den Rillen der Fliesen ausbreitet. Edding und Aufkleber bedecken die Wände. Für immer und ewig: Eisern Union. Next Sunday: Soul Explosion. Im dunklen Holz der Kabinen klaffen Löcher, eingetreten oder geschlagen. Ich öffne die Türen, sehe gekritzelte Wortfetzen und Aufkleber, überall. Kein Felix ist zu finden, auch sonst niemand. Auf dem Rückweg stoße ich gegen den überquellenden Papierkorb. Ganz oben liegt sein T-Shirt. Grauer Stoff, darauf ein weißer Aufdruck: Elbkind. Zwei dunkle Schweißflecken unter den Ärmeln. Ich hebe es auf, halte es zwischen Daumen und Zeigefingern an den Schultern, spüre die Feuchtigkeit in den Fasern.
Ich stelle mir vor, wie er mit freiem Oberkörper die Kneipe verlässt, auf die Straße torkelt, seine haarige Brust, der weiße Bauch ein wenig vorstehend. Ich schüttle den Kopf. Unmöglich, selbst für Felix. Er muss ein Ersatzhemd gehabt haben, vielleicht eine Tasche, die ich übersehen habe. Der Wirt hat nichts bemerkt. Einer der Stammgäste an der Theke sagt: »Jo, der is raus.«
Als ich frage, ob mit freiem Oberkörper, schüttelt er den Kopf und starrt auf sein Bier.
Die anderen warten am Tisch, bilden eine Schweigewolke unter der Lampe.
»Und?«
Basti trommelt mit den Fingern.
»Weg«, sage ich und werfe das T-Shirt auf den Tisch.
»Wieso weg?«
»Verschwunden.«
»Und jetzt?«
»Abwarten, der kommt wieder.«
»Ruf ihn an!«
Ich wähle seine Nummer. Eine elektronische Stimme antwortet. Not available at present.
»Der rastet aus«, sagt Manja. »Du weißt nicht, wie der tickt, wenn der ausrastet.«
Sie tastet nach dem Lichtschalter. Ein kurzes Klicken. Licht flutet den Hausflur, erhellt gelbe Wände, die nachgedunkelt sind, wie mit Asche überzogen. Rechts ein schwarzes Graffiti: Widerstand. Der Boden auf dem Weg zur Treppe, ein Schachbrett, ist zur Mitte hin abgesackt: Morsche Kellerbalken, das weiß ich von Felix. Reparaturen sind geplant, seit Monaten schon. Die neue Waschmaschine eines Nachbarn hatte ausgereicht.
Felix erzählte, dass er auf der Treppe stand, als die Sackkarre mit der Maschine in den Flur gerollt kam. Als die Männer die Mitte des Flurs erreicht hatten, knirschte es laut, wie das Reiben gigantischer Zähne. Der Boden senkte sich in Zeitlupe.
Felix erzählte von ihren erschrockenen Rufen und dem lauten Donnern, als sie die Maschine losließen und diese nach hinten kippte. Noch hält der Boden, hatte Felix gesagt, die Frage war nur, wie lange noch. Es ist ein seltsames Gefühl, die eigenen Füße jetzt auf diese Fliesen zu setzen.
Manja geht vor, ohne den Boden zu beachten. Ihr breiter Hintern spannt die enge Jeans. Mein Ruhekissen, hatte Felix gesagt. Vor der Wohnungstür bleibt sie stehen, kramt den Schlüssel hervor.
»Den wollte er längst wiederhaben«, sagt sie. »Du kommst hier nicht mehr rein.«
Sie starrt ins Leere. Seine Worte aus ihrem Mund werfen die Frage auf, seit wann er solche Sätze sagt. Wir klingeln. Keine Reaktion.
»Na los.«
Sie schaut mich an.
»Meine Verantwortung«, sage ich.
Sie holt Luft.
In seiner Wohnung ist es still. Blasses Licht strömt aus einer nackten Birne. Manja tritt in den Flur, zögert. Der Boden knackt bei jedem ihrer Schritte. Ihr Blick geht zur Garderobe an der linken Wand. Leere Haken, zum Fischen von Jacken in die Luft gereckt, darunter ein Berg aus alten Schuhen. Stofffransen, gerissene Schnürsenkel. Neben ihr die Tür des Badezimmers. Sie dreht sich, drückt die Klinke und schaut ins Dunkel.
Mein eigener Körper erstarrt an der Schwelle. Erst als Manja mir winkt, gehorchen meine Beine. Ich bin ein Einbrecher, ich taste mich vor. Manja flüstert.
»Felix?«
Ich warte und stelle mir vor, seine Stimme zu hören, ihn aus der Tür am Ende des Flurs treten zu sehen, seine Überraschung, vielleicht Wut. Ich lausche. Alles bleibt still. Ich drücke meinen Rücken gegen die Wohnungstür und erschrecke über den dumpfen Knall, als sie hinter mir ins Schloss fällt.
Von den hohen Wänden im Wohnzimmer löst sich an einigen Stellen die Tapete. Reste von Stuck verstecken sich in den Ecken. Der Boden besteht aus breiten Dielen in dunklem Rot, mit einem Stich ins Braune.
»Synthetisches Ochsenblut, wie nach einem Schlachtfest kleben geblieben«, sagte er. »Warum haben die das damals bloß gemacht?«
Er schüttelte den Kopf, wollte die Farbe aber nicht abschleifen.
»Ach komm! Wie lang bleib ich denn schon hier.«
Drei Finger dabei an die Schläfe gelegt, als bereite ihm der Gedanke Kopfschmerzen. Vier Jahre hat er es ausgehalten. Die Dielen sind unverändert. Vier Jahre, in denen ich zweimal umgezogen bin. Felix blieb.
Manja und ich betreten den Raum, seine Wohnhöhle im Wrangelkiez. Das schwere Schlafsofa beherrscht die Mitte des Zimmers. Davor, an der Wand zu unserer Linken, steht ein Tisch mit einigen Pflanzen und einem kleinen Fernseher, daneben ein Plattenspieler samt Verstärker. Rechts steht sein Schreibtisch vor dem Fenster zum Hof. An der Rückwand ein Kleiderschrank, daneben die Öffnung zur Küche. Uns gegenüber reihen sich Buchrücken. Die lange Wand ist ein einziges Regal aus langen Brettern, selbst gezimmert, auf denen die Bücher nach Farbe und Form sortiert sind. Unten, über dem Boden, verläuft eine Reihe quadratischer Fächer. Darin stecken Schallplatten, die er wahllos und in großen Mengen gekauft hat. Kinderhörspiele: Hui Buh, das Schlossgespenst, Asterix bei den Briten.
»Ick hätte gern nock ein Tropfen Milck in mein heiß Wasser.«
Er imitierte den Akzent, konnte darüber lachen, immer wieder. Dazu hat er alle Stile gemischt, Platten mit klassischen Konzerten neben Rock gestellt, elektronische Musik neben Hip-Hop. Dazwischen finden sich auf einmal Peter Alexander und Hannes Wader.
»Elternschädigung«, hat er einmal gesagt. »Kommt man nicht von weg.«
Musikchaos. Sein Lesen dagegen ist durchstrukturiert. Ich entdecke Thomas Mann, das Gesamtwerk. In seinem Regal reihen sich die grauen Rücken der Taschenbücher. Er las chronologisch, recherchierte sämtliche Jahreszahlen der Veröffentlichungen. Jeden Tag eine Stunde oder mehr. Ich habe ihn in den letzten Jahren öfter lesend in der U-Bahn angetroffen. Er schien versunken, das Buch auf dem Schoß, den Kopf abgeknickt. Seine Bücher blieben fremd, blieben lange Wortschlangen, wie seine Sätze. Wenn er von ihnen erzählte, hatte ich ein Gefühl, als ob mein Körper sich wehrte, jeden Buchstaben abstoßen wollte.
Auf einem kleinen Tisch neben dem Sofa finde ich Krieg und Frieden, eine alte Ausgabe in grauem Einband. Auf dem Buchdeckel sind zwei geschwungene Buchstaben in goldener Schrift gedruckt: LT. Die Seiten sind gespickt mit Klebezetteln, und auf die Seitenränder sind kurze Stichworte gekritzelt, oft mit Ausrufezeichen.
Ja! Nachschlagen! Schrecklich!
Ich blättere, finde einen Satz, den er eingekreist hat, ohne dass ich erkennen kann warum.
Eine Lokomotive fährt dahin. Es fragt sich nun, wie kommt es, daß sie sich bewegt? Der Bauer sagt, der Teufel treibe sie. Ein anderer sagt, die Lokomotive fahre, weil sich die Räder drehen. Der dritte versichert, die Ursache der Bewegung sei der Rauch, den der Wind davonträgt.
Manja lehnt an seinem Schreibtisch, stützt sich mit den Händen auf die Arbeitsplatte. Die Muskeln ihrer Arme spannen sich. Ihr Blick gleitet über Sofa, Schrank und Bücherrücken. Sie prüft und vergleicht, sucht nach Änderungen, nach Dingen, die nicht an ihrem Platz sind.
Auf mich wirkt der Raum leblos. Oder verlassen. Die Blätter einiger Pflanzen auf dem Fensterbrett färben sich bereits bräunlich. Keinerlei Spuren von Kleidung. Manja stößt sich ab und geht in die Küche. Ich höre Schranktüren quietschen, Wasser, das aus der Leitung fließt. Ein lautes Klack, als sie den Schalter des Wasserkochers umlegt.
In seinem Schrank hängen Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Anzüge, Hemden, Sakkos. Ich kenne Felix in alten Turnschuhen und Jeans, die so weit waren, dass sie manchmal unter seinem Hintern hingen, dazu seine Neigung zu T-Shirts mit seltsamen Aufdrucken.
Ich schiebe die Bügel im Schrank von links nach rechts. Einige der Sachen sind noch in die Folie der Reinigung gepackt und knistern, als ich sie berühre. In meinem Rücken klappert Porzellan. Manja tritt neben mich, eine dampfende Tasse in den Händen. Ich starre in den Schrank.
»Wusstest du … all die Sachen?«
Sie lehnt sich in den Türrahmen, nickt langsam, als müsse sie die Dinge in seiner Wohnung erst mühsam aus ihrer Erinnerung holen.
»Schon seit ein paar Wochen. Was suchst du eigentlich?«
Ich zucke die Schultern.
»Einen Hinweis.«
»Warum sollte er abgehauen sein? Er ist doch nur aus dieser Kneipe weg.«
Ich drehe mich. Die Wohnung ist auf den ersten Blick frei von Spuren, auch die Arbeitsfläche des Schreibtischs ist leer. Ich erinnere mich an ein Zettelchaos, Stifte, Teekannen und Bücher. Am Ende kann ich nur mit den Schultern zucken.
»Hier ist er seitdem nicht gewesen. Hier ist …« Ich stocke. »Hier ist niemand gewesen.«
Sie zieht Luft ein, ihre großen Nasenflügel heben und senken sich. Mein erster Gedanke ist, dass sie zu lachen beginnen wird. Aber dann nickt sie und legt die Stirn in Falten.
»Wann ist er verschwunden?«
»Vor fünf Tagen.«
»Vielleicht steht was in seinen Mails?«
Die nächste Überraschung: ein schwarzer, neuer Laptop, den sie aus der Schublade unter seinem Schreibtisch zieht. Sie schaltet ihn ein. Das Rauschen der Lüftung ist nach dem Sprudeln des Kochers das zweite Lebenszeichen in seiner Wohnung. Manja tippt sein Passwort ein.
Ich habe den Anschluss verloren, die Verbindung. Ich denke an das Foto, das ich bei meinem letzten Besuch in Hamburg am Küchenschrank seiner Mutter gesehen habe. Zwei Blondschöpfe, die in die Kamera lachen. Der eine mit wüsten Locken und großen, blauen Augen, einer zierlichen Nase, der andere mit einem Pottschnitt, darunter ein schmales, grünes Augenleuchten. Poloshirt stand neben Karohemd, über dem die Träger einer Latzhose spannten. Wir haben die Arme um die Schultern des anderen geschlungen.
Der Bildschirmhintergrund seines Rechners zeigt das Foto eines grauen Sees in den Bergen. Das Ufer ist zweigeteilt: Der grüne Teppich eines Nadelwalds wird plötzlich von verbrannten Stümpfen abgelöst. Manja fängt meinen Blick auf und nickt. »Kanada.«
Vor zwei Sommern hat er für mich völlig überraschend dieses Wagnis auf sich genommen und ist alleine nach Nordamerika gereist.
»Ich muss raus. Einfach mal raus«, hatte er gesagt.
Als er zurückkam, hatte er Farbe im Gesicht bekommen und lachte viel. Er studierte, schrieb Artikel für Zeitungen. Bald saßen wir wieder zusammen in Bars und Kneipen. Und er rauchte und gestikulierte wie immer.
Ich öffne sein Mailprogramm. Eine neue Nachricht erscheint:
hallo felix,
danke für deine nachricht. ich bin noch bis ende juni in frankreich. wenn ich nicht unterwegs bin, kannst du jederzeit bei mir übernachten. melde dich einfach.
liebe grüße,
hanna
Ich frage Manja, wer Hanna ist. Sie kommt herüber, stellt sich hinter mich. Ihr Atem streicht über meinen Nacken. Ich kann sie riechen, einen künstlichen Blumenduft, dahinter zwieblig-scharfer Schweiß. Eine Weile schweigt sie, zieht leise Luft durch die Nase.
»Ich hab da den Überblick verloren.« Sie lacht.
»Geht mich ja nichts mehr an, hat er immerhin gesagt.«
Ich durchsuche seine Kontakte. Hanna Bechtel, dazu eine E-Mail-Adresse. Ich versuche den Namen einzuordnen, aber es misslingt. Als ich Antworten wähle, legt Manja mir ihre Hand auf die Schulter.
»Willst du jetzt alle seine Weiber anschreiben?«
Ich tippe einige Buchstaben, lösche sie wieder. Manjas Anwesenheit drückt auf meinen Rücken. Ich will ihn finden, Manja tut, als wäre es ihr egal. Die zornige Exfreundin stört mich, bringt meine Gedanken durcheinander. Ihre Anwesenheit ist ein andauernder Kommentar in meinem Kopf: Was du tust, ist Unsinn. Der kommt wieder.
Ich schließe das E-Mail-Programm und klappe den Rechner zu.
»Schon genug?«
Sie grinst, stellt ihre Tasse auf den Schreibtisch und geht zur Toilette. Schnell öffne ich den Bildschirm wieder, dann das Programm, tippe Hannas Adresse in mein Handy.
Aus dem Bad höre ich die Spülung. Mein Blick ist erst ziellos, verfängt sich dann am Fensterbrett hinter dem Schreibtisch. In der Ecke, unterhalb des Griffs, liegt ein dickes, schwarzes Buch mit Ledereinband. Keinerlei Aufdruck. Ein Notizbuch vielleicht. Ich greife danach, lege es vor mir auf den Tisch. Einige Zettel ragen heraus, quellen hervor und verdicken die Seiten.
»Tagebuchschnüffler?«
Ich hebe die Hände zurück. Manja tritt neben mich, nimmt das Buch in die Hand, lässt einige Seiten durch die Finger gleiten.
»Findest du sicher spannend. Aber nicht heute. Ich muss los.«
Sie hält das Buch in der Hand, klappt es zu. Ihr Blick fordert mich auf zu gehen, drückt mich aus der Wohnung. Gleichpolige Magneten, denke ich. Oder noch etwas anderes. Ich stehe auf. Sie legt das Buch auf den Schreibtisch und folgt mir in den Flur.
Zu Hause angekommen verschiebt sich der Blick auf die eigene Wohnung. Vorher: der Heimweg mit dem Fahrrad über die Spree, die lange Steigung an der Warschauer Straße, rechts die Backsteinbögen des U-Bahn-Viadukts, darin Gitterstangen vor trüben Fenstern und Holzplatten, Werbung für Konzerte, Meditationsgruppen. Über mir dröhnte die Bahn. Ich kämpfte, strampelte bis zur Atemlosigkeit. Die Stufen in den dritten Stock rannte ich mit schweißnassem Rücken empor. Das zweifache Drehen des Schlüssels im Schloss verriet mir, dass ich alleine sein würde.
Im langen Flur dehnt sich der eigene Körper aus, lässt ein Druck nach, der wie eine zweite Haut über mir gelegen hat. In der Küche steht der Geruch nach Essen vom Vorabend, aus einer Pfanne mit angetrockneter Pasta. Ich tippe mit dem Zeigefinger in knittrige Pilze und einen beigen Brei verfestigter Sahne. Das erste Mal seit einigen Stunden denke ich an Sarah, die unterwegs ist, immerzu. Sie jagt aus meinem Kopf hinaus, jagt Geschichten nach, die jetzt Storys sind. Ich versuche mich an ihren heutigen Termin zu erinnern, der eine Pressekonferenz sein kann, ein Interview vielleicht.
Im Wohnzimmer, auf dem großen Sofa, gleich vorne, stapeln sich Zeitungen. Sie nennt es Recherchen, ich die Unfähigkeit, sich von altem Papier zu trennen. Ich gehe zum Regal an der Kopfseite des Raumes, schalte das Radio ein. Stimmen erklingen, die schnell sprechen, die Hörer auffordern, anzurufen. Es ist Fragestunde, Zeit für Quizblödsinn. Auf dem Esstisch in der Mitte des Raumes versteckt sich mein Laptop hinter einem Berg ihrer Bücher.
Hallo Hanna,
ich heiße Jakob und bin ein Freund von Felix. Leider ist er seit einigen Tagen unterwegs, ohne jemandem gesagt zu haben, wohin. Ich habe eine E-Mail von ihm gesehen, in der er Dich um Unterkunft bittet. Hast Du etwas von ihm gehört? Ich würde mich freuen, wenn Du mir kurz Bescheid gibst, falls er sich meldet oder bei Dir auftaucht.
Viele Grüße,
Jakob
Ich setze dreimal an. Ein Freund von Felix. Felix’ bester Freund. Ein Freund von Felix. Ein bester Freund wüsste, wohin er verschwunden ist. Für einen besten Freund wäre das Warum keine Leerstelle. Vielleicht gibt es irgendwo einen Freund, dem er all das erzählt hat. Vielleicht kann ich diesen Freund finden.
Ich versuche zu lesen, ein Buch zuerst, von dem Sarah immer wieder gesagt hat, es sei großartig. Aber schon bald lese ich ganze Seiten, ohne dass ihr Inhalt in meinem Kopf haften bleibt. Etwas in mir sperrt sich. Ich wechsle zu einer Zeitung, überfliege einige Artikel, lasse das Papier schließlich auf meinen Schoß sinken. Ich lege die Füße auf die Lehne des Sofas, lasse den Kopf zurücksinken. Mein Blick streicht über die Decke, wird ein Starren, in eine sich auflösende Schärfe.
Nach Minuten, einer Stunde vielleicht, höre ich das Knacken der Wohnungstür direkt in meinem Kopf. Schritte fliegen kaum hörbar über den Boden. Ich überdehne den Nacken, sehe Sarah auf den Kopf gestellt in den Raum kommen. Ihre langen Beine stoßen sich von der Decke ab. Die blonden Haare, ihr Pferdeschwanz, trotzen nahe dem Boden der Schwerkraft.
Ich setze mich auf, drehe ihr Bild in meinem Kopf. Für einen Moment schwindelt mir. Ihre Augen lachen mich an, eine grün leuchtende Neugier, die sofort durch den Raum springt, dann zu mir zurückkehrt.
»Hast du geschlafen?«
Ich zucke die Schultern. Der Riemen ihrer Umhängetasche läuft quer über ihren Brustkorb, spannt ihr kurzes, schwarzes Kleid, unter dem eine dunkle Jeans hervorlugt. Sie bemerkt meinen Blick, quittiert ihn mit einem Lächeln, als sie sich bückt und die Stiefel auszieht. Ich spüre den Drang, mich ihr zu nähern, so stark, wie ich noch vor wenigen Stunden das Gefühl des Abgestoßenseins bei Manja gespürt habe.
»Warst du in Felix’ Wohnung?«
Ich nicke.
»Und gibt’s was Neues?«
Ich erzähle ihr von den verlassenen Räumen, dem Laptop und dem Schrank voller Anzüge.
»Und das gefällt dir nicht?«
Ich schweige. Ich habe ihn nie im Anzug gesehen, vom Schulabschluss einmal abgesehen. Damals steckte er, wie wir alle, in einem schlecht sitzenden Sakko. Er tanzte Walzer mit seiner Mutter. Felix war der Erste, der sein Jackett auszog, dann seine Schuhe. Er flog durch den Saal des Curiohauses, forderte unsere Deutschlehrerin auf und erntete dafür die schiefen Blicke einiger Mitschüler. Später saßen wir auf dem Kantstein an der Rothenbaumchaussee, tranken Wein aus der Flasche und machten Zukunftspläne. Uns gegenüber die teuren Eigentumswohnungen, Hamburger Altbau, rechts von uns die Lichter des Dammtorbahnhofs. Der Erste von uns übergab sich in einen Rosenstrauch vor dem Eingang. Der Abend war ein Rausch, über dem heute eine traurige Schicht spannt, die einen ungetrübten Blick verhindert. Irgendwo zwischen damals und heute hat Felix seinen Schrank mit Anzügen gefüllt. Und jetzt ist er verschwunden.
Sarah legt ihre Tasche ab und geht in die Küche. Nach einigen Minuten kommt sie zurück, ein Glas Wein in der rechten Hand, in der linken einen Teller mit Obst und etwas Käse.
»Hunger?«
Sie setzt sich an den Esstisch, trinkt einen Schluck und sieht mich an. In ihrem Blick liegt etwas Undefinierbares. Ein kleiner Teil von ihr entzieht sich mir, will sich mir nicht erschließen, schon solange ich sie kenne. Ich setze mich ihr gegenüber, schaue auf den geöffneten Laptop, drifte davon.
Sarah steht auf, läuft um den Tisch und kommt zu mir. Sie setzt sich auf meinen Schoß, liest schweigend die geöffnete Nachricht an Hanna. Ich lehne mein Kinn auf ihre Schulter und versuche, meine Sätze wie durch ihre Gedanken hindurch aufzunehmen. Sie dreht sich zu mir.
»Eine Freundin?«
»Aus seinem Posteingang.«
»Und woher?«
»Keinen Schimmer.«
»Aber du spionierst.«
»Ich versuche es.«
Sie zögert kurz. Ihre Augen verengen sich.
»Und du hast keine Ahnung.«
Der nächste Tag. Wochenanfang, Arbeitswoche. Ich bemühe mich um Konzentration in einem Kopf, der einen rissigen Damm aus Gedanken flickt. Erinnerungen schießen hervor, bringen Bilder, die seit Jahren vergraben waren. Meine Finger tippen Berichte, ich telefoniere mit Programmierern und Entwicklern, während ich vor meinem inneren Auge mit Felix durch Eppendorf laufe, mit dem Edding auf Hauswände und Türen schreibe. Dagegen stemmen sich Tabellen, Zahlenkombinationen. Dialoge für Spiele wollen abgestimmt und gesprochen werden. Kinderkram, unterhaltsam und lehrreich, und gerade deshalb immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Mittags rufe ich Manja an, sage ihr, dass ich möglichst schnell wieder in die Wohnung will. Sie lacht.
»Passt es nicht?«, frage ich.
»Doch, doch. Ganz wie du willst.«
»Dann um acht.«
»Ich warte in der Wohnung.«
Felix wohnte einige Straßen entfernt. Er ging in dieselbe Grundschule, dieselbe Klasse. Ich saß am ersten Schultag ängstlich in der Ecke und weinte. Der blonde Junge in Latzhose turnte durch die Klasse und sang. Irgendwann blieb er vor meinem Tisch stehen.
»Musst doch kein Schiss haben.«
Es kann meine eigene Erinnerung sein oder eine Erzählung meiner Mutter. Bilder aus Fotoalben schieben sich dazwischen, verwandeln die Geschichten. Wie ich ihm in der ersten Pause den Fußball an den Kopf schoss und er hinschlug. Und dass jemand rief, ich hätte es mit Absicht gemacht. Irgendwann, in unserem ersten gemeinsamen Jahr in Berlin, erzählte ich ihm die Geschichte. Er schüttelte den Kopf.
»Das war später. Als du in Anne Schäfing verknallt warst.«
Küsse fangen im Sportunterricht. Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Und wenn er kommt? Dann laufen wir! Anne will mich heiraten. Mir hat sie das aber zuerst gesagt. Und ich schubste ihn gegen den Türrahmen oder schoss ihm einen Ball an den Kopf. Die Erinnerung mischt Bilder, löst Geschichten auf.
»Jakob?«
Ein Kollege lehnt sich an den Türrahmen meines Büros.
»Die Beta für das Adventure ist da.«
Kinderspiele für Kindergedanken. Zu unseren ersten gemeinsamen Erinnerungen gehören Schlägereien, Streitigkeiten um sechsjährige Mädchen. Irgendwann kam der Schulabschluss und dann Berlin. Und jetzt hat er sich davongeschlichen. Und in mir wächst dieses Gefühl, dass seine Wohnung ein Puzzle für mich ist. Es wird Fährten geben, Spuren, die irgendwo in seinem Rechner, in den Notizen zu seinen Büchern versteckt sind.
Am Abend. Der Wrangelkiez ist hell erleuchtet. Kleine Touristengruppen ziehen Sprachnetze aus Italienisch, Spanisch oder Englisch hinter sich her. Kinder spielen an der Straßenecke, erhellt vom Neonlicht aus Wettparadiesen. Im Innern stehen mittelalte Männer, abwechselnd über Papiere gebeugt oder den Kopf zu den Bildschirmen unter der Decke gehoben. An den Straßenschildern hängen zerbeulte Fahrräder mit verbogenen Reifen. Gegenüber dem Hauseingang parkt ein orangefarbener Laster. Die Seitenwand des Laderaums ist voller Graffiti, Obst und Gemüse, Gesichter, darüber die Worte Bizim Bakkal. Im Hintergrund der Laden, dessen Auslage gerade vom Händler eingeräumt wird.
Ich wechsle die Straßenseite, gehe zur Haustür. Auch hier überall Graffiti. Rosa Druckbuchstaben über den Klingelknöpfen: Schneewittchen. Ich muss unwillkürlich an Manja in einem Glassarg denken und grinse, als ich auf den Klingelknopf drücke.
»Und jetzt?«
Manja öffnet die Tür, steht in T-Shirt und Jeans im Flur. Ihre kurzen, schwarzen Haare, sonst glatt am Kopf anliegend, wirken strubbelig, zerzaust. Ihre Jacke hängt als einziges
Kleidungsstück an der Garderobe. Sie stemmt die Hände in die Hüften. Kleine Züge von Spott hängen wie Reste von Eiscreme in ihren Mundwinkeln. Ich frage mich, was Felix an der stämmigen Manja gefunden hat, frage mich nicht zum ersten Mal. Pummeldrache hat Basti sie getauft, dabei ist es geblieben. Als Felix den Namen hörte, lachte er. Dann gab er Basti eine klatschende Backpfeife.
»Ein Gruß vom Pummmeldrachen, du Arschloch.«
Im Flur, im Halbschatten des Abends, wirkt sie ungewohnt klein. Andere Wörter drängen sich auf: muskulös, sehnig. In ihrem Körper ist eine andauernde Spannung spürbar. Die Größe ihres Busens ist unter dem weiten T-Shirt nur zu erahnen. Sie verschränkt die Arme, als könne sie meine Gedanken lesen.
»Also, was jetzt?«
Sie macht einige Schritte rückwärts, überlässt mir den Flur.
Bis vor zwei Monaten war Manja Felix’ Schatten, saß neben ihm in der Kneipe und ging mit ihm zu Konzerten. Ich traf sie gemeinsam beim Einkaufen, auch wenn ich mit ihm schwimmen ging, war sie fast immer dabei. Eines Abends dann hatte er eine rothaarige Schönheit im Arm, als er zu uns in die Kneipe kam. Weiße Haut, fast durchscheinend, ihre Augen Kristalle. Eine Elfe, ohne Flügel, dafür mit einer winzigen, glitzernden Handtasche an ihrer Seite, die sie vorsichtig über die Stuhllehne hängte.
»Marie.«
Mehr sagte er nicht. Sie lächelte verlegen und gab uns reihum mit ihren dünnen, langen Fingern die Hand. Ihr ganzer Körper war ein Gegenentwurf zu Manja, ihrer Vorgängerin. Ich versuchte freundlich zu ihr zu sein. Als sie später gegangen war, fragte ich nach Manja. Felix starrte in sein Bier, schüttelte den Kopf.
»Ich und ein Drache? Das konnte ja nicht ewig gehen.«
Er nahm einen Schluck Bier.
»Das war …«
Er fuchtelte mit der Hand vor dem eigenen Gesicht.
»Albern.«
»Und das Ruhekissen?«
»Nadeln drin.«
An diesem Tag, in der Wohnung, tut Manja mir leid. Auf dem Tisch vor dem Sofa wartet eine Kanne Tee, aus der Dampf aufsteigt. Manja wirkt unsicher, vielleicht verärgert. Sie tippt wortlos das Passwort des Rechners. Wieder rauscht die Maschine.
Ich frage mich, ob Felix ihr jemals erzählt hat, was wir von ihr denken. Wobei ich eigentlich selbst nicht weiß, was ich von ihr denken soll, was ich damals über sie gedacht habe. Sie überlässt mir den Platz am Rechner und geht zurück in die Küche. Ich höre sie Schränke öffnen, Geschirr räumen.
Im Posteingang liegen drei Werbemails, dazu die Newsletter eines Theaters und einer Literaturseite. Hinweis auf eine Lesung am Wannsee. Ich lösche, ziehe die Nachrichten aus dem Papierkorb aber sofort zurück. Es ist Felix’ Rechner, es sind seine Nachrichten. Ich nehme die Hände von der Tastatur und starre auf den Bildschirm.
»Nichts Neues?«
Manjas Stimme hallt aus der Küche, und ich weiß nicht, ob sie mit mir spricht oder mit sich selbst. Neben dem Laptop, auf der Kante des Schreibtischs, liegt das Notizbuch, ein Tagebuch vermutlich. Ich versuche mich zu erinnern, ob es gestern an dieser Stelle gelegen hat. Der Verdacht drängt sich auf, Manja könne darin gelesen haben, im Buch könnten Hinweise auf ihre Schwächen stehen. Ich nehme es in die Hand und drehe mich auf dem Schreibtischstuhl.
»Du auch?«
Sie gießt sich Tee in eine bunte Tasse und schaut mich an. Ihre buschigen Augenbrauen sind über der Nase sauber getrennt, fast wie mit einem Lineal gezogen. Ich stehe auf, gehe durch den Raum und setze mich neben sie, das Buch in der Hand, neben mir das Plätschern des Tees. Manja atmet konzentriert, während sie eingießt. Ich schaue sie von der Seite an, schaue auf die Tasse. Sie blickt auf das Buch auf meinen Knien. Der übliche Spott in ihrer Stimme.
»Du hast dich also zum Schnüffeln entschieden?«
Ich zucke die Schultern, sage ihr, dass ich nicht weiß, ob überhaupt etwas zu finden ist. Sie lacht ein helles, beinahe klirrendes Lachen. Warum ich dann hier bin? Sie steht auf, stampft über die Dielen und setzt sich an den Rechner.
»Tu dir keinen Zwang an.«
Leises Klacken der Tastatur im Hintergrund, unterbrochen von schnellem Mausklicken. Ich halte das Buch in der Hand, lasse meinen Daumen über den Kopf der Seiten streichen. Ich bleibe an einer herausragenden Pappkante hängen und ziehe daran. Eine Konzertkarte – The Rifles, ein Datum im Winter. Ich klappe die Seiten mit der Karte auf.
16.3.
Manjas Haut
Gestern habe ich mit den Fingern darübergestrichen und gedacht: Wie hart sie ist. Aber es war dann nur die Hornhaut meiner Hand. Als ich es ihr sagte, lachte sie. Manchmal denke ich, dass sie mich auslacht. Ich habe mich aber nie getraut, sie tatsächlich zu fragen.In mir ist diese Angst, sie könnte darüber lachen und mit dem Lachen dann nie wieder aufhören.
Die Wohnung war die erste, das Lesen dieses ersten Eintrags markiert das Überschreiten einer weiteren Grenze. Ich lese über Manja, während sie in meinem Rücken am Schreibtisch sitzt. Ich spüre ein Kribbeln im Körper, bis in die Fingerspitzen. Ich frage mich, warum Felix die Karte genau dort platziert hat. An das Konzert erinnere ich mich, an den dunklen Backstein des Postbahnhofs, die zwei eckigen Türme an der Frontseite und die hohen Fenster darin. Der Weg führte an der leicht gebogenen Seitengalerie entlang. Eine Kathedrale, dachte ich. Gruppen junger Menschen drängten sich zum Eingang der Konzerthalle. Im Hintergrund standen beleuchtete Kräne vor einer hellen Außenwand aus Beton, in der offene Stellen klafften, dahinter Schwärze. Einige Säulen waren zu erkennen, Gerüste, aus Holz oder Stahl, vereinzelte Scheinwerfer, auch abends war hier noch Bewegung. Die offene Front der Arena starrte auf die Spree, auf ihre eigenen Vorboten: Einen leuchtenden LCD-Bildschirm, übergroß auf einen Pfeiler montiert, der die gesamte Uferpromenade beherrschte. Vor uns Gitterzäune, kalter Wind und ein Himmel, der auf den Schädel drückte.
In der Halle roch es nach Schweiß und Rauch. Fremde Körper stießen sich zu den schnellen, glatten Gitarrenriffs. Ständige Sprünge, Harmoniewechsel. Schlagzeugdröhnen. Die Stimme des Sängers klang röhrend, traf trotzdem die Töne, irgendwie. All I want is a little peace and quiet. Ich sang mit, sprang in der Menge, wie ich es seit Jahren nicht mehr getan hatte. Ich prüfe das Datum der Karte. Blättere dann im Buch.
23.11.
Das Konzert war gut. Für ein paar Stunden war diese Anspannung aus dem Körper. Ich war befreit von dem Gefühl, mich von innen zerreißen zu wollen, um aus dem eigenen Körper zu können. Die Musik, laut und alles durchdringend, trotzdem Wärme ausstrahlend, war eine Klanghaut, die alles zusammenhielt, für den Augenblick. Ich frage mich, ob Jakob etwas gemerkt hat.
Ob Jakob etwas gemerkt hat. Ein Satz, für mich notiert, in seiner feinen, eng gesetzten Schrift. Gleichmäßige Buchstaben, fast wie gedruckt. Seine Gedankengänge dagegen erscheinen mir fremdartig, verbogen.
Die Frage, was Jakob hätte merken können.
Das Gefühl, mich von innen zerreißen zu wollen.
Du weißt nicht, wie der tickt, wenn der ausrastet.
Ich blättere.
10.1.
Was ich nicht verstehe, nicht begreifen kann oder will, aber brauche, ist Manjas Selbstverständlichkeit. Sie ist da. Ich glaube manchmal, dass sie nicht nach dem Warum fragt. Sie ist einfach da. Aber wahrscheinlich tue ich ihr Unrecht. Ihr Körper strahlt eine Ruhe aus, die meine Nervosität absorbiert, sie aufnimmt und verwandelt. Sie hat einen festen Griff, der keine Zweifel zulässt.
Manja sitzt immer noch schweigend am Rechner, trinkt ihren Tee. Vielleicht wartet sie auf eine Eröffnung. Ich versuche die Stille auszuhalten. Sie pustet auf die dampfende Flüssigkeit, hält die Hände um die Tasse geschlossen.
»Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?«
Sie setzt ihren Tee ab und schaut mich an, als bemerke sie mich gerade zum ersten Mal. Dann rollt sie die Unterlippe ein, beißt mit ihren kleinen, geraden Zähnen darauf.
»Vor zwei Wochen. Oder drei. Weiß nicht mehr.«
»Hier?«
Sie schüttelt den Kopf.
»In meiner Wohnung.«
Sie sieht meine Überraschung, lehnt sich zurück und nickt langsam. Ihr Blick ruht sich auf der weißen Kanne vor ihr aus. Ich versuche die Zeit einzuordnen, mich an den Tag zu erinnern, an dem Felix mit Marie statt mit Manja zu uns kam.
»Felix und diese Mädchen.«
Manja lacht und streicht mit dem Zeigefinger über den Deckel der Teekanne. Sie spricht mit sich selbst.
»Ein bisschen ficken. Ein bisschen Spagat und Bewunderung. Das war’s dann meistens. Wisst ihr ja.«
Schon eine Woche nach dem Auftauchen von Marie war wieder eine andere Frau an seiner Seite. Ich erinnere mich erneut an ihre langen, dünnen Finger. Aber ich bin nicht sicher, ob es nicht Maries Finger sind, die ich sehe. Ich bin nicht einmal sicher, ob ich sie nach diesem ersten Abend noch einmal gesehen, ob ich überhaupt mit ihr gesprochen habe. Manja schließt die Augen. Sie lächelt.
»Nachts hat er geklingelt, einfach so. Als sei das völlig normal, dass er vor meiner Tür steht. Ich bin’s. Und ich habe aufgemacht. Und er konnte sich ausheulen. Er konnte bei mir liegen. Und weißt du – weißt du, was er letzte Woche gesagt hat? Was er – dieses Arschloch.«
Sie steht auf, läuft in die Küche. Ich schaue auf ihre Jeans, das Ruhekissen. Nadeln drin. Ich will sie fragen, ob sie weiter mit ihm geschlafen hat. Ich will sie fragen, über was er sich ausgeheult hat. Und ich will wissen, warum sie ihn nicht einfach hat draußen stehen lassen.
Felix, der Bewunderte. Felix, der meine Verwandten in Verzückung versetzen kann. Ich erinnere mich an meine Großmutter auf einem meiner Geburtstage, dem achten oder neunten. Eine Party für Kinder, mit Ballons und Luftschlangen, einem Zauberer, den meine Eltern engagiert hatten. Meine Großmutter kam im Wohnzimmer auf uns beide zu und fuhr Felix durch die Haare. Ich stand neben ihm, schaute ihr dabei zu und sah ihr Lächeln. Erst nach einigen Sekunden nahm sie die Hand von seinem Kopf, zog mich an sich und drückte mir einen Kuss auf die Wange. Ich schaute Felix an und sah in seinen weichen Kugelaugen den entschuldigenden Blick.
Vielleicht stimmt diese Erinnerung nicht. Vielleicht habe ich sie an mein Bild von Felix angepasst. Oder an mein Bild von mir selbst. Immer habe ich nah bei Felix gestanden, aber der Fokus war stets auf ihn gerichtet.
Manja kommt mit einem Bier aus der Küche zurück. Sie bleibt vor dem Rechner stehen, blickt auf den Monitor. Als sie weitergehen will, stößt ihre Hand gegen den Schreibtischstuhl. Das Bier schäumt, läuft ihr über die Hand, tropft auf den Boden. Sie stört sich nicht daran, nimmt einen Schluck.
»In meiner Wohnung will ich dich nie wieder sehen!«
Sie verschränkt die Arme vor der Brust. Als ich nicht sofort reagiere, wiederholt sie den Satz. Ich drehe mich um. Sie hält mir das Bier hin.
»Einen Schluck? Ist das letzte.«
Ich schüttle den Kopf. Sie zuckt die Schultern und trinkt. Die Bewegungen ihres Kehlkopfs sind langsam und gleichmäßig. Sie setzt ab und wiederholt diesen Satz ein zweites Mal, sieht mir dabei in die Augen. Ich schaue zu ihr hinauf, auf ihr rundes Kinn, das aus meiner sitzenden Position gigantisch wirkt.
»Zu mir kommen konnte er. Aber hier zu sein wollte er mir verbieten. Manjas Asyl, die Bahnhofsmission.«
Mir fällt auf, dass ich nicht weiß, wo sie wohnt. Ich glaube, dass Felix etwas von Kreuzberg gesagt hat. Oder Kreuzkölln. Sie kann aber umgezogen sein, kann jetzt überall wohnen. Ich versuche Manja in eine Altbauwohnung in Charlottenburg zu verpflanzen. Der Gedanke lässt mich lächeln.
»Was?«
Sie zieht die Brauen zusammen. Ich hebe eine Hand, lasse sie auf meinen Oberschenkel fallen. Dieser Satz von ihm in Manjas weicher, heller Stimme, die wie ein Kontrapunkt zu ihrem Körper ist. Seine Abwesenheit füllt sich mit all diesen Worten aus ihrem Mund und seinem Notizbuch. Und sie steht über mir, starrt mich an. Schließlich sage ich, dass ich solche Sätze nicht mit ihm verbinden kann. Sie lacht und geht zur Tür.
»Was ihr so alles nicht wisst …«
Sie verschwindet im Flur, kommt kurz darauf mit Stiefeln und Jacke zurück.
»Ihr Kneipenphilosophen.«