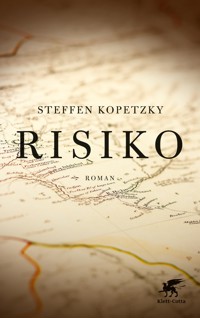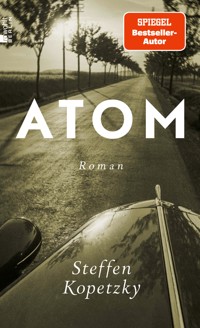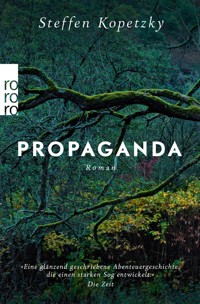12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leo Pardell, gescheiterter Student, sollte eigentlich auf Sprachreise in Buenos Aires sein. Mutter und Freundin spielt er den Südamerika-Aufenthalt per Telefon vor, heuert aber in Wahrheit als Schlafwagenschaffner an und reist kreuz und quer durch Europa. Dabei trifft er nicht nur französische Schmuggler, bulgarische Verführungsspezialisten, korrupte Kontrolleure, kluge Buchhändlerinnen und Brüsseler Bürokraten, sondern auch einen exzentrischen Uhrensammler auf der Suche nach einem legendären Stück. In dessen Jagd wird er unversehens tiefer hineingezogen, als er dachte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1045
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Steffen Kopetzky
Grand Tour oder die Nacht der Grossen Complication
Roman
Über dieses Buch
«Ein ungemein unterhaltsames, komisches und atemberaubend intelligentes geistiges Abenteuer.» Alberto Manguel
Leo Pardell, gescheiterter Student, sollte eigentlich auf Sprachreise in Buenos Aires sein. Mutter und Freundin spielt er den Südamerika-Aufenthalt per Telefon vor, in Wahrheit heuert er als Schlafwagenschaffner an und reist kreuz und quer durch Europa. Dabei trifft er nicht nur französische Schmuggler, bulgarische Verführungsspezialisten, korrupte Kontrolleure, kluge Buchhändlerinnen und Brüsseler Bürokraten, sondern auch einen exzentrischen Uhrensammler auf der Suche nach einem legendären Stück. In dessen Jagd wird er unversehens tiefer hineingezogen, als er dachte …
«Virtuoses Spiel um Zufall und Zeit, Reisen und eine komplizierte Uhr. Eine Lust zu lesen.» Die Welt
Vita
Steffen Kopetzky, geboren 1971, ist Autor von Romanen, Erzählungen, Hörspielen und Theaterstücken. Sein Roman «Monschau» (2021) stand monatelang auf der «Spiegel»-Bestsellerliste, ebenso wie «Risiko» (2015, Longlist Deutscher Buchpreis). «Propaganda» (2019) war für den Bayerischen Buchpreis nominiert. Von 2002 bis 2008 war Kopetzky künstlerischer Leiter der Theater-Biennale Bonn. Er lebt mit seiner Familie in seiner Heimatstadt Pfaffenhofen an der Ilm.
«Ein witziges, weises, gewagtes, abenteuerliches – kurz: ein ganz und gar hinreißendes Buch.» Stern
«Kopetzkys literarisches Husarenstück ist ein Initiationsroman … Kopetzky ist ein geistreicher Konstrukteur, der Piranesis Labyrinth als Roman nachbaut.» Neue Ruhr Zeitung
«Wie auf Eisenbahngleisen führt Kopetzky die Handlungsstränge, lässt die Figuren vorangleiten, sich einander nähern und verbinden und wieder voneinander entfernen. Das ist sehr virtuos.» Der Spiegel
«Mit Witz und starken Dialogen treibt Kopetzky seine pikaresken Verwicklungen auf die Spitze.» Neue Zürcher Zeitung
«‹Grand Tour› ist ein Meisterwerk von internationaler Klasse!» Deutschlandfunk Kultur
Impressum
Die Originalausgabe erschien zuerst 2002 im Verlag Eichborn AG, Frankfurt am Main.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Lektorat Wolfgang Hörner
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Frank Baquet/plainpicture
ISBN 978-3-644-01353-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Rosi und Walter,
meine Eltern
Dieses Buch beruht auf eigenen Erfahrungen und Erlebnissen, ist aber in allen Punkten der Handlung – was Figuren und Geschehnisse betrifft, insbesondere auch die wirtschaftlichen und verkehrspolitischen – frei erfunden. Ähnlichkeiten mit Personen oder Vorgängen in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft wären allenfalls zufällig. Insbesondere möchte der Autor seine geschätzten Leser dringend davor warnen, sich an den im Buch beschriebenen Abfahrts- und Ankunftszeiten und sonstigen Fahrplanangaben zu orientieren.
Außer man hat viel Zeit und Lust auf Überraschungen.
S. K.
PrologZarter Flugschatten
Wir betreten die Bahnhöfe: fast immer in der Stadtmitte gelegen, an ihren Vorderseiten kolossal den großen Boulevards geöffnet, Einfallstore in eine Welt aus Fahrplänen und Destinationen. Wir betreten die Bahnhöfe, an irgendeinem Ort, stehen vor der Pariser Gare de l’Est, unser Blick wandert über die Front, wir erheben uns, passieren die hundert Jahre alten Figurinen des Verkehrs und des modernen Fortschritts, setzen uns kurz auf einen der Vorsprünge, von deren Höhe aus die scheinbar chaotische Bewegung des Kommens und Gehens der Reisenden eine Ordnung erhält, eine Logik des Austauschs und des freien Fließens, die, je höher wir steigen, desto geschmeidiger und natürlicher erscheint, wie auch die Stränge der Schienen, die undurchschaubar und wahllos wirken, solange man sich auf gleicher Höhe mit ihnen befindet. Doch jetzt, in diesem Augenblick, da wir den Bahnhof Milano Centrale endgültig überblicken und die klassische Anordnung seiner kolossalen Treppenhäuser begriffen haben, wenden wir uns wieder nach Norden und ermessen bewundernd den Strauß von Richtungen und Verzweigungen, der sich uns darbietet. Es ist ganz egal, welchem der Schienenstränge wir folgen: Sie führen fort, verzweigen sich immer weiter und weiter, bis sie in der selbstbewusst aufragenden Südostseite des Genfer Hauptbahnhofsenden, in der theatralischen Kulisse des Bahnhofs von Straßburg, in Genuas orientalischer Phantasmagorie mit ihrer kleinen, spitzen Kuppel und den in die Felsen gebauten Bahnsteigen, die lang gestreckten, kühlen Höhlen gleichen. Wir umschweben das zierliche, in den Stadtverkehr gesenkte Portal des Hauptbahnhofs Kopenhagen, Helsinkis schweigende Wächter, die riesigen Granitfiguren, die gewaltige leuchtende Kugeln in die nordische Nacht hineinhalten, spüren die Hektik von Santa Maria Novella in Florenz oder die atemberaubende Weitläufigkeit von Wien-West, um schließlich auf den Gedanken zu kommen, uns irgendwo im Inneren der Bahnhöfe niederzulassen und den Flug zu unterbrechen. Dort allerdings, auf den Stahlträgern, den Säulen und den gegen alle Schwere in lichten Bögen geschwungenen eisernen Balustraden, wimmelt es von spitzen Stacheln und von hinterhältigen Drähten, die uns Stromschläge versetzen. Man duldet uns nicht, man vertreibt uns, kaum dass wir uns irgendwo niedergelassen haben. Also durchqueren wir ruhelos die Hallen, fliegen zwischen den Ausgängen hin und her, sammeln uns auf den Vorplätzen, schwärmen auf, und manchmal lassen wir uns in die ruhigen Winkel voller Zigarettenstummel und Abfall treiben, in denen wir plötzlich alleine sind und für uns. Eine Einzelne. Eine unter vielen. Da ist sie.
Wie sollen wir sie nennen? Es gibt so viele ihrer Art, aber da wir beschlossen haben, dieser einen zu folgen, müssen wir ihr einen Namen geben: Sagen wir Leoni? Nein, aber ein ‹L› sollte es schon sein, das ‹L› hat den richtigen Anhauch von Leichtigkeit, leicht muss er sein, der Name, und auffliegend. Um aber neben der flügelnden Leichtigkeit auch das Lichte ihrer Existenz zu treffen, müssen wir noch weitersuchen, das Licht muss aufscheinen in ihrem Namen, denn wenn die Sonne am Nachmittag plötzlich schräg über die Vorplätze und die Hallen fällt, beginnt ihre eigentliche Zeit, und während man ihr nachblickt, denkt man sehnsüchtig daran, dass bald wieder Sommer sein wird …
Wir wollen sie Lucia nennen, das ist ein guter Name. Lucia wurde, sieben Monate vor ihrer gerade erfolgten Taufe, auf einer von sieben Bolzen zusammengehaltenen Querstrebe aus soliden Stahlträgern geboren, zwischen zwei der spitzen Drahtstifte, die eigentlich zur Abwehr angebracht waren und auf denen es sich ihre Mutter geschickt und vorsichtig bequem gemacht hatte, um Lucia zu gebären.
Unserem Blick zeigt sich Lucia im südlichen Teil des Münchener Hauptbahnhofs, nahe der großen Treppe zum Untergrund. Unschlüssig, was sie eigentlich will, ist sie der Zudringlichkeit eines großen, allerdings schon etwas alten Liebhabers ausgesetzt, dem ein Teil seines linken Fußes fehlt, weshalb er bei gewissen zärtlichen Drehungen immer auf den Schnabel fällt. Lucia ist nicht interessiert. Nach einer Weile besinnt er sich und schließt sich einem kleinen Schwarm an, der die nächtliche Bayerstraße Richtung Süden überfliegt. Lucia bleibt und geht äugend über das Pflaster. Es gibt da interessante Lichter: Imbisse!
An einem davon steht ein groß gewachsener Mann, vielleicht Ende fünfzig. Ein leichtes Doppelkinn und überhaupt eine gewisse Schwammigkeit des Gesichts können den athletischen Eindruck, den er vermittelt, zwar trüben, aber nicht ganz zunichtemachen. Die braun gebrannte Glatze und eine ungesunde, auf Alkohol zurückzuführende Röte der Wangen verstärken diesen doppeldeutigen Eindruck, etwas Zwiespältiges, das sich auch in seiner weiteren Erscheinung fortsetzt: Er trägt einen edlen Trenchcoat von Burberrys, wundervolle dunkelbraune Schuhe, deren Leder mit dem Leder seines Gürtels korrespondiert, so, wie der Farbton seiner Strümpfe die Farbe seiner Krawatte wiederaufnimmt. In seiner Linken ein weißes Batisttaschentuch mit dem in zartem Blau gestickten Monogramm FvR und einer kleinen, fünfzackigen Krone darüber. Mit diesem Taschentuch wischt er sich größere Mengen eines Gemischs von Ketchup und Mayonnaise von seinen Mundwinkeln: Er isst, sichtlich heißhungrig, eine ‹doppelte› Currywurst rot-weiß. Dazu nimmt er große, hastige Schlucke aus einer Flasche Augustiner Edelstoff. Von der Semmel fallen Brösel auf seinen Trenchcoat und auf das Pflaster vor seinen Füßen. Während er sich die Brösel von seinem Mantel klopft, blickt er auf die goldene Uhr an seinem Handgelenk, nimmt sein Gepäck auf und geht zügig auf ein in der Nähe wartendes Taxi zu.
Durch des Mannes ruckartige Bewegungen verunsichert, nähert sich Lucia sehr zögerlich den Krümeln und entfernt sich wieder von ihnen, aber jetzt – jetzt hat sie einen beachtlichen Brocken erwischt, wendet sich sofort ab, und als der Trenchcoat des Mannes einen bedrohlichen Schwenk macht, fliegt sie auf in die Halle des Hauptbahnhofs. Lucia passiert das Portal in seinem oberen Drittel, wendet sich nach links den Gleisen und Bahnsteigen zu, überfliegt die Gleise 11 bis 15, um dann neuerlich eine Linkskurve zu beschreiben, deren Bogen sie zunächst weit über die Schienenstränge führt. Sie lässt sich in einem wunderschön niedersteigenden Zirkel sinken, landet schließlich auf dem äußersten Bahnsteig, Nummer 11, und beginnt, so gierig den Krümel zu verzehren, dass sie das Näherkommen des jüngeren Mannes, der den Bahnsteig herunterkommt, erst im allerletzten Moment bemerkt und erschreckt und panisch auffliegt. Der junge Mann bleibt stehen und sieht, wie sie höhersteigend der Glasfront der Dachkonstruktion zufliegt. Er blickt ihr zärtlich und sehnsuchtsvoll nach, obwohl der Aufflug einer Taube auf einem Bahnhof nichts Ungewöhnliches ist. Er sieht ihr nach, die sich, in der plötzlichen Erinnerung, dass es unmöglich ist, auf dem Stahl der Dachkonstruktion zu landen, bis auf die Höhe des unteren Rands der Glasfassade fallen lässt, in die Dunkelheit hinausfliegt und seinen Blicken entschwindet.
Dann geht er das Gleis weiter hinunter. Er denkt nicht daran, dass zwischen ihm und einem anderen Menschen – den er nicht kennt, den er niemals kennenlernen wird – vielleicht nichts als der Flug einer Taube liegt. Oder liegen wird: eine Figur aus Zufällen und Rätseln. Der zarte Flugschatten einer Geschichte.
Erster TeilTransatlantische Illusion
München, Aufenthalt 7.4.1999, 20:35
Stille, würgende Panik. Stärker mit jedem Meter, den Pardell den Bahnsteig 11 des Münchener Hauptbahnhofs hinunterging. Er war viel zu früh aufgebrochen, um auf keinen Fall zu spät zu kommen, und hatte dann unwohl auf den Vorhöfen des Bahnhofs und seinen abseitigen Passagen herumgetrödelt. Er hatte wehmütig die vielsprachigen Auslagen der Zeitungshändler überflogen. Hatte auf dem aufgestellten riesigen Fernsehschirm Bilder von der Bombardierung einer großen Stadt auf dem Balkan gesehen und NATO-Generäle, die Fotos präsentierten, die bewiesen, dass die Bombardierung gerecht und sinnvoll war. Dann hatte er für eine Mark das Los einer Lotterie gekauft, die das Hunderttausendfache des Einsatzes versprach, hatte das Los aufgerissen und mehrere Minuten den Schriftzug «Leider Nicht» gelesen. Zwischendurch hatte er mit der Präzision eines verzweifelten Guinnessbuchaspiranten einen der großen gelben Fahrpläne studiert – und mit all diesen Tätigkeiten hatte er, halb abwesend, so viel Zeit verschwendet, bis zwischen ihm und dem Beginn seines allerersten Dienstes nur noch Minuten standen.
Die letzte Minute entführte eine Taube, die vor ihm aufflog. Er sah ihr nach, bis sie unter dem Dach des Hauptbahnhofs, unter den auf der Innenfassade angebrachten riesigen roten Buchstaben GRUNDIG verschwunden war. Er blickte auf seine Uhr. Sie zeigte 16 Uhr 50, was bedeutete, dass sein Dienst gerade begonnen hatte. In der Compagnie war Dienstbeginn eine Stunde vor Abfahrt, und der Nachtzug nach Ostende würde München – nach Plan – um 21 Uhr 51 verlassen. Dieser Nachtzug führte einen Regelschlafwagen mit sich. Der Schaffner dieses Schlafwagens würde niemand anderes als der junge Mann sein, sein Name ist Leonard Pardell, geboren 1971 in Hannover. Student in Berlin, zz. Urlaubssemester.
Seine Uhr war eine rechteckige Authentic-Panther-Steele, die er vor zehn Jahren vom damaligen Freund seiner Mutter zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Eine schlichte, stählerne Armbanduhr mit einem Neupreis von knapp 200 Mark, eine sogenannte Modeuhr. Sie ging vier Stunden nach.
Das hatte seinen Grund, und so gab es durchaus ein paar Menschen, die bei der Frage nach Pardells augenblicklicher Ortszeit ihrerseits auf ihre Uhr geblickt und vier Stunden abgezogen hätten.
Vor allem für seine Mutter war es von Bedeutung, dass ihr Sohn vor einer guten Woche einen fundamentalen Schritt in seinem Leben unternommen hatte und für ein Dreivierteljahr nach Argentinien gegangen war, um sich den Herausforderungen der Globalisierung zu stellen.
Im Augenblick, dachte seine Mutter, befand Pardell sich in einer innovativen, halbstaatlichen Sprachenschule in Buenos Aires, gelegen im romantischen Stadtviertel Palermo, wo er die vor Jahren erworbenen Grundkenntnisse der spanischen Sprache zügig und mit großem Erfolg vertiefte. In fünf Wochen – denn der Intensivkurs dauerte sechs lange anstrengende Wochen – würde er mit einem international anerkannten Zeugnis, neugierig, furchtlos und fließend Spanisch sprechend, mit dem Nachtzug von Buenos Aires nach Viedma aufbrechen, einer kleinen, romantischen Stadt im Delta des Rio Negro. Die Reise von eintausend Eisenbahnkilometern würde ihn über Mar del Plata und Bahía Blanca führen, immer entlang der landschaftlich reizvollen argentinischen Atlantikküste.
In Viedma würde er dann Felisberto Sima Martínez treffen, den Leiter eines geheimnisvollen Dienstleistungsunternehmens, bei dem Pardell für ein halbes Jahr ein innovatives Praktikum absolvieren würde, um sich den Herausforderungen der Globalisierung zu stellen.
Wohnung in einem direkt am Atlantik gelegenen, romantischen Chalet und köstliche, gesunde Mahlzeiten wurden gestellt. Dazu ein Praktikumshandgeld von monatlich 900 US-Dollar. Martínez arbeitet unter anderem mit der UNESCO zusammen. Weshalb Pardell am 3. Januar 2000, mit einem weiteren, aussagekräftigen Zeugnis, diesmal über seine erfolgreiche Praktikumstätigkeit, glücklich und mit den besten Aussichten wieder in Deutschland eintreffen wird, um im Kreise seiner stolzen Mutter und ihres derzeitigen Freundes vom fantastischen, romantischen Silvesterfest in Buenos Aires zu erzählen, das Felisberto Sima Martínez abschließend ausgerichtet haben wird.
Danach plant Leo mittelfristig den Eintritt in ein innovatives Dienstleistungsunternehmen in Norddeutschland, dessen Operationsschwerpunkt der südamerikanische Raum sein soll. Menschen, Begegnungen, neue Erfahrungen – Flexibilität, unkonventionelle Lösungen für unkonventionelle Aufgaben, Weltoffenheit und eine Liebe zur Sache, zur Begegnung mit Menschen, neuen Erfahrungen mit unkonventionellen Aufgaben, Flexibilität in der Lösung offener Aufgaben und schließlich, ganz wichtig: offene Erfahrungen in Begegnungen mit neuen Lösungen …
Während seine Mutter, keineswegs 11713, sondern nur 495 Kilometer von Leo entfernt, über der Lektüre der Werbebroschüre einnickte, die ihr Pardell mit einem fröhlichen letzten Gruß aus der alten Welt geschickt hatte, und in ihren kurzen, abgerissenen Träumen verwirrende Überlegungen anstellte, versicherte sich Pardell zum zehnten Mal an diesem Abend der Ortszeit von München.
Er folgte dem Lauf des Sekundenzeigers, der seinen Betrachter ohne jede Rücksicht in den negativen Raum der Verspätung drängte. Er war ein paar Schritte weitergegangen, hatte nun fast das Ende der Überdachung erreicht. Seinen Koffer in der Hand, sah er düster den Bahnsteig hinunter. Er fühlte den Windzug aus dem Offenen, wo sich in der Nacht der Weichen und Signale die Gleise mit dem Licht des Bahnhofs verloren.
Er ging die letzten Meter zur Sektion, deren große Eingangstür kurz vor den Treppen zur Bayerstraße lag. Hinter den Rauchglasscheiben sah er Licht, glaubte, auch einen vorbeihuschenden Schatten zu sehen. Er sah das Emblem der Compagnie: zwei goldene Raubkatzen im Oval, auf blauem Grund – er ergriff die Klinke, drückte sie, öffnete die Tür aber nicht, sondern ließ noch einen letzten Spalt zwischen sich und der Helligkeit der Sektion.
Pardell erinnerte sich an das erste Mal, als er in einer ähnlichen Lage gewesen war. Die Adernzeichnungen dieser beiden Augenblicke stiller Panik lagen übereinander, deckten sich annähernd: Er hatte das Fahrrad angeschoben, war dem überaus fröhlich winkenden Dietmar, dem damaligen Freund seiner Mutter, hinterhergefahren. Er wusste, dass er nun für zwei Wochen nichts anderes als das Fahrrad und den fröhlich winkenden Dietmar erleben würde, dass diese beiden sein Kosmos sein würden, an dessen Gültigkeit nichts etwas würde ändern können, für zwei ganze Wochen, einen unbegreiflich langen Zeitraum. Aber seine Mutter wünschte es sich eben so.
Er war zwölf Jahre alt. Er sah Dietmar fröhlich winken und stellte sich die vierzehn mal vierundzwanzig Stunden vor, die es brauchen würde, um von Hannover nach Baden-Baden und zurück zu radeln. Er konnte die Landschaften vorausahnen, die mit einem beständig fröhlich winkenden Dietmar angefüllt waren und die er zu durchqueren haben würde.
Er war verzweifelt gewesen. Aber dann hatte er sich selbst die Straße, in der sie wohnten, auf dieselbe Weise hochfahren gesehen, wie wenn er von der Schule nach Hause kam. Er wusste, die Radtour würde die Hölle sein, aber sie würde enden. Es könnte alles passieren, was die Kombination eines neuen Liebhabers seiner ziemlich attraktiven, sehr liebenswerten Mutter und einer überraschenden, antiautoritären Radtour zum gegenseitigen Kennenlernen fürchten ließ – aber es würde enden. Er würde in den Augenblicken des größten Unglücks schlicht an nichts anderes denken als daran, wie er die Straßehochfahren würde, Dietmar im Rücken, wie er wieder nach Hause kommen und wie alles vorbei sein würde.
Es war dann gar nicht so schlimm gewesen, Dietmar ein netter Typ eigentlich, irgendwas mit Großküchen machte der. Nein, er war eigentlich ganz nett gewesen, wenn es auch nicht lange dauern sollte, bis dieser Dietmar von Bruno verdrängt wurde, Bruno kam schon im folgenden Herbst und blieb ungewöhnlich lange.
Das Wichtigste war: Das alles hier würde ebenfalls enden. Er würde – komme, was wolle – am 1. Januar 2000 frühmorgens durch diese Tür hinaustreten. Und dann trat er ein.
München, Passage 7.4.1999, 20:51
Trotz seiner Unruhe blickte Friedrich Baron von Reichhausen dem Taxi, das die Pienzenauerstraße hinunterfuhr, nach, bis die Nacht die Spiegelungen der Rücklichter von der regennassen Oberfläche der Straße gesaugt hatte. Dann schloss er die Gartentür auf, vermied es, den Blick auf die seit einiger Zeit nicht geöffnete Garage zu werfen, in der ein praktisch ungefahrener rubinroter Daimler stand, und ging durch den feuchten Garten, um den sich sein Gärtner offensichtlich gerade gekümmert hatte. Der Rasen war frisch geschnitten, die Beete geharkt, an manchen Stellen gab es frisch gepflanzte Blumen. Den Gärtner hatte er übernommen, als er vor zwanzig Jahren das Haus gekauft hatte. Der Gärtner war mittlerweile Mitte achtzig und arbeitete seinerseits nur noch für Reichhausen, weil er fürchtete, der Garten könne ansonsten verwildern – denn die Gespräche zwischen ihm und Reichhausen, der ihn oft eingeladen hatte, etwas mit ihm zu trinken, hatten ihm gezeigt, dass der Hausherr nicht das geringste Verständnis für Gartenarbeit hatte.
Der Gärtner trank selten, und wenn, dann mäßig. Er hasste diese Einladungen, die damit begannen, dass der Baron «Hallo! Kommen Sie rein! Es muss unbedingt mehr getrunken werden!» in den Garten hinausrief. Dann saß er unbehaglich auf einem Stuhl, sein Weinglas auf den Knien, und weigerte sich beharrlich, auch nur einen mehr als den ersten Höflichkeitsschluck zu sich zu nehmen, während der Baron Flaschen leerte.
Seiner Ansicht nach trank der Baron zu viel, viel zu viel. Im Übrigen wusste er nur, dass Reichhausen eine Kanzlei für Erbschaftsangelegenheiten und Vermögensverwaltungen führte und darin wohl als die Koryphäe in München galt. Er wusste, dass ein Vorfahr des Barons ein berühmter Marineflieger des Ersten Weltkriegs gewesen war, der von den nostalgischen Zeitschriften des Militärwesens der Rote Baron der Meere genannt wurde. Das Letzte, was er wusste oder ahnte, war, dass der Baron sehr reich war. Nicht nur, weil seine Villa in München-Bogenhausen nur einem reichen Mann gehören konnte, sondern auch, weil sie mit kostbaren Dingen angefüllt war. Wenn er mit dem Baron zusammen im Wohnzimmer sitzen musste, das Weinglas auf den Knien, dann wanderte sein Blick staunend über eine unüberschaubar große Sammlung mechanischer Uhren.
Die einschlägigen Zeitschriften widmeten Reichhausens Sammlung regelmäßig Beiträge. Niemand, außer Reichhausen selbst, wusste genau, wie groß sie war. So wurde sie in der Regel zu den fünf wichtigsten Sammlungen in Europa gerechnet. Reichhausens Anwesenheit auf Auktionen und Ausstellungen wurde stets interessiert zur Kenntnis genommen.
Wenn der Baron genügend getrunken hatte, dann stand er gelegentlich auf, holte eine Uhr aus einer der alarmgesicherten Glasvitrinen, zeigte sie dem Gärtner, bestand manchmal darauf, dass dieser sie anlegte, und erzählte ihm, was es mit ihr auf sich hatte. Wer sie getragen; wer sie gebaut habe. Und wo. Der Gärtner wollte mit dem Luxus und der Trunksucht nichts zu tun haben. Er blieb nur wegen des Gartens, den er seit vierzig Jahren pflegte.
Heute Abend versuchte Reichhausen nicht, ihn einzuladen. Der Gärtner beobachtete, verborgen hinter den Zweigen einer Konifere, wie Reichhausen das Haus betrat. Wie die Lichter im Wohnzimmer angingen. Dort sah er den unheimlichen Baron, wie er seinen Trenchcoat über einen Sessel legte, sich ein Glas holte und eine Flasche französischen Cognac, wie er sich einschenkte und mit dem Glas in der Hand im Wohnzimmer auf und ab ging. Wie er sich immer wieder mit der linken Hand über seine hochrote, glänzende Glatze strich. Der Gärtner beschloss, die Gelegenheit zu nutzen und zu verschwinden, bevor Reichhausen es sich doch noch anders überlegte. Er brachte seine Geräte in den Schuppen hinter dem Haus, nahm sein Fahrrad und radelte, so schnell es ging, nach Hause.
Reichhausen sah ihn über den Rasen laufen. Er hatte ihn auch schon hinter der Konifere gesehen. Er wusste, dass der Gärtner ihn fürchtete. Umso besser, dachte er, dann würde er nie von ihm enttäuscht werden. Er lächelte. Es war etwas absolut Unmögliches geschehen. Reichhausen hatte gestern die Spur eines Gegenstandes entdeckt, nach dem er lange gesucht hatte. Von dem er sehr lange geträumt hatte.
Es handelte sich um die Ziffer à Grande Complication 1924. Seit er als kleiner Junge von dieser Uhr gehört hatte, war sie ein Traumgegenstand. Die Schönheit der aus 637 einzeln angefertigten Teilen bestehenden Mechanik stand als unerreichbares Ideal hinter seiner Sammlung. Die Ziffer à Grande Complication galt als verschollen. Doch letzte Woche hatte Reichhausens Assistent sie in den weit gestreuten Beständen einer großen Erbschaft entdeckt – nein, weniger als entdeckt, er hatte nur ihre Spur gefunden. Sie war zwar in gewissen Unterlagen vermerkt und genau bezeichnet, aber sie fehlte.
Die großen Uhren teilen mit allen übrigen denselben Stoff: die Zeit. Und die Zeit wird andererseits buchstäblich von ihnen geteilt. Je genauer sie das tun, desto einzigartiger werden sie. Desto geheimnisvoller ihre Mechaniken, die abgeschlossen im Dunkel ihrer Gehäuse ruhen. Ihre Mechaniken sind die Gesamtheit der Wege, auf denen die Kräfte ihrer Federn verteilt werden: Sie bestehen aus der Hemmung, Unruh und Anker, aus den Spiralen und schließlich den Kraftmechaniken der ineinanderspielenden Zahnräder selbst.
Die wirklich großen Uhren sind zahlreich. Aber es sind nicht unzählige. Eine sehr große ist die Ziffer à Grande Complication 1924.
Als Samuel Moses Ziffer die Grande Complication baute und sie der Genfer Uhrmacherzunft als sein Meisterstück vorlegte, empfanden und spürten seine Zeitgenossen die geniale Provokation dieses Werks unmittelbar – was konnte eine im Jahre 1924 fertiggestellte Uhr, die eine Jahrtausendanzeige besaß, eine erhebliche, bei einer Armbanduhr noch niemals ausgeführte mechanische Komplikation, anderes bedeuten, als dass ihr Schöpfer davon ausging, sein Werk werde zumindest sechsundsiebzig Jahre und einen Tag laufen?
Es bedeutete, dass ihr Schöpfer den zukünftigen Besitzer dieser Uhr, seinen Enkel, ja wahrscheinlich eher seinen Urenkel, in die Lage versetzen wollte, am 31. Dezember 1999 um Mitternacht die verborgene Tätigkeit eines alleine dafür gebauten und konstruierten Schalters beobachten zu können, der 1,3 Millimeter nach oben rückte und eine Mechanik ins Werk setzte, die anstelle der Ziffern ‹1999› vier andere, nämlich ‹2000›, einrasten lassen würde?
Das war eine Ungeheuerlichkeit, die auf einem solch offensichtlichen Ausmaß von Spekulation und Selbstvertrauen beruhte, das dasjenige bei Weitem überstieg, zu dem ein zünftiger Schweizer Uhrmacher berufen sein sollte.
Die Ziffer à Grande Complication blieb die einzige originale Uhr des großen Mechanikers. Der Meistertitel wurde ihm verweigert, es kam zu Denunziationen, und es gab wohl eine Intrige mit erotischem Hintergrund. Man duldete ihn nicht länger in Genf.
Er trat danach in verschiedene Werkstätten in Italien, Deutschland, Belgien ein, kam wieder nach Deutschland, ging dann nach Frankreich und hinterließ seine spärlichen Spuren im Elsass, in Rouen und in Paris. Soweit man weiß, war er zuletzt in der Werkstätte von Léon Leroy tätig. Leroy hatte zwei Jahre vor Samuel Ziffer als einer der Ersten eine Kleinserie von sieben Automatikuhren mit Kalender angefertigt. Er dürfte Ziffer technisch beeinflusst haben, obwohl der auf Leroys spitzovale Pendelmasse, die fast das ganze Gehäuse ausfüllte, verzichtet hatte. Leroy hatte ihn der Pariser Zunft als Geselle gemeldet. Seinen Meisterbrief hatte Samuel Ziffer ja nie erhalten. Seine Spuren verlieren sich 1942 in Südfrankreich. Vielleicht war der verkannte Meister der Großen Complication nach Spanien entkommen. Vielleicht nicht.
Die Uhr, die seinen Namen trug, ging andere Wege. Bevor er Genf verließ, hatte sie ein Händler zu einem lächerlichen Preis erworben und zwei Monate später für einen bereits erstaunlichen Betrag einem einheimischen Banker verkauft, der sie seinem Schwiegersohn zur Hochzeit schenkte. Die Ehe war nicht von Dauer. Danach wechselten die Besitzer häufiger, und auch die Zahl ihrer Liebhaber wuchs. Einer ihrer berühmtesten war der Reichsjagdmeister des Großdeutschen Reichs, und für knappe zwei Jahre gab es zumindest einen Mann, der in Görings Auftrag darauf angesetzt war, die mythische erste Uhr mit Jahrtausendanzeige zu finden. Ob es ihm gelang, ist nicht gesichert. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie einfach verschwunden. Ihre Jahrtausendanzeige zeigte die Ziffern ‹1 – 9 – 4 – 2›, als der letzte Experte sie gesehen haben wollte.
Reichhausen wusste von der Existenz der Ziffer seit dem Frühsommer 1946. Jeder ihrer wahren Jäger hatte eine eigene Geschichte mit dieser Uhr, konnte genau erzählen, wie er zum ersten Mal von ihr erfahren und wann und warum er angefangen hatte, von ihr zu träumen.
Diese Jäger, eine kleine, untereinander aber tödlich zerstrittene Meute von Sammlern, teilten neben ihrer Leidenschaft für die Ziffer noch zwei Dinge: Sie waren wirkliche Kenner mit bedeutenden und komplexen Sammlungen mechanischer Armbanduhren. Und alle waren dementsprechend reich.
Miteinander sprachen sie selten, sie mieden sich, und allenfalls nach großen Messen und Auktionen, die sie viel Geld und Nerven gekostet, ihre Habgier aber zumindest zeitweilig befriedigt hatten, setzten sich ein paar von ihnen an den Tisch eines Grand Hotels, um miteinander zu trinken, ihre Feindschaft für ein paar Stunden zu vergessen und sich die alten Geschichten von der Grande Complication zu erzählen – wie man es über sagenhafte Posträuber oder Briefmarken tut.
Die Jäger der Ziffer galten als exzentrisch, denn die meisten Sammler gingen schlicht und einfach davon aus, dass die Uhr ein Bluff war und ihre Jahrtausendanzeige per Hand nachgestellt werden musste. Das behaupteten vor allem diejenigen, deren Selbstwertgefühl ihre finanziellen und investigativen Möglichkeiten übertraf.
In Wahrheit aber hätte sie jeder gerne besessen, hätte sich für den Silvesterabend 1999 auf ein schottisches Schloss, eine Suite im Waldorf Astoria oder auf eine behaglich ausgestattete Privatinsel in der Südsee zurückgezogen, um die Nacht der Großen Complication erleben zu dürfen.
Die Nacht, die den nicht existierenden Augenblick zwischen den Jahrtausenden barg, würde es zeigen. Letztlich ging es alleine um ihn. Danach würde man in die Geschichte eingehen – der Mensch, der die Ziffer à Grande Complication tätig gesehen hatte.
Alfred Niel war vor drei Wochen gestorben. Reichhausen war sein Nachlassverwalter. Der alte Niel war einer der reichsten Männer Deutschlands gewesen. Sein Vermögen hatte neben sehr viel Geld, Aktien, den Niel-Werken, die Bauteile für Großrechner lieferten, Unternehmensbeteiligungen und Immobilien, viele bewegliche Werte umfasst: Kunstgegenstände, Gemälde, Schmuck und dergleichen.
Der Assistent Reichhausens, Dr. Joachim Bechthold, hatte letzte Woche mit der Sichtung der Kataloge begonnen, die in Luxemburger Schließfächern lagerten. Auf den Seiten dieser Kataloge war der Baron auf die Ziffer gestoßen. Sie war dort verzeichnet gewesen, als ob es sich bei ihr um einen beliebigen Gegenstand gehandelt hätte – aber von der Uhr selbst fehlte jede Spur.
Der Baron war ein so erfolgreicher Nachlassverwalter geworden, weil er sich nie für bloßen Besitz interessiert hatte. Er selbst war ein Erbe gewesen und kein ganz unwichtiger. Aber was immer ihm jemals etwas bedeutet hatte, hatte er sich selbst gesucht. Das war seine Kraftquelle gewesen.
Irgendwie, durch den immer noch anwachsenden Reichtum, die Arbeit, das Trinken und die Geläufigkeit seiner sammlerischen Erfolge, hatte sie sich in den letzten zehn Jahren unmerklich erschöpft. Jetzt spürte er, wie sie sich durch die Entdeckung dieser Spur neuerlich zu spannen begann. Er fühlte seine Kräfte sich wiederherstellen und die Spannung zurückkehren, die ihn belebt hatte. Eine Rückkehr mit aller Macht, ein wahrer Frühling.
München, Passage 7.4.1999, 21:00
«Berlin, Fonsi, wirklich? Nicht schlecht. Berlin. Ich wollte immer mal nach Berlin, aber im großen Stil, erst mal einen Monat abhängen, weißt du, erst mal schauen, was läuft, verstehst du, nix Arbeit – anders friert’s mich sowieso.
Du, Fonsi, ganz andere Frage, kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun? Weißt du, eigentlich sollte ich nach Ostende fahren. Weißt du, der alte Sack ist manchmal ein bissel durcheinander, verwechselt die Sachen, verstehst, Fonsi. Is smol bisnes, ehrlich.»
Pardell verstand das vorliegende Small-Business-Problem zwar nicht, aber er sah keinen Grund, Sallinger diese Bitte abzuschlagen. Sallinger war der erste Kollege, den er kennengelernt hatte. Sallinger hatte sich nach seinem sehr zögerlichen Hereinkommen auf der Stelle um Pardell gekümmert, ihm die Reiseunterlagen und die Reservierungsliste gezeigt, ihn gefragt, wer er sei, wie er heiße. Wo er herkomme – dass er nicht aus München sei, könne man hören, ja, freilich, des hört man doch.
Pardell hatte ihm die Wahrheit erzählt. Sehr kurz. So kurz, dass sich die Wahrheit durch diese unangemessene Kürze zurückzog, wie ein edles Pferd, das, auf Äpfel hoffend, eine Koppel heruntergaloppiert, stattdessen aber ordinäres Gras angeboten bekommt und verächtlich schnaubend wieder davontrabt.
Pardell hatte erzählt, er habe das Studium aufgegeben, sei Architekt, ja, wolle zunächst noch einmal etwas anderes machen, ja genau, Berlin, sei vier Jahre in Berlin gewesen. Sei genug. Sallinger sah ihm regungslos und cool zu. Große getönte Brille in Tropfenform. Schwarzes Hemd, dessen enormer Kragen in den Siebzigerjahren entworfen worden war. Die oberen vier Knöpfe offen. Auf der blassen, leicht haarigen Brust ein Goldkettchen. Er war eigentlich gut gebaut, aber ein wenig sehr dünn. Auch seine Matte war sehr dünn.
Er stellte ein Bein auf einen Stuhl, holte ein Päckchen Marlboro, das er zwischen Hemd und Schulter befestigt hatte, und zündete sich eine Zigarette an. Seine schwarze Jeans ging über ein solides Paar schwarz-roter Cowboystiefel, die durch die Lagerung des Beins auf dem Stuhl gut zur Geltung kamen. Er nahm einen Zug von seiner Marlboro und sagte, er sei der Perry. Der Sallinger Perry. Logisch, Fonsi.
Nachdem Pardell mit seiner allzu kurzen Berliner Geschichte heraus war, erläuterte ihm Perry sein Verhältnis zur neuen und alten deutschen Hauptstadt. Dem Sallinger Perry, der nie in Berlin gewesen war, fiel erstaunlich viel dazu ein.
Pardell versuchte, während er sich weiter die erste Uniform seines Lebens anzog, so aufmerksam und interessiert auszusehen wie nur irgend möglich. Weit entfernt aber, in ungeheurem Durcheinander, doch Detail für Detail, sah er gleichzeitig, wie es gewesen war. Berlin. Fühlte den Strom der Einzelheiten seiner jüngeren Vergangenheit.
Um sie zu betreten, musste man nur in die Charlottenburger Suarezstraße gehen, das Haus mit der Nummer 71 suchen, dann auf genau den Klingelknopf drücken, neben dem sich ein im Lauf der Jahre verblichenes Schild mit dem Namen Stritkamp befand, warten, bis es summte, und durch das – im Parterre nach Katzenurin riechende, ansonsten aber recht ansehnliche – Treppenhaus in den dritten Stock gehen. Stritkamp/Pardell stand auf der mittleren von drei Türen, durch die man eine klassische Altberliner Wohnung mit drei Zimmern, einer großen Küche, einem Bad und einer schmalen Toilette betrat, die von drei Menschen bewohnt wurde.
Nominell eine sogenannte Wohngemeinschaft, in Wahrheit aber ein Pärchen, das das Geld brauchte, weil es sonst nur von Umschulungen lebte. Da das Pärchen, Holger und Hedwig Stritkamp, aber so etwas wie späte Altachtundsechziger waren, nannten sie ihre Untermieter Mitbewohner. Es brachte das gleiche Geld, war von daher also echt egal, hatte aber totale soziale Vorteile. Auf einen Mitbewohner musste man weniger Rücksicht nehmen, schließlich war man eine Gemeinschaft. So war Pardell gezwungen, dem Streit, der Ehehygiene, der Versöhnung, den Krankheiten des Paars beizuwohnen. Er ertrug es.
Weder mangelte es ihm an Intelligenz noch an Geschmack, und dennoch hatte er es jahrelang im Inneren einer stupiden Geschmacklosigkeit ausgehalten. Er hatte niemals versucht, dem Treiben von Holger, Mag. rer. pol. (Holgi), und Hedwig, Dipl. soz. päd. (Hexi), Einhalt zu gebieten. Im Zweifelsfall verließ er lieber das Haus, wenn es nicht mehr ging, und fand nichts dabei, einen möglicherweise gefassten Plan einfach so umzuändern, dass er mit der neuen Situation in Deckung zu bringen war.
Er wollte zum Beispiel duschen, aber es ging nicht, weil sich das Paar im Bad paarte. Wenn es einen Versöhnungsfick gab, dann meistens im Bad, und so eine Kompromisskopulation dauerte. Also beschloss er stattdessen, nicht erst morgen, sondern gleich schwimmen zu gehen und im Spreewaldbad zu duschen, für das er eine Dauerkarte hatte. Das hieß aber, dass es zu spät werden würde, um in der Bibliothek das Buch über Piranesi auszuleihen, das er eigentlich für ein Referat benutzen wollte. Also würde er nicht in das Seminar gehen, sondern morgen in die Bibliothek, die Aufsatzsammlung zu Piranesi ausleihen und statt des Referats lieber eine Seminararbeit schreiben.
Die Seminararbeit aber, die in Pardells neuem Plan zwei Wochen beanspruchen würde, kollidierte mit später auftretenden Ereignissen: Hexis Beschluss, die Küche in geschmackvollem Magenta zu streichen. Holgis Widerspruch. Hexis darauf folgendem spontanen Wutanfall. Und dann wollte Holgi auch noch völlig kommerzialisierten Fußball sehen, was heißt da Europameisterschaft. Holgi reagierte daraufhin mit sexueller Repression und schlief in der Küche, und zwar tat er das, aus Kummer und Wut, bis spät in den frühen Nachmittag hinein, was Pardell dazu zwang, den Frühstückskaffee außer Haus zu sich zu nehmen.
Hexi hatte die Umschulung geschmissen, und Pardell hatte die Seminararbeit nicht geschrieben – hatte, als zum Beispiel die Aktion mit der Küche ihren Anfang genommen hatte, den Rückzug angetreten und seine Pläne geändert, das Referat und alles Weitere abgesagt, sich stattdessen für Extra-Stadtführungen gemeldet, um mit dem Mehrverdienst im Sommer zügig eine ausführliche Seminararbeit in Vorbereitung für das nächste Semester zu ermöglichen, die als Grundlage einer Diplomarbeit fungieren und ihm also sogar noch den Vorteil bringen würde, sein Studium schneller abzuschließen.
Das Thema sollte Der Fluchtweg. Theorie und Praxis einer Bauvorschrift der Neuzeit und ihre Spuren im Werk Piranesis lauten. Pardell hatte sie, als er sich Sallinger gegenüber als ‹Architekt› vorstellte, noch nicht beendet. Zweifellos waren die verstreuten Fragmente, die er unabhängig von ihrer späteren Position in dieser Arbeit auf einer Fülle von Blättern und in Word-Dokumenten versammelt hatte, noch nicht einmal ein Entwurf zu nennen, zumindest nicht ein Entwurf einer Abschlussarbeit …
Der Sallinger Perry fragte ihn etwas Einfaches, nämlich, ob er das Pinguin kenne, in Schöneberg, Pardell war sich nicht sicher, aber das klinge ja sehr nett. Damit kam Sallinger auf den Punkt zurück. Den Gefallen.
«Also, Fonsi, das ist total nett von dir. Nein, jetzt echt. Gehst du schnell mit, zur Fetten Fanny rüber, dann geb ich dir das? Ja, nimm deine Sachen mit, dann kannst gleich auf den Zug, nachher.»
Pardell folgte Sallinger, der schon aus der Sektionstür getreten war. Er hielt sie mit seiner Schulter offen, nahm eine Marlboro und sein original ZIPPO-Feuerzeug. Pardell hörte das schnappende Geräusch. Sallinger zischte auf.
«Hast du dir wehgetan?», fragte Pardell.
«Na, nix. Fonsi. Scheiße, los jetzt, geben wir Gas», sagte der Hillbilly düster.
Sie gingen die Stufen zur Bayerstraße hinunter, überquerten sie nahe der Haltestelle der Trambahn und schwenkten in eine Seitenstraße, belebt von zögerlichen Besuchern grell leuchtender Pornokinos und Bewohnern dunkler Pensionen und Hotels. Durchzogen von Imbissen und Import-Export-Geschäften, deren Schaufenster so mit Schachteln vollgestellt waren, als wären sie Rückseiten von Lagerräumen. Sallinger wechselte auf die rechte Seite und würdigte Pardell dabei keines Blicks. Er nahm wohl an, Pardell wüsste, was die Fette Fanny sei und wo sie sich befinde.
Eine erste ferne Ahnung aufkommender neuer Rhythmen, neuer Anforderungen gab ihm ein, dieses Missverständnis nicht aufzuklären, sondern Sallinger einfach zu folgen, dessen Cowboystiefel auf dem Asphalt klirrende Geräusche von sich gaben.
Die aus Polyester geschnittene, nachtblaue Uniform hatte Pardell anverwandelt. Und so behandelte man ihn: als Insider.
Unmittelbar vor ihm hatte die Uniform einen Südtiroler gekleidet, der, nachdem er durch die Schaffnerei die Schulden seines desaströs geendeten italienischen Restaurants in Rosenheim abbezahlt hatte, nach Padua gegangen war, um dort ein deutsches Restaurant zu eröffnen. Vor dem Südtiroler hatte die Uniform einem Studenten der Biochemie gehört, der bis zum unerwarteten Tod eines alleinstehenden Onkels Aushilfsschaffner gewesen war. Davor einem früh pensionierten Schichtarbeiter der BMW-Werke, der unter Schlaflosigkeit gelitten hatte und durch den Zwang, während des Schaffnerdienstes auf keinen Fall einschlafen zu dürfen, geheilt worden war.
Es hatte davor wieder andere gegeben, eine unübersichtliche Reihe von Männern, die eines verband – sie alle waren etwa eins achtzig groß, relativ schlank und alles in allem ordentlich proportioniert. Manchen hatte die Beinlänge gut gepasst, manchen waren die Ärmel zu lang oder zu kurz gewesen, manchen die Schultern zu schmal, oder sie selbst waren ein wenig zu fett für die Hose gewesen – Pardell allerdings passte sie in jedem Detail, ja, man kann sagen, dass die Uniform, obwohl sie sozusagen schon unzählige Male bei der Fetten Fanny gewesen war, noch nie eine so gute Figur gemacht hatte.
Pardell war Sallinger gefolgt, als hätte er das Lokal schon unzählige Male betreten und hätte sich schon unzählige Male einen Platz an der feuchten Theke gesucht. Sallinger bestellte zwei Bier, gab Pardell zu verstehen, er solle kurz warten, ging nach hinten, wo ein paar andere Schaffner saßen, die meisten nur im Hemd, mit dunkelblauen Krawatten.
Sallinger beugte sich über den Tisch, zeigte mit dem Kopf auf Pardell, erklärte etwas, es dauerte eine Weile, drei oder vier Minuten, schließlich gab einer der Schaffner, ein älterer, rothaarig gelockter Mann, Sallinger einen Umschlag. Sallinger kam zurück.
«Du, Fonsi, jetzt pass auf, ja trinken wir erst mal, hmm, da schau her, das ist ein Umschlag, und den hätte ich in Ostende jemandem geben müssen. Der hat Geburtstag, verstehst du, morgen, das ist ein Geburtstagsgruß, ganz privat, verstehst schon. Wenn du da bist, dann gehst in die Sektion, musst halt fragen, die findest du schon, und gibst den Umschlag an jemand, Luk Pepping heißt der Kollege. Mit der Post schicken, das friert mich, verstehst. Super, Fonsi, dann geh ich schnell noch mal rüber da, gute Fahrt, lass krachen!»
Pardell stand mit einem sinnlos erhobenen Bierglas in der linken und dem Umschlag in der rechten Hand da. Alleine. Sallinger und die anderen Schaffner waren nach hinten gegangen und nicht mehr zu sehen.
Resignierend steckte er den Umschlag in die Innentasche des Sakkos und versuchte, das Bier so schnell wie möglich zu trinken. Er stand zwischen orangefarbenen Gleiswärtern und düsteren alten Bundesbahnschaffnern, die nur noch in Regional- und Pendlerzügen Dienst tun durften und sich schmerzlich an die Zeiten ihrer größten Macht und Ehre erinnerten, damals, als die Reisenden keine Kunden gewesen waren, sondern gekuscht hatten. Er sah die Zeitungsverkäufer, die fröhlichen Postangestellten, die dunkelhäutigen Reinigungskräfte … all die also, die sich in der Fluoreszenz der großen Bahnhöfe finden und von denen man als normaler Reisender fast nichts wahrnimmt.
Die Bedienung, eine schwarzhaarige Frau, jünger als er, mit unabsichtlichen hübschen Strähnchen auf einer leicht verschwitzten Stirn und slawischem Akzent, bestand leider darauf, dass er beide Biere bezahlte. Nein, Anschreiben gäb’s hier nicht. Wer soll das sein? Der Sallinger Perry? Nie gehört.
Pardell wurde rot, gab ihr einen der letzten größeren Geldscheine, die er besaß, einen Fünfziger. Er gab zwei Mark zwanzig Trinkgeld und sah ein überraschtes, relativ charmantes Lächeln. Er lächelte zurück.
Dann verließ er sehr eilig die Fette Fanny, warf einen knappen Blick auf den Eingang eines Pornokinos schräg gegenüber. Weit am Ende der Straße: die dunkle Seite des Bahnhofs.
Im späten Herbst 1998 hatte sich Pardell entschieden, Berlin zu verlassen. Zusammentreffende Umstände hatten ihn dazu bewogen: eine Phase intensiven Streits zwischen Hexi und Holgi. Ein tiefer Zweifel an der absoluten Bedeutung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Die Erschütterung durch das banale Ende seiner Liebesbeziehung, banal vor allem, weil Pardell und seine Freundin Sarah beide natürlich von etwas Nichtbanalem geträumt hatten und sich mehr oder weniger aus sympathisierender Langeweile heraus trennten, um endlich wieder etwas Lebendiges miteinander zu erleben.
Schließlich und in der Hauptsache ein über den kleinen Fernseher im Büro seiner Chefin flimmerndes Amateurvideo, aufgenommen am 27. August. Auf dem Video sah man den Innenraum eines Sightseeingbusses von Berlin Touristik Beilbinder, in dem ein Haufen entsetzter Japaner, Amerikaner und Neuseeländer tobte. Man sah vergeblich gegen unerbittliches Glas anhämmernde Fäuste, Gliedmaßen – und mitten in diesem Inferno das zwar nur für Sekunden zu sehende, allerdings überaus amüsierte Gesicht Leonard Pardells. Er war der Fremdenführer gewesen, und nach diesem Vorfall legte Frau Beilbinder keinen Wert mehr auf seine Mitarbeit.
In der FAZ hatte er danach nach Ausschreibungen gesucht und irgendwann die Anzeige einer innovativen Organisation entdeckt, die internationale Praktikumsplätze in Verbindung mit erstklassigen Sprach- und Computerkursen anbot.
Es wurden verschiedene Kombinationen angeboten: Englisch in Kalkutta, Französisch in Ruanda, Russisch in Russland, Spanisch in Argentinien. Er wusste, was er wollte, und leitete am nächsten Morgen alles in die Wege. Die Frau am Telefon hatte eine unglaublich schöne Stimme. Er beantragte zwei Urlaubssemester, überwies die fälligen 5730 Mark an Kursgebühren, in denen der Flug von Madrid nach Buenos Aires enthalten war, besorgte sich frühzeitig einen günstigen Flug nach Madrid, von München aus. Er begann, die Tage zu zählen. Ordnete seine Unterlagen, seine Arbeit über den Fluchtweg. Verschenkte seine wenigen Möbel, lagerte seine Bücher bei Bekannten in Potsdam ein, kaufte sich zwei erstklassige anthrazitfarbene Hartschalenkoffer, fuhr schließlich Mitte März mit dem Zug nach München, traf sich mit einer alten Freundin im Bahnhofsrestaurant, nahm eine S-Bahn zum Franz-Josef-Strauß-Flughafen, gab sein Gepäck auf, erhob sich gegen 10 Uhr in einer Lufthansamaschine Richtung Madrid, kam um 12 Uhr 30 dort an, suchte ohne Eile das Gate, denn die Maschine nach Buenos Aires würde erst in drei Stunden gehen. Er las hochvergnügt in einer spanischen Anfängergrammatik, erhob sich eine Stunde vor Abflug, ging zum Schalter 23 und reichte der lächelnden Dame das Ticket. Auf dem Ticket war vermerkt, dass es sich um einen speziellen Charterflug handele, der von Air Iberia abgefertigt würde. Die wunderschöne Dame von Air Iberia lächelte, begrüßte ihn englisch (mit heiserer Intonation), nahm das Ticket, lächelte dann schwächer, telefonierte auf Spanisch und wandte sich sorgenvoll an ihn.
Er sei schon der Zehnte heute, alle aus Deutschland und Österreich. Der Flug existiere nicht. Nicht einmal die Chartergesellschaft gebe es, nein, keine Telefonnummern, es tue ihr schrecklich leid. So sorry. Pardell rief, um das Missverständnis zu klären, in Frankfurt an, um zu erfahren, dass die gewählte Nummer nicht mehr bestand, setzte sich fassungslos auf die orange Bank und war sich sehr schnell über das Ausmaß der Katastrophe im Klaren.
Er beschloss, sich sofort um sein Gepäck zu kümmern. Es war von der Lufthansa tatsächlich durchgestellt worden und befand sich gerade irgendwo zwischen Lissabon und Miami, Fl. Er hatte Glück, dass er sein Ticket nach München mit geringem Aufschlag umbuchen konnte, flog gegen 19 Uhr zurück und kam gegen 23 Uhr mit der S-Bahn am Münchener Hauptbahnhof an – nachdem er am Flughafen Anzeige erstattet hatte, zum Zoll und zur Gepäckrecherche der Lufthansa gelaufen war.
Er verfügte über knappe 800 Mark Bargeld, hatte auf seinem Sparkassenkonto noch einmal an die 500 Mark. Er nahm sich ein Zimmer in einer Pension in der Bayerstraße. Setzte sich aufs Bett. Dusche gab es keine. Er zog sich nicht aus und überlegte, was er tun sollte. Er hatte keine Ahnung.
München – Starnberg 7.4.1999, 21:20
«Wenn Sie jetzt noch einmal was aus dem Fenster schmeißen, dann ruf ich auf der Stelle über Funk die Autobahnpolizei.»
«Sie sind ein Arschloch. Wenn Sie nicht aufpassen, dann schmeiß ich Ihnen die nächste Flasche in die Scheißscheibe vorne rein.»
«Ein Wort noch, jetzt, und Sie steigen am nächsten Parkplatz aus. Glauben Sie bloß nicht, dass ich mich herablasse, Sie zu beleidigen», sagte der Taxifahrer und sah im Rückspiegel, wie sich sein widerlicher Fahrgast amüsiert über die Glatze fuhr. Erstaunlicherweise schwieg er tatsächlich.
Reichhausen hatte es eilig, unter anderen Umständen hätte er sich weiter mit dem Taxifahrer unterhalten und wäre vielleicht sogar zum Spaß ausgestiegen. Aber er musste zusehen, so schnell es ging, nach Starnberg zu kommen.
Er hatte vor zwanzig Minuten das Haus verlassen, sich am nahe gelegenen Taxistand einen Wagen besorgt und vergessen, etwas zu trinken mitzunehmen. Kaum war er im Taxi gesessen, hatte er das bedauert. Also hatte er den Taxifahrer aufgefordert, an einer Tankstelle zu halten, sich fünf Flachmänner Wodka besorgt, die er nacheinander ausgetrunken und danach aus dem Fenster geworfen hatte. Der kalte Fahrtwind und die wegtrudelnden Flaschen hatten ihm gefallen.
In Starnberg wohnte William Fischbein, Direktor der Münchener Privat Securität, die den ganzen Besitz des alten Niel versichert hatte. Fischbein musste informiert werden, bevor das Fehlen der Ziffer aktenkundig würde.
Reichhausen würde ihn schlicht auf den materiellen Wert des Gegenstands hinweisen und die Konsequenzen, die sein Verlust, sein Diebstahl oder seine Unterschlagung haben würden. Den wirklichen Wert der Ziffer konnte nur ein Sammler begreifen, vielleicht unter diesen niemand besser als er. Er war sehr aufgeregt, zugleich todmüde, angetrunken und dachte mit zärtlicher Habgier an die Große Complication.
Complicationen erregten den Würger. Vieles musste schon ein einfaches Uhrwerk leisten: Genauigkeit, Schlichtheit und Harmonie des Zifferblattes, Präzision der primären Mechanik, Verlässlichkeit, Unempfindlichkeit, möglichst hohe Gangdauer.
Complicationen hinzuzufügen war in jeder Hinsicht das Schwierigste, denn sie mussten vom Uhrmacher nicht nur gemeistert, sondern auch durch die Exquisitheit der grundlegenden Mechanik angelegt und begründet werden. Der Meister musste seiner Aufgabe nicht nur gewachsen gewesen sein – sonst blieb die Uhr Gesellenarbeitauf hohem Niveau.
Im Idealfall ergab sich die Complication aus der grundlegenden Mechanik selbst – ein wirkliches Meisterstück entwickelte von der Anlage der Werkplatte, von der Mischung der Materialien, der Konstruktion der Unruh und der Hemmung an eine Logik, deren Vollendung die Complication war. Mit ihrer Hilfe musste man den inneren Sinn der Mechanik verstehen können. Die Lösung einer Complication musste so vollendet und schlicht sein, dass sie sich auch dem enthusiastischen Laien erklärte – die Mechanik großer Uhren musste man in jeder Richtung lesen können. Und deswegen war die Ziffer à Grande Complication 1924 ein wahres Meisterwerk – die separate, komplizierte Mechanik der Jahrtausendanzeige etwa führte einen spielend, wenn man sie ins Innere der Uhr verfolgte, die Wege der Kraft und der Hemmung zurückging, weiter zum Anker, zum Spindelrad und dann bis zur Feder und ihrer Fixierung – zur Kraftquelle. Die Complication und das Grundlegende waren auf einzigartige Weise aufeinander bezogen.
Das Ganze war Schönheit, Einfachheit, Komplexität auf engstem Raum, ein kleines mechanisches Universum, das in der Lage war, sehr lange Zeit für sich zu bleiben, in der Dunkelheit des Gehäuses, durch das nur das Klicken der Hemmung, das Sirren der Unruh, die ganze vielstimmige Musik der Mechanik drang. Mechanik: die kontrollierte, harmonische Verteilung von Kraft über einen genau bestimmten Zeitraum hinweg.
«Da steht kein Name und keine Hausnummer dran, ist das das Haus, wo Sie hinwollten? Hallo?», schrie der Taxifahrer. Sein athletischer rotköpfiger Fahrgast war vor zehn Minuten während der Fahrt eingenickt, eine zarte Speichelspur lief ihm aus dem linken Mundwinkel. Beim letzten Ruf war er schnaufend aufgewacht. Der Taxifahrer sah im Rückspiegel, wie er hochschreckte, sich mit der linken Hand den Schweißfilm von der Glatze wischte und auf der Stelle wieder erschreckend wach zu sein schien. Er knurrte Zustimmung, holte seine Brieftasche aus hellbraunem, wunderbar geschmeidigen Leder hervor, gab ihm zwei große Scheine und stieg aus, ohne auf das Wechselgeld zu warten.
In Starnberg war es kühler als in München. Auch hier hatte es geregnet, und alles strahlte von köstlicher, vom nahen See durchfrischter Luft. Das Knirschen auf dem Kies der Einfahrt gefiel ihm, er atmete tief durch, nahm sich das Taschentuch und wischte sich noch einmal das Gesicht. Nur im oberen Stockwerk des Hauses, wo Fischbeins Schlafzimmer lag, sah Reichhausen Licht. Während er das Taschentuch mit der fünfzackigen Krone über dem Monogramm zurückfaltete und sich in die Tasche steckte, blickte er zu dem Fenster hinauf. Er würde ihn wahrscheinlich im Pyjama erwischen. Wenn schon.
Er sah auf das Licht hinter dem Fenster, hörte schwachen Wind in den Tannen links von ihm. Eine Straße weiter fuhr ein Auto vorbei und spritzte eine Pfütze auf. Er war draußen. Die Welt um ihn herum. Für einen Moment war sein Körper in Ruhe und fühlte dabei deutlich die Position seines stark schlagenden Herzens im Raum. Dann zog es ihn hinein.
München – Ostende 7.4.1999, 21:30
Licht hatte die Türen der Sektion der Wagons-Lits aufgebrochen, man hörte ein schepperndes Surren, der Magaziner fuhr den Elektrokarren heraus, der vorne zwei Plätze bot und einen Anhänger doppelter Größe zog. Pardell erreichte gerade die Treppen und blickte nach oben – der Magaziner krähte, sein Körper wand sich wie ein nervöser, dürrer Käfer im Gestänge des Wagens, Pardell nahm die Treppen, so schnell er konnte, und setzte sich schüchtern neben den Magaziner.
«Sag mal, was ist mit euch los? Ihr Schaffner seid’s doch ein einziger Haufen von Pennern. Bei der Fetten Fanny abhängen, des könnt’s ihr. Aber des war’s auch, des musst dir merken!»
Der Magaziner startete den E-Karren, es ruckelte, es knirschte, der Anhänger leistete Widerstand. Der Zug nach Ostende ging von Gleis 17, sie fuhren also Gleis 11 hinunter, zurück in die Haupthalle des Bahnhofs.
Der Magaziner setzte Pardell davon in Kenntnis, dass der Wagen nahezu vollständig beladen werden müsse, es sei fast alles abverkauft worden. Er ächzte vor Trunkenheit, konnte sich kaum auf dem Sitz halten, fuhr Schlangenlinien, hupte Reisende an, die vor dem Elektrokarren und seinem spindeldürren Lenker davonspritzten wie Geflügel vor dem Schlachterburschen – schon auf der Geraden zu Gleis 17 zerquetschte er einem kleinen Hund um ein Haar die linke Pfote. Währenddessen beschimpfte er Pardell, der es klugerweise nicht persönlich nahm. Der Magaziner hasste die Schaffner allgemein. Weil sie seine Sachen über ganz Europa verstreuten, weil sie nachlässig und willfährig waren, weil sie Porzellan lieber aus dem Fenster schmissen, kurz vor Venedig, Port Bou, Amsterdam, als es abzuspülen. Weil sie Arschlecha waren! Auf seiner Ausbildungsfahrt hatte Pardell seinen Ausbilder Hoppmann sagen hören, dass der Magaziner im Magazin wohne, dass er die Nächte über zähle, nach Fehlern suche, dass er jede Abrechnung zehnmal danach prüfe, ob der Schaffner irgendwo einen Fehler gemacht hätte. Möglicherweise, dachte Pardell jetzt, war das keine völlige Übertreibung gewesen.
Schimpfend wuchtete der Magaziner die hölzernen Getränkekisten auf den Plafond des Schlafwagens mit der Ordnungsnummer 287, der am Ende des Zuges, gerade noch unter der Überdachung, stand. Nahm die Schmutzwäschesäcke entgegen, reichte ihm die Säcke mit der frischen Wäsche. Pardell wusste, dass er jeden Gegenstand vorschriftsgemäß in die Abrechnung einzutragen und in die Fächer und Schubladen einzuräumen hatte. Er musste zugleich kontrollieren, ob der Magaziner richtig gezählt und ob der Schaffner vor ihm, der heute Morgen mit diesem Wagen angekommen war, keinen Fehler gemacht hatte – ob der Wagen durch den Fehler irgendeines der Beteiligten Fehl- oder Überbestände aufwies. Er würde sehr viel zu zählen haben. Am Ende reichte ihm der Magaziner die Holzkiste, nahm einen tiefen Schluck Asbach und fuhr schimpfend mit der Schmutzwäsche und den leeren Bier-, Wasser- und Weinflaschen in die Sektion zurück.
Zurück auf dem Bahnsteig, sah Pardell dem schlingernd davonfahrenden Magaziner nach, der zunächst auf eine Gruppe von Geschäftsreisenden zugerast war, sie aber knapp verfehlte, um dafür einen Papierkorb zu streifen und leicht einzudrücken. Ein angenehmes Bild. Angenehm, ihn verschwinden zu sehen. Pardell realisierte, dass er alleine arbeiten würde. Bei diesem Gedanken seufzte er lächelnd. Wenigstens allein.
Er spürte die Strahlungen seines Ziels, Ostende, und die 708 Kilometer Luftlinie, die ihn von ihm trennten, die wimmelnde Menge von Dingen, die er würde zählen und in seine Abrechnung eintragen müssen: Bettlaken blau, Betttücher groß, Kopfkissenbezüge blau/klein, Badetücher, Perrier klein, Apollinaris klein, Messer, Kuchengabeln …
Er spürte die Kolonnen von Ziffern, die auf Wagen, Dienstpapieren, Reservierungen und all den anderen Dokumenten darauf warteten, von ihm abgeschrieben und übertragen zu werden: Er sah die vorgedruckten Kästchen und dünnen Spalten, in die er die Bestände würde einzureihen und zu bestätigen haben. Hoppmann hatte es ihm genau gezeigt. Und Pardell hatte das System einer fortlaufenden, gegenseitigen Kontrolle der Schaffner, des Magazins und der Fahrleitung durchaus schnell begriffen. All die Papiere, Dokumente, Ankunftszeiten, Ziffernfolgen, Vorratskammern und Lieferscheine, all die Wäschezettel und Abrechnungsvordrucke bildeten ein Gebäude. Er hatte den Lageplan einigermaßen im Kopf – aber niemandhatte ihm erklärt, was oder wer ihn im Inneren dieses Gebäudes erwarten würde. Er spürte die Ferne und die Nacht, in die das Gleis ihn führen würde. Er ahnte die Räume und die Stimmen, die sie belebten. War es ihm schaurig? Ja.
Fünfzehn Minuten bis zur Abfahrt. Er sah sich die Reservierungsliste durch. Es gab eine Reservierung in München, ein Double Herr. In Köln würden drei Tourist Herr zusteigen. Zwischen München und Köln würde er also zählen können. Seine Aufregung legte sich etwas. Am fernen Anfang des Bahnsteigs sah er die Reisenden den Zug bevölkern, sah ihre vielfältigen Rhythmen. Sah die Aufgeregten, die abendlich erschöpften Pendler, für die der Zug nur eine Verlängerung der U-Bahn war.
Der Double-Reisende kam fünf Minuten vor Abfahrt, sehr gelassen, die Papiere holte er auf geläufige Weise aus der Innentasche seines Trenchcoats, ein freundlicher, müder Blick, ein Nicken, und er betrat den Wagen. Pardell folgte ihm über den Flur, die Tür von Abteil 22 hatte er vorhin geöffnet, sie erwartete den Gast beleuchtet. Er bestellte für den nächsten Morgen einen Kaffee.
«Sono solo. Bin alleine?», waren seine letzten, freundlichen Worte. Die Papiere, eingelegt in den italienischen Reisepass, hatte er um einen Zwanzigmarkschein ergänzt – für den Fall, dass während der Fahrt ein männlicher Reisender ein Double beziehen wollte. Pardell begriff den Schein umstandslos, betrachtete ihn erfreut, nahm ihn aber erst im Office an sich. Es handelte sich um vorausbezahltes Trinkgeld, was bedeutete, dass er die Leistung dafür erst noch erbringen sollte. Es war Bestechung. Der Vorschrift nach musste ein Schaffner immer zuerst ein bereits angebrochenes Abteil mit Reisenden entsprechender Kategorie auffüllen. Wenn etwa heute Nacht in Aachen, das der Zug in fünf Stunden erreicht haben würde, ein wohlhabender Zecher die Notwendigkeit verspüren sollte, sein Frühstück mit Blick auf den stumpfsinnig-vernebelten Ozean Ostendes einzunehmen, und, schwer schwankend und streng riechend, bei Pardell auftauchen und nach einem Double, also einem Bett in einem Zweibettabteil, verlangen sollte, so hättePardell ihn dort einzuquartieren, wo der Italiener schon lange schlief. Wenn man sich kein Single leisten konnte, nahm man eben ein Double und versuchte, den Schaffner zu bestechen. Für den Schaffner war dies in jedem Fall günstiger als für die Compagnie. Weshalb es strengstens verboten war.
Pardell hatte sich schnell entschlossen, den Schein trotzdem zu nehmen. Diese Entscheidung beförderte sein Zutrauen.
Er trug den Reisenden in die Wagenpapiere ein, wie ihm das von Hoppmann vorgeführt worden war («So, schau her, dann nehm ich also die Reservierung. So, wo ist denn die Nummer, hier, aha, und dann schreib ich die Nummer hier, schau her, ja, hier genau, hinein. Das wirst schon noch lernen, das sieht jetzt viel schlimmer aus, als es is, gell, ja …»).
Der Zug war inzwischen auf dem Weg nach Augsburg. Unschlüssigkeit, was als Erstes zu tun sei einerseits, Erschöpfung nach der sich legenden Nervosität andererseits und der Wunsch, sich zu setzen und eine Flasche Personalbier zu öffnen, stritten miteinander. Die Bundesbahnschaffnerin kam gehetzt vorbei, Pardell reichte der resoluten jungen Frau den Fahrschein des Italieners, sie stempelte ihn und verschwand wieder. Pardell nahm eine Flasche aus dem Träger, blickte über die vielen anderen, die er zählend in die Kühlschränke würde zu legen haben. Später. Ein wenig später. Er dachte wieder an den Abend, an dem die transatlantische Illusion zerplatzt war.
Als er sich auf das Bett des Pensionszimmers gesetzt hatte, war ihm der Schwindel aufgefallen, den die Außenwelt überkommen hatte. Die Gegenstände, die ihn umgaben, der Spiegel, die Kommode, die Tür, das Fenster der gemauerten Hinterhofnacht, die Ereignisse, die unmittelbar zurücklagen, der Flug zurück nach München, aber auch die Dinge und Menschen, die er ursprünglich hatte verlassen wollen, umschwebten ihn auf verschiedenen Umlaufbahnen, nahe und ferne Trümmer aus einer Kollision ungleicher Himmelskörper.
Es gelang ihm zu seiner eigenen Verblüffung, die Tränen zurückzuhalten. Er ahnte, irgendwo gab es eine Ahnung, dass er außer Juliane, die er zur Not immer noch anrufen konnte, noch irgendjemanden in München … jemand, der auch noch in München … ach so, klar. Salat.
Rudolph Salat. Salat wohnte ja auch schon eine ganze Weile in München. Er nahm das Telefon. Die Auskunft hatte nie von ihm gehört. Also hatte er erst am nächsten Morgen, nach einer schrecklichen Nacht, Salats Mutter in Celle angerufen.
«Ja, ruf du ihn an, vielleicht kannst du Rudi überzeugen», waren die letzten Worte am Ende eines zwanzigminütigen Gesprächs, zu dem Pardell bis auf die ersten Sätze fast nichts beigesteuert hatte.
Wovon Rudi nach Meinung seiner Mutter zu überzeugen wäre, verschwieg sie Pardell. In seiner Vorstellung verband sich mit der Anwesenheit des Schulfreundes in der fremden Stadt München ein Versprechen. Eine Nummer, die man im sicheren Bewusstsein wählen konnte, die Stimme des Abhebenden zu kennen, war ein unsichtbarer Anker im Schlimmen und Unbekannten. Eine Ziffernfolge der Hoffnung und der Zuversicht.
Pardell erklärte Salat, der schon beim ersten Versuch den Hörer abgenommen hatte, er sei in München, er sei in großer Not, suche eine Wohnung, ein Zimmer, es sei dringend. Salat dachte kurz nach, dann wurde er lebhaft und sprach von einem immens großen Zufall – denn zufällig sei der Mitbewohner seiner WG gerade ausgezogen, und das Zimmer sei frei, Pardell könne auf der Stelle einziehen, wenn er wolle, er, Salat, jedenfalls würde sich außerordentlich freuen. Ja, natürlich, das Zimmer sei möbliert, vollständig. Salat klang richtig begeistert.
Pardell nahm sehr erleichtert sein Handgepäck, bezahlte das Zimmer und eine erstaunliche Telefonrechnung, rief von einer öffentlichen Zelle aus noch einmal vergeblich bei der Gepäckrecherche an und machte sich auf den Weg zu seinem alten, nun, Freund wäre das falsche Wort, Bekannter träfe es auch nicht. Machte sich auf den Weg zu Salat.
Die Wohnung befand sich in einem alten Haus in der Nähe des Kolumbusplatzes, gegenüber der Bahnlinie, die München in Richtung Süden verlässt. Sie erstreckte sich hauptsächlich durch das Rückgebäude, nur das kleine Fenster der Küche ging nach vorne, ließ sich aber bloß einen Spalt öffnen, durch den das erhabene Geräusch der vorüberfahrenden Züge gedämpft hereindrang.
Die Wohnung war winzig, hatte aber einen dünnen, ewig lang gestreckten Flur, vollgestellt mit fünfzehn Zentimeter tiefen Regalen, aus denen die in ihnen abgestellten Dinge, Schuhe, alte Fitnessgeräte, Campingsachen und Zeitschriften unschön herausragten.
Es roch nach den faulenden Blättermassen ewiger Herbste, nach den fantastischen Suppen Eurasiens, nach getrockneten Innereien unbekannter Haustierrassen und geheimnisvollen Kräutern. An manchen Stellen war es schaurig, an anderen herrschte die ungesunde Wärme irregulär verlegter Rohrsysteme von gigantischen Ausmaßen und offensichtlichen Überdruckverhältnissen. Gegen Ende wurden die eher allgemeinen von den eindeutig privaten Gerüchen abgelöst, dort ging man an imaginären Wäschekörben vorüber, angefüllt mit der Baumwolle von Menschen, die schweißtreibenden Tätigkeiten nachgegangen waren.
Wer war Rudolph Salat? Nach zweimaligem Durchfallen war Rudolph Salat so nahe an Pardells Jahrgang herangerückt, dass zwischen beiden eine schulkameradschaftliche Beziehung entstehen konnte. Er erfasste mit Lichtgeschwindigkeit die Verhältnisse und ließ keine Gelegenheit aus, an Ort und Stelle eine gute Zeit zu verbringen. Pardell war ihm ein paarmal trampend und campend auf Expeditionen in niedersächsische Provinzstädte wie Braunschweig, Uelzen und Fallingbostel gefolgt, die nachmittags begannen, um zwei Tage später unter widrigen Umständen zu enden, und auf denen es um magische Lifts, schnorrbare Zigaretten und die Suche nach spendablen Fremden ging.
Seit zwei Jahren lebte Salat in München, studierte irgendwas. Eigentlich gut aussehend, mit leicht rötlich blondem Haar, allerdings auf dem Weg zu einer gewissen Schwammigkeit, besonders der Wangen, die sich inzwischen deutlich neben den edlen Furchen der Nase erhoben. Er hatte immer schon Anzüge, Hemden und Krawatten getragen, jetzt lag allerdings ein depravierter Zug, ein Hauch ernst gemeinter Dekadenz über ihm.
Pardell hatte die Wohnung am südlichen Ende des Flurs betreten, Salat im fahlen Glühbirnenlicht die Hand geschüttelt. Der fragte sofort, ob er eine Zigarette hätte, sie wären ihm gerade ausgegangen, und zündete sie sich noch auf dem Flur an.
Danach hatten sie das fragliche, sogar sehr möblierte Zimmer besichtigt, Pardell hatte eingewilligt und sein Handgepäck mit unglaublicher Erleichterung in den säuerlichen Duft gestellt. Danach gab er dem grinsenden Salat, der «grade nichts da» hatte, einen Fünfzigmarkschein, worauf dieser wenig später mit sieben Schachteln Gauloises Blondes und drei Flaschen furchterregenden Rotweins zurückkam. Sie sprachen Belangloses. Pardell wollte nicht von seinen Erlebnissen und seinem Scheitern erzählen.
Gegen 21 Uhr gab Pardell Salat noch einmal fünfzig Mark «für Nachschub schnell», rang während Salats Abwesenheit mit Übelkeit, nickte auf der schlauchartigen Toilette ein, erwachte drei Stunden später, schleppte sich durch die menschenleere Wohnung in sein Zimmer, schlief in seinen Kleidern ein und bemerkte nicht, wie sich der völlig besoffen zurückgekehrte Salat gegen 7 Uhr harsch eines Großteils der Bettdecke bemächtigte und es sich in der pardellschen Wärme gemütlich machte.