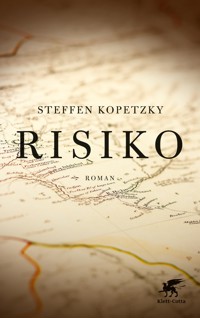10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Moskau, 1923. Larissa Reissner hat als sowjetische Gesandte in Kabul strategische Pläne entdeckt, die das Britische Empire stürzen könnten. In der flirrenden Hauptstadt, wo man die Welt neu denkt und aus den Angeln heben will, sucht sie nach dem Verfasser, einem Deutschen namens Niedermayer. Denn der Sieg der Freiheit ist Reissners Lebenssinn, die junge Schriftstellerin und Revolutionärin wird als Wundertochter ihrer Epoche gefeiert. Aus illustrer Familie, lernte sie schon als Kind Lenin kennen, sie kämpfte als Politkommissarin der Wolgaflottille; Pasternak und Trotzki bewundern sie. Von Moskau bricht Reissner auf nach Berlin – zu ihrer größten Mission: Sie soll ein geheimes Bündnis zwischen der Sowjetunion und dem deutschen Militär vermitteln, verkörpert durch General Tuchatschewski, den «roten Napoleon», und jenen schillernden Ritter von Niedermayer. Doch Larissa verfolgt ihre eigenen Ziele. Zwischen ihr und den beiden Männern entspinnt sich ein Beziehungsgeflecht, das enorme Sprengkraft hat – in amouröser wie politischer Hinsicht. Ein außergewöhnlicher Roman, in dem Ho Chi Minh ebenso zu Wort kommt wie die Lordsiegelbewahrer des britischen Weltreichs oder die Dichterfürstin Anna Achmatowa – Steffen Kopetzky fängt das Leben der Larissa Reissner ein, die nichts weniger als die Welt verändern wollte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Steffen Kopetzky
Damenopfer
Roman
Über dieses Buch
Moskau, Februar 1926. Am Sarg der jungen Larissa Reissner versammeln sich Generäle und Matrosen, Dichterinnen und Minister, Ehemann und Liebhaber. Das literarische und politische Moskau trauert um die Wundertochter ihrer Epoche. Schon als Kind lernte Larissa Karl Liebknecht kennen, später schreibt der große Gorki für ihre Antikriegszeitschrift. Mit Mitte zwanzig ist sie an der Oktoberrevolution beteiligt, Pasternak und Trotzki bewundern sie. Dann, als Botschafterin in Kabul, stößt Reissner auf Pläne eines rätselhaften Deutschen namens Niedermayer, mit denen man die Dominanz des Britischen Empire brechen könnte. Also macht Larissa Reissner sich auf nach Berlin – zu ihrer größten Mission: Sie soll ein geheimes Bündnis zwischen Deutschland und der Sowjetunion, verkörpert durch General Tuchatschewski, den «roten Napoleon», vermitteln. Doch Larissa verfolgt längst eigene Ziele. Zwischen ihr, Tuchatschewski und jenem Oskar von Niedermayer entspinnt sich ein Beziehungsgeflecht, das enorme Sprengkraft hat – in amouröser wie politischer Hinsicht.
«Historisch genau und doch so atemberaubend, wie es nur Fiktion sein kann.» Dmitry Glukhovsky
Vita
Steffen Kopetzky, geboren 1971, ist Autor von Romanen, Erzählungen, Hörspielen und Theaterstücken. Sein Roman «Monschau» (2021) stand monatelang auf der «Spiegel»-Bestsellerliste, ebenso wie «Risiko» (2015, Longlist Deutscher Buchpreis). «Propaganda» (2019) war für den Bayerischen Buchpreis nominiert. Von 2002 bis 2008 war Kopetzky künstlerischer Leiter der Theater-Biennale Bonn. Er lebt mit seiner Familie in seiner Heimatstadt Pfaffenhofen an der Ilm.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Zitate folgen Übersetzungen von Ralph Dutli (S. 93), Taisia Vichnevskaia (S. 112), Kay Borowsky (S. 189), Dorothea Trottenberg (S. 269), Christine Fischer (S. 280), Kerstin Hensel (S. 440). Kapitel 10 zitiert Ossip Mandelstam, Nguyen Ai Quoc, aus: «Über den Gesprächspartner», hg. und übersetzt von Ralph Dutli
Covergestaltung any.way, Walter Hellmann, nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung «Der blaue Schal», Gemälde von Tamara de Lempicka, 1930, Privatsammlung. © Tamara de Lempicka Estate, LLC / VG Bild-Kunst, Bonn 2023 (akg-images)
ISBN 978-3-644-01323-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Den Frauen meiner Familie
Es ist eine große Schachpartie, die hier gespielt wird –
über die ganze Welt – na, falls das die Welt ist.
Oh, was für ein Spaß! Wie ich wünschte, dass ich dazugehörte!
Ich würde auch ein Bauer sein, wenn ich nur mitspielen könnte –
obwohl ich natürlich am liebsten die Dame wäre.
Lewis Carroll, «Alice hinter den Spiegeln»
EinsEs war einmal in Afghanistan
Kabul, Emirat Afghanistan, August 1922–Mai 1923
«Wie viele Generationen von Arbeitern werden noch in den Wülsten englischen Fetts lebendig verwesen müssen, bis dieser Fettklumpen seinerseits als Düngemittel seine Bestimmung erfüllen wird?»
Mit ihrer jüngsten afghanischen Reportage in der «Prawda» hat sich Larissa Reissner den Zorn des britischen Establishments in Kabul zugezogen. «Das Haus der Maschinen» hat scheinbar ins imperialistische Schwarze getroffen.
Besonders dieses in der Tat eindrückliche Bild hatte den Botschaftssekretär in seinem empfindlichen britischen Herzen gekränkt. Larissa schilderte auch aufs Eindrücklichste den aus Sheffield stammenden Direktor der einzigen Textilfabrik Afghanistans, «der unwahrscheinlich, unanständig dick und so falten- und fettreich ist, dass in den Wülsten seines Bauches einmal beim Baden ein Frosch stecken geblieben und erstickt ist, was sich erst einige Tage später durch den unangenehmen Geruch bemerkbar machte».
Sie fand es damals bemerkenswert, dass die britische Botschaft, kaum dass der Text erschienen war, offiziell Beschwerde eingelegt hatte. Die Veröffentlichung eines solchen von feindlich-herablassenden Formulierungen strotzenden Textes gezieme sich nicht für die Frau des russischen Repräsentanten, auch wenn Russland neuerdings sozialistisch genannt werde. Obgleich man die Bolschewiki nicht anerkenne, gebe es doch gewisse Gepflogenheiten zwischen anständigen Vertretern von Staaten, sofern diese mehr sein wollten als Räuberbanden. Da sprachen die Richtigen, deren Politik seit Jahrhunderten nur aus Raub und Trug bestand.
«Afghanistan, dieses großartige, arme, in weiten Teilen buchstäblich im Mittelalter stecken gebliebene Land», hatte Larissa deshalb geschrieben, «dessen Natur und Gesellschaft uns gleichermaßen ergreifen wie auslaugen, ist so etwas wie das wichtigste Land der Welt – denn es ist der schwache Punkt von England, diesem Kopf des weltbeherrschenden Kraken, wo Arbeit und Kapital auf Tod und Leben miteinander ringen. Wenn man das begriffen hat, dann versteht man, warum man geradezu überall in Afghanistan die korrekten Engländer trifft, die das korrekteste Lächeln bereithalten, jenes Lächeln, das die Gesichter wie die Spitzen von Gewehrgeschossen durchschneidet.»
Die Beschwerdenote hatte sich förmlich überschlagen – von «barbarisch schlechtem Stil» gesprochen und eine Entschuldigung gefordert, die Larissa natürlich nicht geleistet hatte. Gut, das mit dem Fettklumpen und seiner Bestimmung war ein starkes Bild – aber was war schon dabei? Sterben mussten doch alle Menschen einmal, und dann düngten sie den Planeten, ob sie wollten oder nicht.
Ganz jenseits dieses formvollendeten diplomatischen Geplänkels war die Botschaft aber eindeutig: Es gibt im anglo-indischen Nachrichtendienst mindestens eine Person, die die in Afghanistan nicht und auch in Indien nur schwer zu bekommende «Prawda» liest und weiß, dass sich hinter dem Autorinnennamen Larissa Reissner die hier in Kabul nur als L.M. Raskolnikowa firmierende Gattin des Vertreters der russischen sozialistischen Sowjetrepublik verbirgt. Abgesehen davon beschwerte man sich ja schon häufig über die anti-britischen Statements des Botschafters selbst – ohne zu ahnen, wer die meisten davon verfasst hatte.
Das permanente Ärgernis, das die stolz über einem stattlichen Palast am Südufer des Kabul-Flusses wehende Rote Fahne mit Hammer und Sichel für den indischen Raj darstellt, ist aber vermutlich noch nichts im Vergleich zu dem, was Larissa jetzt gerade unternimmt.
«Hier bitte … Madame …» Der junge Arbeiter hat den Blick gesenkt, zögert, bevor er die hochgewachsene Frau dann doch anzublicken wagt: «Genossin Larissa.»
Der Mann aus der Maschinenfabrik, der sie hergeführt hat, Kopf und Gesicht mit einem Schal nach Paschtunenart umwickelt, zeigt ihr die beinahe zugewucherte, rostige Tür zwischen Kletterrosen und an der Mauer wachsenden Feigenbäumen, durch die sie in den hinteren Teil des Gartens gelangen können, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Ein Schleichweg, den der junge Mann seit seiner Kindheit kennt. Nach kurzer Zeit erreichen sie den einfachen Bau aus Lehmziegeln.
Das Nachmittagslicht sticht durch das nur mit einem Gitter versehene Fenster und legt sechs Schattenkreuze über den Boden und die kargen Wände. Die Rufe eines Falken dringen herein. Larissa, in blütenweiße englische Bluse, Jodhpurs und Reitstiefel gekleidet, kniet auf dem Boden, wickelt das sorgfältig mit starken Leintüchern verschnürte Bündel auf, das sie aus seinem Mauerversteck geholt hat, und legt es vor sich auf ein hölzernes Schemelchen. Sie streicht sich eine Locke ihres kastanienbraunen Haars hinters Ohr und betrachtet ihren Fund: Es sind Notizbücher unterschiedlichen Formats, nicht nummeriert und auch nicht anders in eine Reihenfolge gebracht. Sie schlägt sie auf, blättert: Es sind, soweit sie sehen kann, allesamt Aufzeichnungen auf Deutsch, manche tagebuchartig, andere mehr in Aufsatzform. Themen sind das Leben in Kabul und Umgebung, das Angebot auf den Märkten, Maß- und Längeneinheiten, Straßenverbindungen, aber auch Notizen über Personen von Rang, die der Verfasser kennengelernt hat, überraschend tiefgehende Analysen über den Hof und die politischen Verhältnisse. Alles aus der Zeit des früheren Emirs Habibullah. Man kann aus jeder Zeile ersehen, dass der Verfasser ein Militär war, den ein großes geografisches Interesse an den Gegebenheiten Afghanistans geleitet haben muss. Seine Schrift ist gestochen, sauber wie die eines Kanzlisten.
«WENN KONTINENTE ERWACHEN», liest Larissa schließlich einen mit Großbuchstaben geschriebenen und unterstrichenen Satz, «WERDEN INSELWELTREICHE ZERSTÖRT!» – dem leider keine nähere Erläuterung folgt. Aber an sich ist die Sache klar, um die es hier geht: Asien und Europa gegen England.
Doch der dringende Wunsch, den Verfasser dieses gigantischen Konvoluts wirklich kennenzulernen, entbrennt endgültig in Larissa, als sie eine großformatige Mappe aufschlägt und darin auf Dutzenden losen Seiten die bis ins letzte Detail skizzierte Schilderung eines denkbaren, von Afghanistan ausgehenden erfolgreichen Feldzuges gegen Britisch-Indien findet. Das militärische Ziel besteht scheinbar darin, die englische Herrschaft über den Subkontinent zu beenden und das Kronjuwel des Britischen Empires zu befreien.
Für Larissa, die nun beinahe zwei Jahre durchgehend in Afghanistan verbracht hat, sind die Engländer nichts anderes als gnadenlose Imperialisten, die es für sich genommen schon verdient hätten, aus Indien vertrieben zu werden. Der erste Besuch in der britischen Botschaft, die etwas außerhalb Kabuls liegt, unterhalb des Bagh-e-Bala-Palastes, hat sie aufgeweckt: Es ist die größte und prächtigste Niederlassung, die die Briten unterhalten, größer als die in Paris, Berlin oder Washington – und der Pomp, den der englische Botschafter Francis Humphrey und seine Frau Gertrude dort zelebrieren, hat sie zunächst beinahe eingeschüchtert.
In den letzten Monaten allerdings hat sie mehr und mehr begriffen, warum die Engländer gerade hier in Afghanistan so besorgt darum sind, auch nur den geringsten Eindruck, Indien könnte jemals frei oder von jemand anderem regiert (und ausgebeutet) werden als von ihnen, zu zerstreuen – die uneingeschränkte Kontrolle über den Subkontinent spielt die entscheidende Rolle: Würde England Indien verlieren, wäre dies mit Sicherheit der Anfang vom Ende seines Empires. Vom Matt in sieben Zügen auf dem Schachbrett der Geopolitik der erste. Bei diesem Fund, diesen Notaten und Darstellungen geht es also um nichts anderes als die Weltherrschaft – und damit wäre der in den Aufzeichnungen, die sie seit gut einer Stunde durchgeblättert hat, fast generalstabsmäßig genau skizzierte Angriff über den Khyber-Pass auf die Durand-Line, durchgeführt mit einem kleinen Korps regulärer Truppen und präzise wie Eliteeinheiten vorgehenden paschtunischen Stammeskriegern, die sich mit ihren Bruder-Stämmen auf der indischen Seite der Linie verbündeten, der größte Dienst, den man der kommunistischen Weltrevolution zu diesem Zeitpunkt hätte tun können.
Larissa packt die Aufzeichnungen wieder ein, verschnürt sie sorgfältig und steckt sie in ihre aus vielen Lederstückchen kunstvoll zusammengenähte Umhängetasche. Sie ruft nach dem jungen Mann, der sorgenvoll darauf gewartet hat, dass sie endlich fertig würde. Sie hat ihn bei der Besichtigung der Maschinenfabrik kennengelernt und sich ein wenig mit ihm angefreundet. Sein verstorbener Vater war eine Art Hilfshausmeister der Villa gewesen und hat ihm erzählt, dass hier während des Großen Europäischen Krieges deutsche Soldaten gelebt hätten. Sie hätten sich die ganze Zeit mit einer großen Karte beschäftigt und auf dieser Holzfiguren hin- und hergeschoben. Wie eine Art von Schach, auch wenn sein Vater die Regeln nicht verstanden habe. So wenig wie das schrecklich kratzende und polternde Deutsch, in dem sie ganze Nächte hindurch miteinander diskutiert und gestritten hätten. Dann habe sich die Gruppe aufgelöst, einer von ihnen sei verschwunden und wurde sogar mit einem gescheiterten Anschlag auf den Emir Habibullah in Nuristan in Verbindung gebracht. Der Anführer der Almanis habe vor seinem Aufbruch diese Aufzeichnungen in der Hütte versteckt, die seinem Vater als Gärtner- und Werkzeugschuppen gedient habe.
Nun, da Larissa sie eingesehen hat, versteht sie auch, was das Konvolut so wertvoll machte: Es ist ein perfekter Kriegsplan.
Die Ledertasche mit den Aufzeichnungen hängt sie sich um den Hals, und dann schlüpft sie unter ihren Tschador, der für alle Frauen in der Öffentlichkeit vorgeschrieben ist. Sie hat ihren von der Mutter des Emirs persönlich bekommen, unmittelbar nach ihrer Ankunft. Zunächst hielt sie diesen Ganzkörperschleier für einen Witz, aber es war tatsächlich unmöglich, auch nur einen Schritt außerhalb ihrer Residenz ohne ihn zu unternehmen. Als sie nun nach draußen tritt, in die drückende Hitze dieses späten Augusttages, die schwer über allem liegt, ist sie das erste Mal zufrieden mit dem Tschador, der ihren Körper verhüllt, sodass niemand, der ihr womöglich gefolgt ist, würde sehen können, dass sie etwas Wertvolles bei sich trägt.
Sie will dem jungen Mann ein wenig Geld geben, aber der lehnt ab.
«Nein, das habe ich für Sie getan und für – die Revolution der Arbeiter!» Dann nickt er Larissa einmal zu und läuft, so schnell er kann, den Hügel hinab, in eine andere Richtung als die, aus der sie gekommen sind.
Vor der aus riesigen Steinen erbauten Mauer des Anwesens, ein wenig im Gebüsch verborgen, warten drei der Ostsee-Matrosen samt Pferden, die Raskolnikow und Larissa nach Afghanistan begleitet haben. Sie waren auch damals mit Pferden hierhergekommen, die meisten von ihnen, treueste Gefährten seit den Tagen des Bürgerkriegs, hatten auf der von Sowjetisch-Taschkent ausgehenden Reise überhaupt erst Reiten gelernt. Sie hatten auf der Tour, die über einen Monat dauerte, Sonnenbrände und Sonnenstiche, schwere Durchfälle, Obstipation und sämtliche andere Beschwerlichkeiten durchlitten, die das heiße und schroffe Zentralasien für den unerfahrenen Reisenden bereithält. Sie sind nun allesamt tiefbraun gebrannt, bärtig, wie gegerbt, haben gelernt, sich wie Einheimische zu kleiden und zu benehmen, nicht wenige von ihnen sprechen passabel Dari. Der Dienst auf dem ersten regulären Botschafterposten der Bolschewiken hat sie vollständig von ihrer einstigen maritimen Existenz getrennt und sie doch als Mannschaft wiedererstehen lassen. Die Roten Matrosen von Kabul halten zusammen wie früher in Kronstadt, wie auf der Wolga und am Kaspischen Meer, erledigen ihre Aufgaben klaglos, nur ihre Gespräche drehen sich darum, wann es endlich Zeit wäre, ins Baltikum zurückzukehren. Doch würden sie alle für Larissa jederzeit durchs Feuer gehen – sie ist die revolutionäre Seele ihrer seltsamen Besatzung am Hindukusch, die den so wichtigen Vertretungsdienst beim ersten Staat, der die ansonsten diplomatisch isolierten Bolschewiki anerkennt, auf sich zu nehmen hat.
Während sie nun langsam nach Kabul traben, Larissa unter ihrem Tschador in der Mitte, kann sie an nichts anderes denken als daran, den Kriegsplan gegen Indien wieder aufzuschlagen und sich in seine Details zu versenken. Sollte er eines baldigen Tages in die Tat umgesetzt werden, so wären die Jahre voller Entbehrungen und Demütigungen durch die unfassliche britische Skrupellosigkeit wie auch Geschicklichkeit im Kampfe um Einfluss doch tatsächlich zu etwas gut gewesen, und sie hätten das nervenaufreibende diplomatische Wechselspiel des – wie jeder andere afghanische Herrscher vor ihm – zwischen Abscheu vor den Engländern und dem Verlangen nach den Wohltaten ihrer Bestechungsgelder hin und her schwankenden Emirs Amanullahs am Ende doch mit Sinn ertragen. Gerade liegt eine beinahe absurde Zeit hinter ihnen, da der frühere jungtürkische Kriegsminister des Osmanischen Reichs, Enver Pascha, mit ein paar Tausend Mann einen muslimischen Aufstand gegen die Bolschewiki in Buchara losbrach, der im Emir Amanullah die alte Hoffnung auf eine zentralasiatisch-muslimische Union jenseits von Russland und Großbritannien weckte und das schon beinahe unterschriftsreife Abkommen zwischen Afghanistan und den Russen wieder in weite Ferne rücken ließ. Zur Freude der Briten, die zur gleichen Zeit indische Truppen an der Grenze der Stammesgebiete aufmarschieren ließen, drohend, jederzeit zuzuschlagen, die paschtunischen Dörfer zu überfallen und vielleicht sogar auf Kabul selbst vorzurücken. Erst der Tod Enver Paschas und der Sieg der Roten Armee brachte den Emir dazu, den Sowjets wieder seine Gunst zu erweisen. Dieser diplomatische Nervenkrieg, durch die zeitweise Beschlagnahmung ihres Funkgerätes verschärft, was ein wochenlanges Abgeschnittensein von den Nachrichten aus Moskau mit sich brachte, hat ihre Stimmung angegriffen wie Karies einen Zahn. Ihre Moral ist am Boden, ihr Kampfgeist erschöpft. Doch nun hat Larissa diesen unerklärlichen Fund gemacht – eine neue Perspektive.
Sie durchqueren die herrliche Gartenlandschaft entlang des Wegs hinab zum Kabul-Fluss, durch Aprikosen- und Maisgärten, und erreichen bald schon das von Händlern und Einkäufern, von Garküchen und Tieren wuselnde Zentrum von Kabul, in dem beinahe keine einzige Straße davon zeugt, dass sie sich am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts an diesem Ort befinden und nicht in der namenlosen Zeit eines universalen Mittelalters.
Über den aus Ziegel und Lehm kunstvoll angelegten Straßen und gepflasterten Gassen hört man die Signalrufe der Falken, während die Jungs, die ihren Tag damit verbracht haben, zu schleppen, zu klopfen oder etwas zu schieben, darauf warten, dass es endlich das bisschen Abendessen gibt, das ihnen ihre Mütter kochen können, und bis es so weit ist, lassen sie mit ernsten, ja ehrwürdigen Gesichtern Drachen steigen. Gerüche gebratenen Hammelfleischs, Fliegengesirre und der verlockende, manchmal überparfümierte Duft süßer Früchte dringen durch das zarte Textil von Larissas Sichtfensterchen, und im leichten Schwanken ihres Pferdes und in der brutalen Hitze des Nachmittags mischt sich das Stimmengewirr zu einer beinahe unwirklichen Klangtextur. Chub hasti, wie geht’s, hört sie und Salam alaikum und die hundertfache Erwiderung wa alaikum salam …
Sie erreichen die russische Residenz. Ihr von unzähligen feingliedrigen Sprossenfenstern und einer schönen Balustrade geschmücktes Haus gehörte dem früheren Finanzminister Mustaufi ul-Mamalel, der als einer der korruptesten seiner Zunft in ganz Asien gelten konnte. Beim Herabsteigen vom Pferd spürt Larissa eine ungute, knochentief gehende Erschöpfung; für einen Moment muss sie sich noch am Sattelknauf festhalten, bevor sie es wagt, sich herabzulassen.
Dann schleudert sie den Tschador noch in derselben Bewegung von sich, mit der sie absteigt. Gleich kümmert sich Bootsmann Golnikow um die Pferde.
«Wo ist der Botschafter?»
Der Matrose am Eingang, das Gewehr zwar bequem, aber absolut korrekt haltend, wackelt mit dem Kopf. Er kennt die Raskolnikows seit deren Einsatz am Kaspischen Meer – dort, wo sich ein entscheidender, verhängnisvoller Moskito an Larissa gesättigt und der Admiral seine letzte Gefechtsleistung erbracht hatte. Die Kaspische Operation hatte sie beide ruiniert.
Raskolnikow ist seit seinem bald darauf folgenden Zusammenbruch mit akuter Lungenentzündung im Dezember 1921 und trotz des besten staatlichen Sanatoriums auf der Krim nicht mehr wirklich auf die Beine und leider schon gar nicht vom Alkohol losgekommen. Als Larissa sein Arbeitszimmer betritt: das übliche Bild. Durch die nachlässig zugezogenen Vorhänge ist der Raum in ein Clair-obscur geschnitten, das für Momente an ein Schachbrett erinnern könnte – auf dem großzügigen Sofa ihr Mann, einen Band Dostojewski auf der Brust, eingeschlafen, am Boden unterhalb seines herabhängenden Arms auf dem kostbaren blauen Teppich die leere Flasche Wodka.
Sie nimmt das Buch von seiner mächtigen Seemannsbrust, «Schuld und Sühne». Das Exemplar, das er während seiner Gefängnisjahre bei sich hatte. Sein Schatz. An den Seitenrändern Notizen aus dem Gefängnis, die Untergrundnamen seiner Mithäftlinge, seiner revolutionären Genossen. Tagebucheintragungen. Dieser Roman ist sein Schild, der Ursprung seiner Parteizugehörigkeit, eine Bibel aus der kostbaren und unwiederbringlichen Zeit der Illegalität, als er einer kleinen revolutionären Zelle um einen Studenten mit dem Pseudonym «Molotow» angehörte und sich aus Bewunderung für Dostojewski nach dessen berühmtester Romanfigur nannte, dem «Schädelspalter» Raskolnikow.
So viele seiner alten Genossen sind gestorben, ihre ikonischen, niemals wieder zu vergebenden Kampfnamen sind sein Heiligenkalender. Viele andere Genossen wandten sich anderen Fraktionen zu, machten Karriere und wurden ihm, dem Romanliebhaber, der es doch bis zum Admiral gebracht hat, fremd. Doch in den Notizen und Aufzeichnungen in seinem Exemplar von «Schuld und Sühne» ist die Welt, aus der er kommt, noch immer lebendig. Es wird niemals die seiner drei Jahre jüngeren Frau sein.
Nun liegt er leise schnarchend auf dem Sofa. Sein nur mit einem prall gespannten weißen Hemd bedeckter Bauch wölbt sich wie der eines Wals. Eines gestrandeten, versteht sich.
Auch ihn hat sie vor Augen gehabt, in der farcehaften Reportage über das «Haus der Maschinen», wo sie den überaus fetten Direktor vorführte – über den schrieb sie für die Leser der «Iswestija» genauso wie über ihn, ihren Mann. Aber Raskolnikow hat ihre Reportage, von der sie ihm einen Durchschlag hingelegt hatte, natürlich noch gar nicht gelesen, genauso wenig wie die Post des heutigen Tages. Die liegt ungeöffnet auf dem Schreibtisch, einem riesigen Möbelstück aus indischer Produktion (da die Afghanen selber keine Möbel in ihren Häusern haben), mit zahllosen Schnitzereien verziert, die den Tisch wirken lassen, als sei das ursprüngliche, das Holz umrankende Laubwerk auf magische Weise verwandelt. Die Vertiefungen der Schnitzereien hat der Künstler mit Lapislazuli-Staub ausgerieben, was ihnen ein besonderes Farbspiel verleiht.
Sie wirft den Tschador auf einen der Besuchersessel vor dem Schreibtisch, ruft durch die offen stehende Tür auf den Flur hinaus, dass sie einen Samowar wünscht, räumt die Botschaftspost, um die sie sich später kümmern wird, zur Seite, holt stattdessen die deutschen Aufzeichnungen aus ihrer Tasche und legt sie auf den Tisch. Verschwenderisch, wie sie angesichts dieses Fundes ist, zündet sie erst die beiden großen Petroleumlampen auf dem Schreibtisch an und dann eine Zigarette – eine englische Dunhill, die sie den russischen vorzieht, neben ihrem gleichfalls aus London beschafften Parfüm Rose France, das sie über alles liebt: ihre beiden größten Schwächen. Genuss – und Geschmack.
Als der Botschafter Raskolnikow, ihr Ehemann, der Admiral und frühere Kommandeur der heldenhaften Wolgaflotte, nach einer Stunde mit einem lang gezogenen Seufzer aus seinem Rausch erwacht, hat sie sich einen Überblick über die Aufzeichnungen verschafft und diese grob geordnet. Sie hat den Kriegsplan genau studiert, ihn auf alten Karten aus der Zarenzeit nachvollzogen, mit denen sie vom Moskauer Außenminister Cicerin vor ihrer Abreise ausgestattet wurden. Manche der Anmerkungen bleiben ihr allerdings rätselhaft, es sind wiederkehrende Notationen, die eher zu einer Schachpartie passen würden. Dann wieder Zahlenkombinationen, als habe jemand die Ergebnisse eines eigenartigen Roulettespiels aufgeschrieben. Patterns.
«Lyalya, Liebste», lässt sich nun Raskolnikow vernehmen, steht mit einem Ächzen vom Sofa auf. Schiebt sein Hemd unter die Hosenträger, fährt sich über den Bart und geht barfuß zu ihr hinüber, um sich eine Tasse Tee zu nehmen. Er hinkt leicht.
«Gut geschlafen?» Sie blickt nicht einmal auf, hält ihm die Wange hin, als er sich, den Tee ungeschickt balancierend, zu ihr hinüberbeugt, um ihr einen Kuss zu geben. Sein Atem ist ein Abgrund aus schlechten Angewohnheiten, sein Dreitagebart kratzt auf ihrer milchzarten Haut, er muss sich am Schreibtisch festhalten, weil ihm offenbar noch ein wenig schwindlig ist.
«Bin kurz eingenickt, Liebste, die Hitze», sagt der Mann mit dem bekannten alten Kämpfernamen, schlüpft in das zweireihige Jackett, das über seinem Stuhl hängt, auf dem jetzt Larissa sitzt.
«Was haben Sie da?»
«Das sind Aufzeichnungen deutscher Offiziere, die während des Großen Krieges hier in Kabul stationiert waren. Sie haben sich mit einem Kriegszug gegen Britisch-Indien beschäftigt. Sehen Sie her …»
Mit ihrem Bleistift zeigt sie auf einzelne Positionen und Abschnitte und erklärt ihrem Mann, der kaum Deutsch liest, was sie hinter den Aufzeichnungen vermutet.
«Kann schon sein, dass es bald wieder zu einem Krieg zwischen den Engländern und Afghanistan kommt. Die Spannungen wachsen täglich …», murmelt er.
«Ich glaube, Sie haben mich nicht ganz verstanden», sagt sie, «ich spreche von einem Plan, Indien von der britischen Herrschaft zu befreien. Afghanistan ist dabei der Ausgangspunkt, nicht das eigentliche Ziel.»
«Gewiss …», murmelt Raskolnikow, streichelt ihr die Wange und geht aus dem Zimmer, den Gefängnis-Dostojewski unter dem Arm. In seinen Augen und seinen Bewegungen macht Larissa jene schlenkernde Ungeduld aus, die den alten Kämpfer überkommt, wenn es ihn nach einem Schluck Wodka gelüstet. Sie hingegen hat Dunhill-Zigaretten und trinkt unendliche Tassen Tee, die sie nun bis an die zarten Spitzen der Morgenröte tragen.
Wieder und wieder geht sie die deutschen Aufzeichnungen durch, sieht den Weg nach Indien frei und imaginiert den Hebel, um die britische Herrschaft aus den Angeln zu heben und die Welt zu einer anderen zu machen – doch vieles versteht sie auch nicht, manches bleibt ihr dunkel. Dann, in den frühen Morgenstunden, entdeckt sie endlich einen Namen, es liest sich wie eine Art Unterschrift, vielleicht die des Verfassers:
Oskar Niedermayer, Königlich Bayerischer Oberleutnant.
Mit einem Mal vollkommen erschöpft, eine letzte Zigarette rauchend, steht sie vom Schreibtisch auf, sagt sich den Namen noch ein paar Mal vor: Niedermayer. Sehr deutsch, fast banal. Und dann auch noch bayerisch …
Beim Aufstehen spürt sie schon, dass ihr leicht schwindlig ist, was keineswegs von der Zigarette herrührt. Ihr Kopf pocht, ihre Augen brennen so sehr, dass sie mit einem Mal nur noch verschwommen sieht. Eine beunruhigende Hitze steigt in ihrem Inneren auf und legt sich wie ein neuer Tschador um sie, ein Glutgewand, mit dem angetan sie sich auf das Bett in ihrem Schlafzimmer wirft, plötzlich sogar zu schwach, um sich ihre Reitstiefel auszuziehen, die sie seit ihrer Heimkehr immer noch trägt. Ihr Kopf ruht erschöpft auf dem Kissen, aber ihr Körper findet keine Erholung. Der Schweiß tritt ihr auf die Stirn, das Gewand aus Hitze schnürt sich enger um sie, bedrückt sie, und hätte Larissa die Kraft, würde sie es sich vom Leib reißen, aber das kann sie nicht, die Bedrückung und der Schwindel gehören zusammen, werden mit einem Mal groß und schwer wie ein Teppich: Bald schon verliert sie das Bewusstsein. Es ist die Malaria, die sich nach Monaten, in denen sie ohne Beschwerden war, ihrer bemächtigt.
Irgendwann in den frühen Morgenstunden findet sie einer der Matrosen auf ihrem Bett, holt Raskolnikow dazu, der verständigt den alten Schiffsarzt, der der Botschafts-Besatzung mitgegeben wurde und der nicht viel anderes zu tun vermag, als ihr Chinin zu verabreichen und dafür zu sorgen, dass sie genügend Flüssigkeit bekommt.
In den ersten Tagen ist sie kaum bei sich, tief eingesunken in die zermürbende Präsenz des Fiebers, doch der deutsche Name, Niedermayer, bleibt bei ihr, wird zur Manie, zu einem Phantom, das ihr in mannigfaltigen Verkleidungen und Gewändern erscheint und sie durch Kataklysmen führt, in denen ganze Welten untergehen. Fiebernd träumt sie von Aufmarschräumen und Kanonen, den Pässen des Hindukusch; den Staub peitschende Pferde der Stammeskrieger ziehen an ihr vorbei, und sie beginnt endlich zu verstehen, wie der Krieg gegen die Imperialisten gewonnen werden kann – sie sieht die Schlacht. Doch immer, wenn sich ihr leidender Geist darum bemüht, etwas davon festzuhalten, entwischen die Gestalten, die Truppen der Weltrevolution, die sie befehligt, zerfallen wie Windteufel in der Mittagsglut. Nur eines bleibt von ihren Visionen, der Name Oskar Niedermayer.
Der bisher heftigste Malaria-Anfall, seit sie sich 1920 am Kaspischen Meer infiziert hat, wirft sie für zwei Wochen aufs Krankenlager, doch auch danach spürt sie noch Nachwirkungen des Schubs. Die Malaria ist wie ein Gespenst, das sich in den Knochen, den Muskeln und Sehnen ihres Körpers eingenistet hat und sich nach jeder Niederschlagung beständig von ihrer Lebensenergie nährt, bis es wieder stark genug geworden ist, um sich in voller Gestalt zu erheben. Doch Larissa ist nach den beiden Wochen heiter, sogar fröhlich, durchgekocht gleichsam, und sieht die Welt mit geschärften Sinnen. Aber ihr Körper, das fühlt sie, ist eindeutig schwächer als vor dem Anfall.
Als sie einigermaßen die Kraft dazu hat, nimmt sie ihre Arbeit wieder auf, richtet Empfänge aus, trifft sich weiterhin mit der Mutter und den Frauen des Emirs, unter denen sie viele Freundinnen hat, die sie bewundern. Schreibt Briefe. Studiert spätabends, alleine für sich die Aufzeichnungen des deutschen Offiziers, Niedermayer, aus denen sie viel lernt. Es ist nebenbei wie ein Seminar in einem neuartigen Fach namens «Geopolitik».
Auf dieser Grundlage versucht sie die kargen Nachrichten, die sie in Kabul über ihre umkämpfte Telefunkenanlage hereinbekommen, zu deuten.
Mit Obermaat Struchov, ihrem Funker auf dem Kanonenboot WANJA KOMMUNIST, der an der Kasan-Front von großer Bedeutung gewesen war, verbringt sie ganze Nächte am Funkgerät, manchmal auch Arm in Arm. Zuweilen bekommen sie den britischen Funkverkehr zwischen Indien und Ägypten herein – den beiden wichtigsten Besitztümern des Welt-Inselreichs Großbritannien. Sie belauschen ferne Frachtschiffe. Einmal die Woche treffen Zeitungen ein. Das für sie wichtigste Ereignis ist natürlich die Gründung der Sowjetunion, die im Dezember stattfindet, den russischen Bürgerkrieg endgültig beendet und das Russische Reich beerbt. Die vier unabhängigen Länder Russland, Weißrussland, Ukraine und die Transkaukasische Sowjetrepublik, ein Zusammenschluss von Georgien, Aserbaidschan und Armenien, gründen die UdSSR, das größte Land der Erde. Mit diesem bedeutenden Ereignis, das sie nicht wenig stolz macht, gewinnt Larissa aus ihrer afghanischen Perspektive folgendes Bild der Weltlage zu Anfang des Jahres 1923:
In Lausanne findet eine von den Briten dominierte Konferenz statt, die einen Friedensvertrag mit der durch ihre enormen Kriegserfolge möglich gewordenen, neu gegründeten türkischen Republik Kemal Atatürks vorlegt. Sie diskutieren eifrig über Atatürks Erfolg, denn unter ihm ist die Türkei ein riesiges Vorbild geworden, nicht nur für Amanullah, sondern auch für die Bolschewiken, die mit Staunen sehen, wie er sich gegen die westlichen Siegermächte des Großen Kriegs durchsetzen konnte. So bekommt die türkische Republik die Kontrolle über die Meerengen zurück. Weder Deutschland noch das unmittelbare Nachbarland, die junge Sowjetunion, sind formell nach Lausanne eingeladen – Moskau aber hatte immerhin den Vorschlag einbringen dürfen, die Dardanellen ganz für fremde Kriegsschiffe zu sperren, eine Idee, auf die sich keine der alten Großmächte einlassen will.
Larissa begreift schnell, warum: Es stehen genügend Weiße, Monarchisten und Reaktionäre, immer noch bewaffnet und kampflustig, im bislang osmanischen Gallipoli. Es wäre ein Leichtes, aus ihnen eine Invasionsarmee zu formieren und sie auf der Krim abzusetzen. Man braucht nur die Durchfahrt ins Schwarze Meer.
Im Frühjahr dann beklagt der britische Außenminister Curzon «sharply worded», welche Schandtaten die Bolschewiken im ehemaligen Russischen Reich begehen: Bedrängung britischer Staatsbürger; Behinderung des britischen Schiffsverkehrs in internationalen Gewässern; religiöse Verfolgung. Und dazu noch die zunehmende anti-britische Propaganda in Persien, Indien und Afghanistan. Lord Curzon – man höre und staune – stellt den Regierungen dieser drei Länder ein Ultimatum, die sowjetischen Botschafter hinauszuwerfen.
«Die Briten wünschen unsere Regierung ohne Verbindung zum Rest der Welt. Keine andere Sichtweise, kein anderer Standpunkt als der britische soll gelten», schäumt Emir Amanullah kurz danach. Der britische Botschafter war persönlich zu ihm gekommen und hatte ihm die Note des britischen Außenministers überreicht.
«Wollen mir vorschreiben, mit wem ich mich bespreche und austausche – und bombardieren auf der anderen Seite unsere Dörfer an der Grenze zu Indien!»
Am gleichen Abend noch erhalten Raskolnikow und Larissa die Einladung zur Verleihung eines hohen Ordens an den sowjetischen Botschafter. Es ist das übliche Spiel – das schwankende Gunstpendel eines eigentlich gutartigen Herrschers eines kleinen Landes, der zugleich versucht, dem britischen Prinzip aus ein wenig Zuckerbrot und viel Peitsche zu widerstehen. Jetzt will er ein Zeichen für seine Unabhängigkeit setzen und bauchpinselt deshalb den Admiral auf dem Botschafterposten. Aber ändern, gar revolutionieren wird das alles nichts, da ist sich Larissa sicher.
Mit den nur äußerst spärlichen Agentur-Nachrichten aus dem Ausland und den innerafghanischen Botenberichten von der Ost-Grenze, wo die britischen Truppen dabei sind, paschtunische Dörfer auf afghanischer Seite zu zerstören und sogar mit Giftgas anzugreifen, versucht sie sich ein Bild der Lage zu machen.
Mit einer befriedeten und abgefundenen Türkei, die vorerst neutral bleiben wird, sind die Optionen der West-Alliierten im Schwarzen Meer wieder gestiegen – warum nicht doch noch auf der Krim landen?
Ein französischer Wunschtraum seit Langem. Gleichzeitig geht man gegen die paschtunischen Stämme mit genauer Detailkenntnis vor – die Angriffe sind kein Zufall, sondern erfolgen mit militär-anthropologischer Logik: Jetzt im Winter können die Stämme nirgendwohin ausweichen. Sie müssten ihre Herden zurücklassen, was sie niemals tun würden. So sind sie leichte Opfer in ihren zusammengedrängten Dörfern.
Wenn London es will, sterben achttausend Kilometer weiter östlich Kinder und alte Leute, die von ihren Schafen leben, denkt sie. Das ist die Weltmacht. Gegen dieses Weltsystem, diese nachrichtendienstlichen Verbindungen und diese Logik präziser Waffengewalt muss man vorgehen. Mit dem Niedermayer-Plan – oder was immer das ist, wofür die von ihr entdeckten Aufzeichnungen stehen.
Das eheliche Leben zwischen ihr und Raskolnikow verläuft, wie bei so vielen, nicht ohne üble Ausbrüche seinerseits, bolschewistisch, sentimental. Er kommt ihr manchmal ein wenig vor wie ein altes Haustier, dem sie seine Gewohnheiten nicht rauben will. Doch in ihrem Inneren reift der Entschluss, Afghanistan so bald wie möglich zu verlassen. Alleine. Und ihre beiden Geheimnisse mit sich zu nehmen.
Im Mai 1923 schließlich sieht sie zu, wie die Matrosen der Roten Botschaft ihr Gepäck zum Kofferraum eines der wenigen Autos tragen, die es im Land gibt, und noch in den letzten Stunden ihres Aufenthaltes, bevor sie Afghanistan in einer mühsamen, zweiwöchigen Reise über Bamian und schließlich die turkmenisch-sowjetische Grenze verlässt, schreibt sie ihren Eltern einen Brief, der ihr nach Moskau vorauseilen soll:
«Wenn es jetzt so weit gekommen ist, dass Afghanistan sich im Kriegszustand mit Großbritannien befindet, wenn seine Grenzen ins Blut der Stämme getaucht werden und der Emir sich auf niemand anderen stützen kann als uns: Wenn das alles auf dem Spielfeld ausgebreitet ist und das werktätige Russland nicht anders kann, als den Stammesleuten zu helfen, seit hundert Jahren vernichtet, seit hundert Jahren belagert – wenn wir diesen Moment verstreichen lassen, dann gibt es für uns in Zentralasien nichts anderes mehr zu tun, als den Laden dichtzumachen. Denn wie nützlich und erfreulich wäre es gerade jetzt, nach Lausanne, das Britische Empire an seine schwache Stelle im Osten zu erinnern.»
ZweiDie Totengräber
Wagankowoer Friedhof, Moskau, Februar 1926
Wie am Ende einer Gasse eine einzige einsame Laterne das Wappen eines Tuchgeschäfts oder Modisten in die Nacht schneidet und dem Spaziergänger aus einem anderen Rayon sogleich die Idee eingibt, dass es vielleicht Zeit wäre, sich ein neues Gewand zuzulegen, sei es einer neuen Liebe oder einer begangenen Schandtat wegen, so hatte sich ganz Moskau, die schmutzige, unendliche, unbegreifliche Stadt, einen weißen Pelz umgelegt. Es tat sich leicht damit – zumal dieses schöne frische Gewand nicht lange halten und bald schon, in den ersten Stunden geschäftigen Lebens, zum Bettlerlumpen werden würde.
Arkadi Tandorinowitsch atmete das, was man schnöde auch nur eine Moskauer Schneeluft hätte nennen können, mit Dankbarkeit ein. Davor hatte er ein paar abgemagerte Stunden Schlaf genossen, hatte sich einmal kurz gestreckt, von seiner Bettstatt erhoben, gleichfalls dankbar für alles Zwicken, Stechen und Ziehen, da ihm jedes einzelne Zipperlein mitteilte, dass er noch am Leben war. Mit einem Mal juckte es ihn ganz unvorteilhaft an einer Stelle, wo ihn gerade eine Wanze biss, die sich doch die Zeiten seiner Bewusstlosigkeit hätte zunutze machen und sich währenddessen satt saugen können, anstatt noch diesen Nachschlag aus dem bereits erwachten Körper einzufordern.
«Kannst wohl nicht genug bekommen, Freundchen», ließ er seinen beinahe zahnlosen Mund murmeln, schnappte das lästige Tier und warf es mit einem Kichern in hohem Bogen auf die Straße hinaus, von wo es den Weg in seine aus Lumpen gebaute Bettstatt gewiss nicht so schnell zurückfinden würde. Er kratzte sich an der juckenden Stelle und spürte einen winzigen Tropfen Blut auf seiner Fingerkuppe. Und wieder freute er sich daran, dass es noch immer warm und anscheinend nahrhaft durch seine Äderchen floss. Auch das war keineswegs selbstverständlich.
Er nahm seine dicke Loskuts-Jacke, zusammengenäht aus Dutzenden von Stofffetzen unterschiedlichster Webart, die er auf dem Loskutnaja-Markt, dem Handelsplatz für Stoffreste, gekauft hatte, zunächst um die alte Jacke immer wieder zu flicken, doch im Lauf der Jahre hatten die Fetzen das ursprüngliche Gewebe vollständig ersetzt. Er warf den schweren, seiner Körperform perfekt angepassten Flickenfrack über und trat aus der Tür seiner kleinen Hütte.
Er atmete tief ein. Diese Luft in den frühesten Morgenstunden, bevor in den Fabriken die ersten Schichten begannen und die Öfen in den Wohnungen angefeuert wurden, diese Luft war einfach reine Medizin. Um nichts in der Welt hätte er auf diese Momente frischer Moskauer Schneeluft verzichten mögen, sie war die eigentliche Ursache seiner nun schon über siebzig Jahre währenden Gesundheit. Schläge hatte er genügend abbekommen, hatte einige pariert, andere hatte er einstecken müssen, und Narben waren auch zurückgeblieben. In seiner Schreinerlehre in Jaroslawl, die er zu einer Zeit angetreten hatte, als Fjodor Dostojewski sein Geld in Wiesbaden verprasste, hatte ihn sein Lehrherr, der Meister Walpuchin, mit dem Rundholz und immer wieder auch mit dem Eisenhämmerchen geschlagen, manchmal auf den Rücken und einmal auch ins Genick, woraufhin Arkadi ohnmächtig geworden war – aber meistens hatte der Meister auf die Hände gezielt. Hunderte kleiner und großer Brüche und Risse in seinen Knochen, die ihn zwischen seinem vierzehnten und siebzehnten Lebensjahr ereilten und die alle wieder verheilt waren, hatten seine Hände gehärtet, sodass es jedem, der ihm die Hand gab, das Gefühl einflößte, er greife eine mechanische Eisenprothese anstelle einer natürlichen Hand, oder noch mehr, als sei Arkadi in ganzer Person ein Mann aus Stahl.
Schnell war der Mann mit der Eisenhand jetzt dabei, sich mit dem Beilchen an seinem Holzvorrat zu schaffen zu machen, den er in einem in die bloße Erde gegrabenen Unterstand knochentrocken aufbewahrte. Das Holz stammte von einem abgerissenen Gebäude, irgendwo nahe der Hauptstadt. In Moskau selbst war in den Jahren seit der Revolution schon beinahe alles, was man hatte demontieren können, abgerissen worden, viele leere, nur noch von Resten bedeckte Abbruchgrundstücke in den Gassen zeugten davon, wo einst gemütliche Holzhäuser alter russischer Bauart gestanden hatten.
Das Holz, das Arkadi nun zu spalten begann, bekam er aus dem Geschäft eines Gewinners der Neuen Ökonomischen Politik, eines sogenannten NÖPlers, der den systematischen Abbau alter Adelssitze betrieb, in denen auf traditionelle Weise sehr viel bestes Holz verbaut war – uralte Lärche aus dem Ural, und das in rauen Mengen. Fassadenverkleidungen, Fensterrahmen, Schindeldächer und natürlich auch: Dachstühle. Für die zuverlässige Lieferung dieses vorzüglichen Brennholzes leistete Arkadi dem NÖPler die eine oder andere Gefälligkeit. Ein Totengräber bekommt mehr vom Leben mit, als man glauben würde. Ähnlich wie der Schaffner eines gut funktionierenden Verkehrsmittels, einer Trambahn, in der man schön gereiht saß, sorgte er dafür, dass jeder an seinen Platz kam.
Vor ein paar Monaten zum Beispiel, da hatten sie den Auftrag bekommen, ein Grab für den General Frunse, den glorreichen Anführer der Roten Armee, auszuheben, aber kaum dass sie fertig waren, wurde beschlossen, dem großen General seine letzte Ruhestätte in der Kremlmauer zu bereiten, was innerhalb der jungen Welt des sowjetischen Friedhofswesens eine absolute Besonderheit war.
Seltsam war das ja schon, dachte Arkadi und musste einen staunenden Zungenschnalzer von sich geben – wirklich seltsam, wenn man den Auftrag für das Grab bekommt, bevor der Tod des Kunden erfolgt ist, des braven Bürgers, der braven Bürgerin, der es zugedacht war, des Genossen oder der Genossin oder gar des strahlenden Kriegshelden und Generalissimus, des Stolzes der Partei, die natürlich auch die Bestattungen organisierte. Als Arkadi – nach der Revolution und eher zufällig – ins Bestattungswesen eingetreten war, hatte die Partei das Monopol dafür gerade an sich gerissen. Wie im Rest des Landes waren auch hier Hyperinflation und ein organisatorischer Zusammenbruch gefolgt. Man musste ein Vermögen ausgeben, um bestattet zu werden, aber selbst wenn man das Geld hatte, konnte es dauern. Unaufhörlich kamen die Toten von den Schlachtfeldern, aus den Krankenhäusern und Lazaretten und sammelten sich vor den Friedhöfen der großen Städte, von Hunden angenagt. Viele begannen bald zu riechen. Eine entsetzliche Zeit, damals. Arkadi war Totengräber geworden, weil er es angesichts dieser Missstände als seine mitmenschliche Pflicht angesehen hatte. Und er war dabei geblieben. Denn was man ansonsten von nichts anderem im Russland dieser Jahre behaupten konnte: An Leichnamen war kein Mangel. Er hatte sich dreingefunden, hatte sich allerdings stets geweigert, Massengräber auszuheben, das kam für ihn nicht infrage.
Als Arkadi mit seinem Beil genügend Anzündholz abgespalten, mit dem Lederriemen umschnürt und auf seinen Schlitten gelegt hatte, nahm er einige Balkenteile und dickere Scheite, und schließlich fasste er mit altgewohntem Griff und nicht geringer Freude, dass sie immer noch heile war, seine Spitzhacke, legte sie auf den Schlitten und dazu seinen Spaten, der im Lauf der Jahre tatsächlich schon einiges von seinem eckigen Blatt verloren hatte. Er hatte im Großen Krieg Gräben ausgehoben damit, erst gegen die Österreicher, dann gegen die Deutschen. Aber genutzt hatten sie nicht viel, die Gräben. Keiner von beiden Seiten übrigens. Da war die jetzige Nutzung schon bei Weitem besser, zielgerichteter. Galt stets nur einer einzelnen Person. Einem Individuum. Als er sodann alles verladen hatte, bekreuzigte er sich dreimal und zog den Schlitten an.
Der frisch gefallene Schnee hatte alles gesäubert, geglättet und verschönt. Die lehmige Straße ein unberührtes Damasttuch, das sich durch den dunklen Dienstbotenflur der Stadt zog, bis dahin, wo sich das Gräberfeld befand. Auf dem Weg dahin würde Arkadi noch einmal einkehren.
Es war kurz nach halb drei Uhr morgens, als das variantenreich knirschende Geräusch, das sein Schlitten verursachte, sich langsam von seiner Hütte fortbewegte, breite Fußabdrücke und schmale, beinahe elegante Fahrspuren auf der dünnen Schicht jungfräulichen Schnees hinterlassend.
Dieser Aufbruch Arkadis geschah etwas früher als sonst, und Hundehund, der es sich unter einem halb verfallenen Bretterhaufen an einem Mäuerchen bequem gemacht hatte, spitzte seine Ohren, schnupperte in die eiskalte Luft, und als er zu der sich langsam nähernden, wohlvertraut knirschenden Melodie des Schlittens nun auch den Geruch Arkadis wahrnahm, da tat sein Herz einen Sprung, und dann trabte er auch schon vorsichtig los. Dabei war er vorfreudig und glücklich, und gleichzeitig schämte er sich dieser Gefühle, ja mehr noch, er war deshalb fast wütend auf sich selbst, wie jedes Mal, wenn die Begegnung mit Arkadi anstand. Aber in dieser frühmorgendlichen Moskauer Einsamkeitsnacht im bitterkalten Februar, hier zu dieser Stunde und ganz erfüllt von dem Lebensstrom, der immer noch in ihm pulste, war seine Freude einfach zu groß.
Hundehund hatte einen verkrüppelten linken Hinterfuß, den im Lauf zu nutzen ihm nicht mehr möglich war, doch er war ein geschickter Hinkender. Das verdankte er seinem früheren Herrn, welcher im Jahre 1922 einen jämmerlichen Tod erlitten hatte, verursacht vom Zusammenspiel einer jahrzehntealten Syphilis und einer Leberzirrhose, die ihn am Ende in ein gelbhäutig-stinkendes Monstrum verwandelt hatte. Bis dahin freilich hatte er Hundehund im Fuselrausch zu verprügeln gepflegt – mit dem Schürhaken oder dem Ochsenziemer und was ihm sonst in die Hände kam. Erst die Revolution der Bolschewiken war es gewesen, die Hundehund Erleichterung verschafft hatte, da sein seine Liebe schlecht vergeltender Herr danach so verarmt war, dass er all diese Haushaltsgegenstände verkaufen musste, bis schließlich nicht einmal mehr Holzscheite da waren, mit denen er nach ihm hätte werfen können. Als sein Herr starb, buchstäblich im letzten Hemd, zusammengekrümmt in einer der winkligen Gassen nahe dem chinesischen Viertel, saß Hundehund immer noch bei ihm, aufmerksam und trotz allem auch ein wenig traurig, da der bis dahin abscheuliche Geruch des zirrhotischen Mannes langsam von Botenstoffen des bevorstehenden Endes durchsetzt wurde. Als die Agonie endete, näherte Hundehund sich noch einmal vorsichtig und schaudernd dem Korpus, und als er sich überzeugt hatte, dass sein Herr nicht mehr war, verließ er dessen sterbliche Überreste, im Bewusstsein der Befreiung und erfüllt von der Entscheidung, sich nie wieder einem Menschen anzuschließen und jene unerschütterlich sehnsuchtsvolle, bittere Fähigkeit zur Liebe und zur Gefolgschaft, die in ihm steckte, lieber ungestillt zu lassen.
Er war auch schon zu Lebzeiten seines undankbaren Herrchens oft durch Moskau gestreunt, kannte die Wege und Gassen, fürchtete sich vor der harten Geschäftigkeit gewisser Ecken und hungerte lieber, als sich unter zu viele Menschen zu begeben, und hatte doch nicht gewusst, wohin er sich nun hätte wenden können. Die ersten Tage waren hart, und das nicht ganz kleine, schlanke Tier, dem ein Barsoi-Windhund Spuren seiner edlen Gestalt hinterlassen hatte, was man auch an der lang gezogenen schmalen Schnauze erkennen konnte, war immer wieder, unbewusst und beinahe gegen seinen Willen, in die Nähe seines toten Herrn zurückgekehrt und hatte auf diese Weise auch mitbekommen, wie der Leichnam eines Abends eingesammelt und in einem typischen Armengrab bestattet worden war. Von Weitem hatte er dem Mann zugesehen, der die Schaufel führte. Kein anderer als Arkadi. Und auch wenn Hundehund an seinem Entschluss festhielt, sich niemals mehr einem Menschen in aller hündlich-treuen Konsequenz anzuschließen, so kam es doch schon an diesem Tag zu einer ersten Kontaktaufnahme. Der zum Erbarmen abgemagerte Barsoi-Bastard folgte Arkadi in weitem Abstand, von diesem längst bemerkt und schließlich, nachdem der Totengräber in seiner Behausung angekommen war, sogar mit einem Suppenknochen und einem harten Brotstück bedacht. Seitdem waren Arkadi und Hundehund, nun ja, was waren sie geworden? Eine freundschaftliche Assoziation mit Vorteilen für beide Seiten.
Das Erste, was Arkadi an diesem frühen Morgen von Hundehund sah, war sein in der Eisnacht stehender Atem, der hinter dem Stamm einer gewaltigen Ulme hervortrat. Dann ein zartes Näschen.
Komm doch ran,
Armer Hund,
Küssen wir uns zum Gruß…
«Da bist du ja, mein Hundelchen», sagte Arkadi zufrieden und begutachtete dann, wie der Angesprochene zunächst zögerlich, wie es nun einmal seine Straßenhundeart war, hinter dem Baum hervorhumpelte, näher kam, sein wedeliges Hinterteil nicht mehr im Zaum haltend, schließlich an der von Arkadi hingestreckten Hand schnupperte und aus dieser dankbar ein Brotkügelchen entgegennahm, das Arkadi für ihn gerollt hatte. Von den einstmals auch von den Zaren geschätzten Barsois sagt man, es seien die einzigen Hunde, die lachen könnten wie Menschen, und dieses Erbe zeigte sich nun auch in Hundehunds Antlitz. Das schmale Maul öffnete sich, und ein dann doch nicht anders als treu zu nennender lieber Blick suchte Arkadis Augen.
«Na, dann wollen wir mal sehen, ob unsere faulpelzigen Kameraden schon wach sind», murmelte der, nahm die Deichsel des holzbefüllten Schlittens wieder auf und setzte, nun begleitet von dem glücklichen Tier, seinen Weg fort, machte mit seinen Filzstiefeln tiefe Stapfen in den zart knirschenden Neuschnee, und eine dreibeinige Pfotenfigur trat ab dieser Stelle dazu, die Spur von Holzgefährt und Mann umschlängelnd.
Nicht lange und sie erreichten – erbost gegen einen Windstoß ankämpfend, der ihnen ordentlich Schneeflocken servierte – das halb verfallene, windschiefe Bauwerk, hinter dessen aus Fundbrettern gezimmerter Tür und den wie im russischen Winter üblich verkitteten Fenstern er den Rest seiner Mannschaft wusste. Hundehund verbarg sich. Arkadi schlug mit der von praktischen Lappen umhüllten Hand an die schlosslose Tür, drückte sie dann auf, trat in den funzellichtigen Raum, in welchem ihm sich jene Geruchskomposition aus Männerschlaf, stehender Luft und halb erkaltetem Kohleofen darbot, auf der aber auch schon der spritige Oberton des Primus-Kochers tänzelte, jenes schwedischen Patents, das es millionenfach in der Sowjetunion gab, den gleichfalls Millionen von Entwurzelten, Versprengten und Neustadtbewohnern Herd und Samowar ersetzend.
Den bläulichen Flammenkranz des Primus betrachtete Alexej Maximowitsch Duchow und auch das Töpfchen, mit dem er Schneewasser schmolz, um auf diese Weise Tee zu kochen. Acht gab er aber nicht nur auf den Kochvorgang, sondern auch darauf, dass sein langer, struppiger Bart nicht wieder angesengt wurde, was schon einige Male vorgekommen war.
«Früh dran seid ihr, Genosse», konstatierte der Teezubereiter.
«Der Boden ist so hart gefroren, da werden wir ordentlich dreinschlagen müssen.»
«Tee trinken wir aber noch.»
«Einverstanden. Wo ist Timofei Jakowitsch?»
«Geht einem menschlichen Bedürfnis nach. Einem allzu menschlichen.»
Arkadi seufzte, denn er ahnte es bereits, dass «menschlich, allzu menschlich» genau das Stichwort war, an welches der bärtige Teekocher sich nun krallen würde, um ein wenig in die frühmorgendlichen Höhen der Spekulation hinaufzusteigen – denn Duchow war einer der radikalen Biokosmisten, deren gemeinsames Ziel es war, «den Menschen» und dessen allzu unerfreuliche Lebensumstände auf der alten Erde zu überwinden. Sein Meister war der Philosoph Fedorow, der vor gut zwanzig Jahren beinahe unbekannt in Moskau gestorben war, ein Bibliothekar des Rumjanzew-Museums, in dessen Lesesaal er der diensthabende Beamte gewesen war. Leo Tolstoi, in den Achtziger- und Neunzigerjahren ein häufiger Besucher der Rumjanzew-Bibliothek, diskutierte eifrig mit ihm, aber die Eitelkeit des weltberühmten Romanciers und Moralisten stieß Fedorow ab. Äußerlich das kratzige Hemd des Bauern tragen, ja, aber darunter die seidene Unterwäsche aus Frankreich – das war der Graf Tolstoi für ihn. Ein verlogener Heiliger, mochte sein Erfolg in den Gazetten Europas auch noch so gewaltig sein.
Ganz anders hingegen Fedorow, welcher asketisch und besitzlos gelebt hatte, darin ein Vorbild für seine wenigen existierenden Schüler, zu denen Duchow gehörte, und die alles daransetzten, die Lehren ihres Meisters allgemein bekannt zu machen.
«Hunger, Krankheit und Tod beherrschen das Dasein des Menschen. Nichts besitzt unsereins von sich aus, und das wenige, was er hat, seine physische Existenz, kann er jederzeit verlieren – die blinde, bewusstlose Natur ist ein Moloch, blind gebiert sie neues Leben, und blind reißt sie wieder alles in den Abgrund, was sie geschaffen hat. Lässt erblühen, um dann doch nur die Geschwüre und Spasmen, die Tumore und Zirrhosen gedeihen zu lassen, die das Leben wieder vernichten.»
So pflegte Duchow gerne auszuführen, und bei seinen Schilderungen spürte jeder seiner Zuhörer bald, wie es ihn selbst zu zwicken und zu zwacken begann, wie es in ihm wuchs und die todbringenden Kräfte der blinden Natur ihn in den Abgrund rissen. Der Mann war ein Prediger.
Die von Fedorow skizzierte kosmotellurische Wissenschaft und Kunst verfolge deshalb, so erklärte er, das einzige Ziel, das Elend des Menschen mit wissenschaftlich-technischen Mitteln zu überwinden. Erlösung und Gerechtigkeit könnten hier aber nicht allein durch die szientifische Neuschaffung des Menschen geschehen, sondern nur durch die vollständige Wiederherstellung aller jemals auf der Erde lebenden Menschen erreicht werden. Durch Sammeln, Aufspüren und Synthetisieren aller Teilchen, aus denen die Körper der einstmals Lebenden neu hergestellt würden.
«Was soll das schon für ein Sozialismus sein», pflegte Duchow zu sagen, «welcher sich erst in der Zukunft verwirklicht und den künftigen Generationen das Paradies auf Erden errichtet und endlich soziale Gerechtigkeit gewährt – während all die früher Lebenden leer ausgehen sollen? Eine schreiende Ungerechtigkeit! Der zukünftige Sozialismus darf nicht als eine Ausbeutung der Toten durch die Lebenden funktionieren.»
Diesem historischen Ungleichgewicht – das schon Dostojewski zu denken gegeben habe – würden die Fedorow-Anhänger durch die vollständige Wiederauferstehung aller jemals Lebenden begegnen. Schließlich sei jeder Mensch ausnahmslos Sohn oder Tochter, schon immer, weshalb alle Menschen die Verpflichtung hätten, sich geschwisterlich zusammenzuschließen, um die Verstorbenen wissenschaftlich wiedererstehen zu lassen – das nannte er das «Väterschaffen», das Otcetvorenie. Anstatt durch Geschlechtlichkeit immer neue Menschen zu zeugen, die dann wieder stürben, solle die Menschheit lernen, sich endlich sexuell zu enthalten, was ja schon die Heiligen empfohlen hätten, und dafür eben lieber mit den wissenschaftlichen Methoden der Neuzeit all die Generationen von Vätern und Müttern aus ihren Gräbern zu holen und damit nicht nur für ausreichende Bevölkerung der Erde, sondern auch für soziale Gerechtigkeit in einem umfassenden historischen Sinn zu sorgen.
Duchows blaues Primus-Flämmchen hatte nun endlich das Schmelzwasser zum Kochen gebracht, einige Blättchen Tee waren hineingesegelt, und über dem Blechgefäß dampften schwache Aromen in die eiskalte Luft der Behausung. Die aus Brettern gezimmerte Tür schwang auf, und Duchows Mitbewohner erschien, der nicht sehr groß gewachsene Timofei Jakowitsch Boluchin, schmal in den Schultern, Militärmantel, Matrosenmütze auf dem Kopf und die feingliedrigen Hände in löchrigen Handschuhen, die sogleich ein Tässchen Tee zu halten bekamen.
«Kalt draußen, was?», begrüßte ihn der Anführer in seiner majestätischen Flickenjacke.
«Och, Arkadi Tandorinowitsch», erwiderte der schmale Boluchin und zeigte ein entschlossenes, seemännisch-wettergegerbtes Grinsen, «das ist ja noch gar nichts dagegen, wenn die Sonne erst einmal erloschen sein wird. Dann wird es erst wahrhaft schattig werden. Dagegen ist es heute Morgen geradezu lind.»
«Glaubt ihm nicht, Arkadi», spottete Duchow, und sein zauseliger Bart machte eine schmatzende Bewegung, «dafür gibt es keinerlei Beweise.»
«Natürlich gibt es die – man nennt es EN-TRO-PIE. Und wir sind mitten darin. Zwanzig Millionen Jahre, so schätzt man, mehr nicht, und dann ist es vorbei mit unserer Sonne. Aus und für immer.»
In den Worten des nun wieder teeschlürfenden Boluchin hörte sich das an wie zwanzig Monate, zwanzig Wochen oder sogar zwanzig Tage – wie ein Zeitraum jedenfalls, den sie alle miteinander, wie sie hier zusammenstanden und ihren Tee ohne Marmelade schlürften, noch erleben würden. Bald schon. Ihr werdet sehen.
«Nichts im Universum kann verloren gehen, kein Teilchen …»
«Was denn für Teilchen?», reizte ihn Boluchin, der die Schwäche seines schon älteren Mitbewohners bezüglich physikalischer Begrifflichkeit genau kannte.
«Teilchenlein», erwiderte der Ex-Pope unbeirrt, strich sich stolz über das filzige Tau seines Bartes und funkelte dem maximal-futuristischen Dichter zu. Der schrieb am Logbuch des dreiundzwanzigsten Jahrhunderts, hatte eine eigene Lautsprache für die künftige interstellare Kommunikation entwickelt und liebte es über die Maßen, alle, die ihm in die Falle gingen, mit Begrifflichkeiten und ihren Untiefen und Unschärfen zu quälen. Aber nicht ihn, Duchow.
«Die Wissenschaft kennt jedes von ihnen mit Namen. Eine Sonne, die erkaltet, schafft dabei … gleichzeitig auch eine neue. Die … Grundteilchen müssen einfach nur wieder zusammengeholt und in der ursprünglichen Zusammensetzung synthetisiert werden.»
«Ach, Brüderchen», seufzte nun der Matrose Boluchin und legte seinem Obdachteiler die magere Hand auf den Rücken, «das mag zwar sein – irgendwo entsteht vielleicht wirklich eine neue Sonne. Das wird uns aber nichts nützen, wenn wir hier auf diesem zum Kältetod verdammten Planeten bleiben müssen. Begreif doch, dass wir Gestrandete sind. Wir sind Reisende, und nun halten wir eine kurze Einkehr auf dem Planeten des Kampfes, dem Planeten der Zerstörung – dem Planeten des Krieges. Zeit, dass wir uns davonmachen.»
In vertrautem und auch bestätigtem Einklang mit wichtigen Denkern des radikalen futuristischen Biokosmos, wie etwa Sweriatov, war Boluchin der Meinung, dass die Erde ein Schreckensort sei, zu dem schwerwiegenden Schicksal verdammt, zu dem zu werden, was Dante in der «Göttlichen Komödie» vorausgeahnt hatte: ein Planet aus Feuer und Eis, gefährlich, ungerecht und tödlich. Ein Ort, den es schleunigst zu verlassen gelte.
«Wenn wir es nicht schaffen, Raumschiffe zu bauen, werden wir hier zugrunde gehen. Du willst auf chemisch-synthetische Weise die Toten auferstehen lassen? Ein frommer Wunsch. Ich aber sage dir, was wir brauchen, das sind funktionierende Raketenantriebe.»
Das Gespräch zwischen den beiden so unterschiedlich denkenden Zusammenwohnern ging noch eine ganze Weile hin und her, streifte die diversesten Aspekte der mannigfaltigen Ungerechtigkeiten des Lebens auf dem Planeten und die verschiedenen Auswege, die ihnen offenzustehen schienen. Etwa: die Neuerschaffung passender Organe, mit denen man nicht nur Vorgänge in der Natur, sondern auch solche im atomaren Bereich würde wahrnehmen können. Die heilsame Wirkung systematischer Bluttransfusionen, von jungen Menschen auf alte und umgekehrt, wodurch sich für beide ein erheblicher, lebensverlängernder Gesundheitsvorteil ergäbe; und Boluchin wusste zu berichten, dass ein gewisser Doktor Voronow Affenhoden transplantiert und dadurch beeindruckende Ergebnisse der Verjüngung und Steigerung der Lebenskraft erzielt habe. Überhaupt – im Transplantieren liege vielleicht ohnedies das Geheimnis ewigen Lebens, unabhängig von der Wiederherstellung der bereits Gestorbenen.
«Wie man es auch nimmt, Genossen, da wir unseren Tee nun getrunken haben …», erwiderte Arkadi jetzt nachdenklich, stellte seinen Blechnapf auf die als Tisch fungierende löchrige Kiste und richtete sich auf. Gegen diesen unwiderstehlichen Drang, unter allen Umständen die Arbeit, die getan werden musste, zu verdrängen und beiseitezuschieben, um zuvor ein paar philosophische Probleme zu besprechen, hegte er einen tief sitzenden Widerwillen, der sich unterschiedlich bemerkbar machte. Manchmal als Wut, mal als depressive Resignation – heute Morgen aber eher als eine Art von Müdigkeit, der zugleich eine gewisse Heiterkeit innewohnte … eine milde Erschöpfung vielleicht, die das Erlebte abmilderte, wie ein Gläschen Wodka am frühen Morgen.
«Genossen, wenn wir nicht langsam loslegen, dann wird da heute zu annehmbarer Zeit kein Grab ausgehoben sein. Der Boden ist hart wie Stein, und das hinunter bis auf einen halben Arschin. Brechen wir auf.»
Auch Hundehund hatte, verborgen hinter einem Baum, den der Winter aller Blätter beraubt hatte, zunehmend ungeduldig auf die drei Totengräber gewartet, und als sie nun heraustraten, hüpfte er vor Freude. Sein lachender Windhund-Blick galt Arkadi, doch der maximal-futuristische Dichter Boluchin entdeckte ihn sogleich und zog eine eiskalte Kartoffel aus seinem Militärmantel, die Hundehund trotz seines Misstrauens nicht zu verschmähen vermochte. Boluchin kraulte ihn zudem auch noch hinter den Ohren.
«Armes Biest», kommentierte der zottelbärtige Duchow, der genau wie Fedorow ein strenger Vegetarier war, und warf einen mitleidigen Blick auf den hinkenden Köter, der die Kartoffel längst in seinen mageren Bauch geschlungen hatte.
«Wie viel Unglück und Schmerz herrschen nicht unter den Tieren … ein jedes quält das andere, sie fressen sich gegenseitig. Ein einziges Elend. Es wäre besser, wenn es keine Tiere mehr gäbe, überhaupt keine. Dann wäre auch ihr Leid zu Ende. Müsste unser Hündchen nicht mehr frieren und hinken.» Er seufzte.
«Dann los», sagte Arkadi, «vom Rumstehen wird das Elend der Welt auch nicht weniger.»
Also zogen die beiden Zusammenwohner den Schlitten mit dem Holz und dem Werkzeug an, der sich knirschend über den gefrorenen Grund in Bewegung setzte. Den Barsoi-Spross dazugerechnet, waren sie nun vier. Der Wind pfiff, Schneeflocken trieben ihnen ins Gesicht. Sie duckten sich, gingen, ohne anzuhalten, voran. Ein jeder hing seinen Gedanken nach. Arkadi, mit dem kindlichen Charakter seiner Genossen wohlvertraut, lief hinter den beiden, Hundehund trippelnd-hinkend neben ihm. Vier Totengräber.
Schon Alexander Sergejewitsch Puschkin hatte angemerkt, und zwar in seiner Erzählung «Der Sargmacher», dass es literarischen Autoren häufig eingefallen sei, Angehörige ebenjener Berufsstände entgegen ihrer eigentlichen Umstände, die ja nun immer mit Tod und Trauer zu tun hätten, als fröhliche und sogar witzige Charaktere zu schildern – um den Erwartungen des Publikums gerade in diesen heiklen Situationen eine unerwartete Wendung und einen anderen Ton zu geben. Denn, und darin stimmte Arkadi ganz mit dem legendären Dichter überein, es war schon wirklich komisch, zumindest fragwürdig, dass man überhaupt diesen abwertenden Namen tragen musste: Totengräber.
Denn für jeden, der die Wahrheit gehört hatte und sie auch glauben konnte, war das Grab ja doch eine Gebärmutter – denn würde man nicht zur Stunde daraus hervorgehen, um vor das Angesicht des Schöpfers zu treten, der auch der Richter war? Also war Totengräber mit Sicherheit der falsche Name – man war doch vielmehr Geburtshelfer. Hatte es nicht immer geheißen, in den alten Zeiten, die Arkadis Wissen nach Jahrhunderte gedauert hatten, dass der Sarg ein Wägelchen war, in dem es sich bequem fuhr?
Wie hatten sie einst als Kinder gesungen, während ein Mitglied des Dorfes in der Prozession bestattet worden war:
«Fahre hin, blasser Körper,
blasser Körper vieler Sünden.
Während du in der feuchten Erde liegen wirst,
rufen sie mich zum Gericht,
rufen mich zum Gericht vor Gott.»
Und wie leichthin hatte ihr Kinderchor von dieser Wehklage der Seele gesungen, die auf ihren alten, toten, irdischen Körper hinabblickt wie auf einen in den Graben gefahrenen Karren. Wie leicht war es als Kind, vom Tod zu singen …
Den naiven Glauben seiner Väter besaß Arkadi schon lange nicht mehr, dazu hatte er zu viel gesehen. Hatte wohl mitbekommen, wie die Revolution und ihre Herren, die Mehrheitssozialdemokraten, die sogenannten Bolschewiki, die alten, unverweslichen Heiligen der Orthodoxie ausgegraben und auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen und stattdessen Lenin inthronisiert hatten, die unverwesliche Leiche im gebügelten Anzug. Mysterien, Religion, Politik, Ideologie. Alles Trug. Eines Tages aber käme Lenin wieder als weiser Richter aus der Welt der Toten, um die Schurken und Verräter zu bestrafen. Denn an die Auferstehung glaubte Arkadi.
Eines fernen Tages, davon war er überzeugt – genauso, wie der von wissenschaftlicher, auf Teilchensynthese setzender Auferstehungssehnsucht durchdrungene ehemalige Pope Duchow oder der kosmonautische Neu-Dichter Boluchin, der von den Raumschiffen träumte, mit denen sich eine neue, planetarische Menschheit absetzen würde, um dem unausweichlichen Kältetod auf der alten Erde zu entgehen –, eines Tages also würden auch sie vier wiederkommen, würden auferstehen, aus dem Staub des Todes neu zusammengefügt, um vor den Augen der Welt wieder unbeirrt gegen den Moskauer Schneewind anzugehen. Und würde es auch noch ein wenig dauern: Sie kämen zurück. Würden eines fernen Tages wieder an diesem frostigen Morgen angelangt sein, den Schlitten mit Holz beladen daherziehen aus der Nacht ihrer Bewusstlosigkeit, würden wiederkommen, einer wie der andere, und sogar das Hündelchen würde erneut – von welcher Stimme, welchen Augen auch immer herbeigerufen und zum Leben ersehen – humpelnd um sie herumwuseln.
Dann waren sie da. In der Ferne schimmerten nächtlich matt die Kuppeln der Kirche des Gedenktags der Auferstehung. Eine Mauer und zwei lichtlose kleine Häuser, um deren Ecke sie noch biegen mussten. Kahl standen die Bäume, und vor ihnen lag das vom Schnee bedeckte Gräberfeld. Der Wagankowoer Friedhof.
Grab neben Grab, von zierlichen Metallzäunen umsäumt, Kreuze und selten mal eine Figur.
«Wohin, Kapitän?», fragte Boluchin, die Deichsel des Schlittens haltend. Mit dem löchrigen Handschuh seiner linken Hand wischte er sich einige beinahe schon gefrierende Tropfen von der Nase. Duchow hinter ihm schnaufte durch. Hundehund trat von einer seiner drei schmalen Pfoten auf die andere, da die Kälte beißend in sie hineinzog. Jedes Mal, wenn sie den Friedhof erreichten, packte den Hund ein kraftvoller Schauder. Die beinerne Welt, die schlummernden, vom Frost eingemauerten Knochenberge reizten ihn. Weckten zugleich seine Vorsicht. Kein einfacher Ort für den alten Köter. Hatte er hier einstmals ja schon geschmaust …
Arkadi holte das Schreiben der Verwaltung heraus, ein getipptes Formular, auf dem der Ort des auszuhebenden Grabes, dann der Auftraggeber – in diesem Falle, keineswegs ungewöhnlich, ein Komitee – sowie der Name der zu bestattenden Person angegeben war.
«Reissner, Larissa Michailowna, Abteilung 20 a)», las Arkadi laut und vernehmlich vor. Duchow wollte den Schlitten sogleich anziehen, aber der vorausgehende Kosmonaut und Dichter stand erstarrt. Der Schrecken war ihm durchs Rückgrat gefahren.
«Kann das sein, Kapitän», murmelte er und machte einen Schritt auf Arkadi zu, «kann’s wirklich sein, dass du gerade Larissa Michailowna Reissner gesagt hast?»
«Genauso ist es», erwiderte Arkadi. Er reichte Boluchin das Dokument, der holte seine Nickelbrille heraus, hielt das Formular nah an sein Gesicht und las für sich, was dort geschrieben stand. War wie gebannt. Damit es weiterging, übernahm Arkadi nun Boluchins Platz an der Deichsel und zog an.
«Hier gleich rein, und dann ein paar Reihen weiter vorne. Kanntest du diese Madame Reissner etwa?», fragte der zahnlose Anführer.
Boluchin nickte versonnen, murmelte Unverständliches vor sich hin, trottete hinter dem Leiterwagen her, von Hundehund beäugt, dem gleich auffiel, wie sonderbar der Kosmonaut sich benahm. Aber der brauchte noch ein wenig Zeit, seine Erinnerungen zu ordnen.