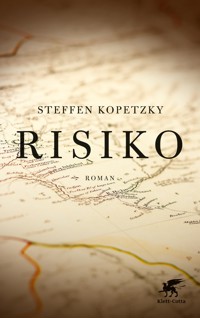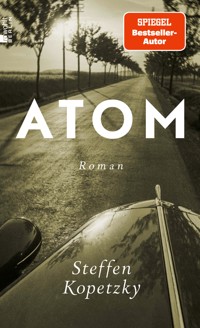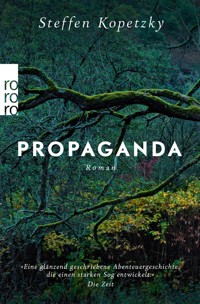
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
John Glueck ist im Krieg. Tief in Deutschland, im dunklen Hürtgenwald in der Eifel, 1944. Vor kurzem noch war er Student in New York, voller Liebe zur deutschen Kultur seiner Vorfahren; dann, als Offizier bei Sykewar, der Propaganda-Abteilung der US-Army, traf Glueck in Frankreich sein Idol Ernest Hemingway. Für ihn zieht Glueck in den scheinbar unbedeutenden, doch von der Wehrmacht eisern verteidigten Hürtgenwald bei Aachen. Er entdeckt das Geheimnis des Waldes, als eine der größten Katastrophen des Zweiten Weltkriegs beginnt: die «Allerseelenschlacht» mit über 15 000 Toten. Was kann John Glueck noch retten? Sein Kamerad Van, der waldkundige Seneca-Indianer? Seine halsbrecherischen Deutschkenntnisse? Ein Wunder? Niemand trat unverändert wieder aus dem «Blutwald» heraus, den die Ignoranz der Generäle zu einem Menetekel auch folgender Kriege machte. Zwanzig Jahre später, in Vietnam, erfährt John Glueck: Die Politik ist zynisch und verlogen wie eh und je. Er wird handeln, und sein Weg führt von der vergessenen Waldschlacht direkt zu den Pentagon-Papers. Steffen Kopetzkys großer Roman spannt einen gewaltigen Bogen vom Zweiten Weltkrieg bis hin zu Vietnam. Ungeheuer spannend erzählt er von Krieg und Lüge, und von einem Mann, der alle falsche Wahrheit hinter sich lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Steffen Kopetzky
Propaganda
Roman
Über dieses Buch
John Glueck ist im Krieg. Tief in Deutschland, im dunklen Hürtgenwald in der Eifel, 1944. Vor kurzem noch war er Student in New York, voller Liebe zur deutschen Kultur seiner Vorfahren; dann, als Offizier bei Sykewar, der Propaganda-Abteilung der US-Army, traf Glueck in Frankreich sein Idol Ernest Hemingway. Für ihn zieht Glueck in den scheinbar unbedeutenden, doch von der Wehrmacht eisern verteidigten Hürtgenwald bei Aachen. Er entdeckt das Geheimnis des Waldes, als eine der größten Katastrophen des Zweiten Weltkriegs beginnt: die «Allerseelenschlacht» mit über 15 000 Toten. Was kann John Glueck noch retten? Sein Kamerad Van, der waldkundige Seneca-Indianer? Seine halsbrecherischen Deutschkenntnisse? Ein Wunder?
Niemand trat unverändert wieder aus dem «Blutwald» heraus, den die Ignoranz der Generäle zu einem Menetekel auch folgender Kriege machte. Zwanzig Jahre später, in Vietnam, erfährt John Glueck: Die Politik ist zynisch und verlogen wie eh und je. Er wird handeln, und sein Weg führt von der vergessenen Waldschlacht direkt zu den Pentagon-Papers.
Steffen Kopetzkys großer Roman spannt einen gewaltigen Bogen vom Zweiten Weltkrieg bis hin zu Vietnam. Ungeheuer spannend erzählt er von Krieg und Lüge, und von einem Mann, der alle falsche Wahrheit hinter sich lässt.
Vita
Steffen Kopetzky, geboren 1971, ist Autor von Romanen, Erzählungen, Hörspielen und Theaterstücken. Sein letzter Roman «Risiko» (2015) stand monatelang auf der «Spiegel»-Bestsellerliste und war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Von 2002 bis 2008 war Kopetzky künstlerischer Leiter der Theater-Biennale Bonn. Er lebt mit seiner Familie in seiner Heimatstadt Pfaffenhofen an der Ilm.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung schnuddel/iStock
ISBN 978-3-644-10088-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Dem liebenden Andenken meines Vaters
Walter Kopetzky,
eines großen Bewunderers
amerikanischen
Werkzeugs
I’ve looked at life from both sides now.
JONI MITCHELL
Wenn ich daran denke, wie alles begann, sehe ich mich vor einem Lastwagen stehen, der mehr als zwei Tage ohne Unterbrechung gelaufen war. Wir schrieben Oktober 1944 in der Nordeifel, einem zerklüfteten Mittelgebirge, das in den Karten unserer Armeeführung Huertgen Forest genannt wurde, weil man nicht wusste, wie die Deutschen es nannten. Nicht einmal Experten wie mir war bekannt, dass dieses Waldgebiet bei den Einheimischen eigentlich bloß Staatsforst hieß. Hürtgen war ein Dorf mittendrin, dessen Name wir kannten. So wurde daraus der Huertgen Forest, genau wie wir einstmals ein neues Territorium einfach nach dem Indianerstamm benannten, mit dem wir es dort zuerst zu tun bekommen hatten.
«Ich bleibe hier», sagte ich zu Technical Sergeant Washington. «Vielen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben.»
«War mir eine Freude, John.»
Wir schlugen ein. Was für unglaubliche Hände der Kerl hatte! Groß, aber nicht plump, sondern länglich und wohlgeformt, geschmeidig, seidig wie die einer Frau, spürbar geschickt und stark. Pianistenhände.
«John, überlegen Sie, ob Sie nicht einfach wieder mit mir mitkommen wollen. Sehen Sie sich doch um, wie es hier aussieht … Hab ich recht? Hier an der Siegfriedlinie, mein ich.»
Ich erinnere mich bis heute an das feingliedrige Netz roter Äderchen, die sein Augapfelweiß durchzogen.
«Ich fahre den Laster, wie Sie ja wissen, schon eine ganze Weile. Ich weiß, was die von oben hier reinpumpen. Und ich weiß auch, was hier rauskommt. Hab die Särge aus dem Hürtgenwald gesehen, in Cherryburg. Bald wird es einen eigenen Friedhof geben. John, Sie müssen doch nicht hierbleiben, keiner kann Sie zwingen. Kommen Sie wieder mit. Dieses Gebirge hier, dieser Wald. Verflucht. Das Sterben hat grad erst begonnen, wenn Sie mich fragen.»
«Das ist genau der Grund, warum ich hier sein muss. Aber danke!»
Noch einmal drückte er meine Hände, aber als er spürte, dass mein Entschluss stand, löste er sie.
Erste Schneeflocken sanken zur Erde.
«Leben Sie wohl, John, und Gott beschütze Sie!»
«Auf Wiedersehen, Moon.»
Ich sah ihm nach, bis der Lastwagen am Ende der Piste zum Stehen kam, um sich nach einer Weile in die Kolonne des Red Ball Express einzureihen, der ohne Unterbrechung, Tag und Nacht, quer durch Frankreich, Belgien und Luxemburg rollte, um den unfasslichen Bedarf unserer breit wie eine Ozeanwelle nach Osten flutenden Armee an jeder Art von Material zu decken. Unbeseeltem und lebendem.
Wir waren bei Germeter, im Bereich der 28. Division, die abgelöst hatte, was von der 9. Division noch übrig war. Merkwürdigerweise kam die 28. aus Pennsylvania. Ich habe dort Wurzeln, meine Mutter war Pennsilfaanier-Deitsche. Ich beeilte mich, zum Kompaniechef dieses Abschnitts zu kommen. Einem aus Philadelphia stammenden Italiener namens Captain Oleandro, dem ich meinen Marschbefehl der Sonderklasse zeigte und erklärte, dass ich mich bei ihm umschauen und auch ein paar Tage bleiben würde.
«Wollen Sie hier Urlaub machen?»
«Haben Sie Einwände?»
«Überhaupt nicht.» Er kaute so energisch auf seinem Bleistift herum, dass man es krachen hörte.
«Kein Problemo. Die Jerrys haben genügend Granaten für uns alle. Keiner kommt zu kurz. Da finden Sie gewiss tolle Geschichten für Ihre Zeitung.»
«Wir sehen uns später», sagte ich, ließ mein Gepäck im Zelt des Captains und mischte mich unter die frisch eingetroffenen Männer. Ich stieß auf einen Trupp waschechter Pennsilfaanier, die drauf und dran waren, in den Wald hineinzugehen.
«A Schtund», schrie der Sergeant auf Deitsch, «bleibts ma all schee zamme.»
Die Privates folgten ihm, die Karabiner im Anschlag, wie ein Pfadfinderfähnlein beim Geländespiel.
Diesen Weg war ich in Gedanken gleichsam Hunderttausende Mal gegangen. Deutschland! Jetzt setzte ich meine ersten Schritte auf das mythische Land meiner Vorfahren.
Die offizielle Alt-Reichsgrenze hatte ich im Lastwagen von Sergeant Washington überschritten. Wir waren an großen Warnschildern für die Truppen vorbeigekommen:
You are entering Germany!
Doch nun stand ich nicht nur mit meinen eigenen Füßen auf deutschem Boden, sondern ging sogar durch einen deutschen Wald, der ein schroffes, aber nicht allzu hohes Gebirge bedeckte, die Nordeifel südlich von Aachen. Hinter dem finsteren Forst lag der Rhein und an diesem die deutsche Stadt, die mir am meisten bedeutete: Köln.
Wir liefen etwa zwanzig Minuten, dann entdeckten wir den unter zerfetzten Bäumen und auf herausgebombten Schneisen liegenden Abschnitt des Schlachtfelds. Es war schon merklich dunkel.
Was hier vor wenigen Tagen geschehen war, überstieg damals noch unsere Vorstellungskraft. Was Granaten anrichteten, die hundert Jahre alte Fichten zu einem Splitterregen zerfetzten, der alles niedermähte, was sich unter ihm aufhielt. Die Panik, die Baumscharfschützen auslösen können oder sorgsam angelegte Tretminenfelder. Und schließlich der Kampf Mann gegen Mann, im dichten Unterholz, in einem grotesk unübersichtlichen Kleingebirge.
Wer sich hier auskannte, war immer im Vorteil. Dies war der Hürtgenwald. Ein grimmer deutscher Wald. Und es waren die letzten, aber auch die kampferfahrensten Truppen der Wehrmacht, die ihn gegen uns verteidigten.
Ich folgte zwei unbekümmerten Privates, die wie alte Freunde wirkten. Sie hatten die Karabiner hinten umgeschnallt und liefen umher wie Kinder, die Schnecken oder Pilze sammeln. Nachdem sie schon das eine oder andere vom Boden aufgelesen hatten, wurden sie plötzlich richtig fündig.
Der schlammige, halbgefrorene Waldboden leistete einigen Widerstand, und so zerrten sie mit vereinten Kräften an etwas, das sie als Arm eines Angehörigen der deutschen Wehrmacht ausgemacht hatten. Schwer zu sagen, wie der Landser getötet worden war. Die Ketten eines schweren Fahrzeugs, vielleicht eines Sherman-Panzers, hatten ihn in der von Granat- und Mörsereinschlägen aufgewühlten Schneise tief in den Boden gedrückt.
Ich kann mich gut an die Namen der beiden Pennsylvanier erinnern: Kirschfang und Showalter. Kirschfang stand über den Toten gebeugt und zerrte zusammen mit seinem Kameraden am nassgrauen Mantelstoff des linken Oberarms. Er bekam die eiskalte, schlammüberzogene Hand des Gefallenen zu fassen, berührte ihre schreckliche Teigigkeit, dann packte er sie und zog, so fest er konnte. Mit einem tiefen Seufzen gab die Erde den Brustkorb frei. Sie drehten den Leichnam auf den Rücken. Der Arm des Landsers fiel mit einem satten Schmatzen in den Schlamm. Kirschfang zog keuchend eine Taschenlampe hervor. Ihr Lichtschein huschte für einen kurzen Moment über das von einem Stahlhelm bedeckte Haupt des Deutschen, und wir sahen sein Gesicht. Oder was davon halt so übrig war.
Unterhalb der Nase war das meiste weg, kein Kiefer mehr da, ein paar Zähne standen im hautlosen Knochenfleisch heraus. Der Tote sah aus wie Red Skull persönlich. Ein Schaudern überlief uns.
Private Kirschfang sagte nichts, aber dafür Showalter. Sein Gesicht sehe ich genau vor mir. Diese lange Nase. Die rötlichen Augenbrauen. Ein Schmerz nachträglicher Empathie durchzuckte ihn. Er schluchzte mehr, als er murmelte: eine mitfühlende Obszönität. Dann wanderte der enge Lichtkreis der Taschenlampe über den Mantelkragen, aufgequollen und schwarz von Nässe. Der oberste Kragenknopf war offen, das Licht fuhr die Knopfleiste auf und ab, und Showalter kniete sich nieder und begann, dem Gefallenen den Mantel aufzuknöpfen.
«Jessas Maria, was für ei Muckadatsch hätt dem die Fress poliert», murmelte er, während er systematisch mit seinem Messer einen Knopf nach dem anderen vom Mantel schnitt. Wehrmachts-Uniformknöpfe wurden gesammelt.
Hätte ich dem allen nicht selber beigewohnt, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich war entsetzt und gebannt gleichermaßen. Dies war tatsächlich der Ort, nach dem Hemingway und ich gesucht hatten. Ich war angekommen.
Showalter öffnete den Mantel, die Lampe spielte über das darunterliegende Tuch der Uniformjacke. Metallisches Blitzen. Er griff sofort zu, entfernte geschickt die drei Auszeichnungen von der Uniform des Toten und hielt sie ins Licht.
«Was hem me?», fragte Kirschfang.
«Wiederholungsspang, desch Abzeiche füa de Teilnahm Winterschlacht von Kursk und ei Eisern Kreuz zweite Klass. Kei Hagkekreuz. Hagkekreuz is nua auf dera Spang.»
«Heb ich dirs ned gsacht?»
«Jo, bischd ei ganz gescheids Yingschi», bestätigte Showalter, ließ die beiden Auszeichnungen in sein Säckchen fallen, in dem schon eine Nahkampfspange und drei Infanterie-Sturmabzeichen, eines davon in Silber, verschwunden waren. Das der Beute nun hinzugefügte Eiserne Kreuz des Russlandveteranen war, wenn auch offensichtlich schon aus dem Ersten Weltkrieg, das bisher wertvollste Stück. Sie würden sich darüber unterhalten müssen, wer es bekommen würde, um es zu Hause der Familie zeigen zu können. Vielleicht würden sie eine Münze werfen.
Im Wald um uns herum hörten wir die anderen flüstern. Und das Knacken von Ästen. Alle suchten nach Trophäen. Am Morgen angekommen, war dies ihr erster Ausflug in einen Abschnitt, an dem erst kürzlich heftige Kampfhandlungen stattgefunden hatten.
Der Anblick ihrer Vorgänger von der 9. Division, also derjenigen, die noch lebten, hatte bei den Neuankömmlingen ungläubiges Staunen ausgelöst, wie bei mir auch. Völlig verdreckt hatten die aus der Schlacht kommenden Soldaten sich auf die Lastwagen geschleppt, auf denen ihre Ablösung gerade hergekommen war. Die Scheidenden alle wie abwesend, gleichgültig, scheinbar nicht einmal froh, abgezogen zu werden.
Wir Neuen betrachteten diesen Abtransport der ausgebrannten eigenen Leute ungläubig, manche begriffen gar nicht, dass sie tatsächlich auf amerikanische Soldaten blickten, die gerade eine verheerende Niederlage erlitten hatten. Denn keiner von den jungen Pennsylvaniern, die jetzt durch den deutschen Wald streiften, um nach Andenken zu suchen, hatte je davon gehört, dass Amerikaner jemals eine Schlacht verloren hätten.
Sie waren Geschöpfe des Neunzigtagewunders, jener erstaunlichen Fähigkeit ihrer Ausbilder, binnen der kurzen Zeit von drei Monaten aus Collegeboys, frisch approbierten Zahnärzten und ungelernten Bauarbeitern voll einsatzfähige Soldaten zu machen. Angehörige einer der größten militärischen Organisationen, die es je auf dem Planeten Erde gegeben hat: der Armee der Vereinigten Staaten von Amerika.
Auch ich war ein Angehöriger dieser Armee. Leutnant John Glueck, Department for Psychological Warfare, kurz Sykewar. Psychologische Kriegsführung.
Alle anderen nannten uns Propaganda.
Erster Teil
In einer Haut zu stecken, die man selber nicht mehr als seine eigene erkennt, die man abscheulich findet: Das ist, als wäre man lebend eingemauert und dennoch unter Leuten. Sie starren dich an, und du würdest ihnen am liebsten «Ich bin es nicht» zuschreien, «glaubt mir, ihr seht jemanden oder etwas vor euch, das ich nicht bin».
Die abscheuliche Haut hat nichts mit mir zu tun, denn ich habe sie ja erst seit kurzem, diese sich selbst abstoßende, schuppenartig sich schälende Haut, die Folge einer durch einen chemischen Schock ausgelösten Krankheit. Über fünfundvierzig Jahre lang aber war ich ein Mann, den man gerne ansah. Frauen haben es mir gesagt, und oft spürte ich es auch, dass sie mich attraktiv fanden. Zumindest gutaussehend.
Aber dann hatte ich einen Unfall mit Entlaubungsmitteln in hoher Konzentration und bekam diese chronische Hautkrankheit. Es ist ein paar Jahre her. Doch wer mich heute sieht und nicht von früher kennt, würde niemals mehr denken, dass ich einmal einen makellosen Teint hatte. Dass es vielen Frauen jeden Alters wie nebenbei in den Sinn kam, mir ihre Hand für einen Moment auf den Unterarm zu legen oder zum Abschied Wangenküsse zu tauschen. Männer begrüßten mich gerne jovial per Handschlag oder klopften mir auf die Schulter. Das macht heute niemand mehr einfach so.
Unter dem chemischen Schock hing meine Haut in Fetzen, heilte aber nicht mehr richtig ab, sondern entwickelte wunde Stellen, hornig und nässend zugleich. Zuweilen sehr stark juckend. Schließlich, nach vielleicht vier bis fünf Wochen der Reife, hatte ich nach einem fürchterlichen Juckreizanfall plötzlich eine Art von gigantischer Hautschuppe in der Hand. Mein Arzt hatte so etwas noch nie gesehen. Er prophezeite mir, dass sich die besten Dermatologen der Welt um meine Haut reißen würden.
Unter der abgefallenen Schuppe schien sich schon die nächste zu bilden, und dummerweise fing es gleich daneben auch bereits an. Die Krankheit breitete sich aus und hat mittlerweile, vom Gesicht abgesehen, fast meine ganze Haut erfasst. Rot. Schorfig. Schuppig. Eine abartige Form von schuppenproduzierender Psoriasis. Das Einzige, was mich bei meinem Äußeren selber noch an früher erinnert, sind Nägel und Haar. Ich feile und pflege deshalb meine Nägel, und ich lasse niemanden an mein Haar, das silbergrau und mittlerweile ziemlich lang ist, aber sonst eben noch immer ganz und gar so, wie es einst war. Es ist, als ob ich mich daran in eine bessere Zeit hinablassen könnte. So soll es auch bleiben. Könnte sein, dass mir das noch Ärger machen wird bei dem, was ansteht.
«Ihr Auto ist in einer bewachten Polizeigarage abgestellt. Offiziell beschlagnahmt. Alle Türen versiegelt. Wegen des Wagens müssen Sie sich also keine Sorgen machen.» Kaetlin Lambert ist meine vom Staat Missouri gestellte Pflichtverteidigerin. Kat.
Ich überlege, Kat ganz offen zu sagen, was sich im Kofferraum befindet, aber dann verzichte ich darauf, um sie nicht noch mehr zu verwirren. Ein Schritt nach dem anderen.
«Aber jetzt bitte zurück und von vorne», sagt sie und überfliegt noch einmal die zwei Seiten lange Aussage des Offiziers der Missouri Highway Patrol, der mich verhaftet hat. Täusche ich mich, oder vermeidet sie es, mich anzusehen?
«Sie waren viel, viel zu schnell. Seit Gouverneur Hearnes das Tempolimit durchgesetzt hat, ist das in Missouri keine Kleinigkeit mehr.»
«Ich weiß. Hearnes ist ein Umweltschützer. Progressiv.»
«Progressiv oder nicht: Er ist vor allem der Gouverneur und macht die Gesetze. Also. Sie haben dann trotz Blaulicht nicht gestoppt.»
«Ich habe ihn nach einer Weile rankommen lassen und bin dann langsamer geworden.»
«Gut. Als er Sie also gestoppt und aufgefordert hatte, ihm Ihre Papiere auszuhändigen, haben Sie behauptet, Sie hätten zwar keinen Führerschein, aber stattdessen eine geladene Waffe, auf die Sie dann auch gezeigt hätten.»
«Sie steckte im Brustgurt. Keine Gefahr.»
Jetzt hebt sie ihren Kopf, streicht sich mit der rechten Hand, in der sie auch den Kugelschreiber hält, ein paar Strähnen hinters Ohr, blickt auf und sieht mir ins Gesicht. Sie hat vielleicht zu wenig geschlafen, was feine Schatten unter ihre Augen malt. Sie stützt ihr Kinn auf die Kugelschreiberhand und betrachtet mich nachdenklich. Legt interessiert ihren Kopf in den Nacken. Wie lange wird sie es wohl aushalten, mich direkt anzusehen?
«Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie vor nicht allzu langer Zeit noch in Vietnam waren.»
«Das ist richtig.»
«Als Sie im Auto die Waffe ins Spiel gebracht haben … hatte das mit Vietnam zu tun?»
«Im weitesten Sinne. Aber der Verweis auf die Waffe war natürlich taktischer Natur.»
Jetzt kneift sie die Augen zu und schüttelt skeptisch, leicht lächelnd den Kopf. Was soll das?, scheint sie sagen zu wollen.
«Was haben Sie in Vietnam getan, Major? Ein Kampfeinsatz?»
«Ich habe geforscht.»
«Geforscht? Geheimdienst?»
«Evaluierung und quantitative Marktforschung.»
«Wie darf ich mir das vorstellen?»
«Interviews. Gespräche. Fragebogen. Ich habe versucht, herauszufinden, was die Vietnamesen über uns denken.»
«Und was denken die Vietnamesen über uns?»
«Dass wir nicht wissen, mit wem wir uns eingelassen haben.»
Kat sinniert ein paar Sekunden über meine Antwort. Sie lächelt.
«Wieso haben Sie die Waffe gezogen?»
«Ich habe nur deutlich gemacht, dass ich eine habe.»
«Sie hätten leicht angeschossen werden können. Wofür das hohe Risiko?»
Ich glaube, Kat ist eine gute Anwältin. Sehr engagiert. Ich spüre förmlich, dass sie dem hautkranken Freak, der gestern in Offiziersuniform hinter dem Steuer eines himmelblauen Ford Zephyr festgenommen wurde, ohne Führerschein, aber mit durchgeladener Waffe, eine echte Chance geben will. Ich werde beschuldigt, ein Täter zu sein, aber in Kats Augen bin ich auch ein Opfer. Sie wird mich ernsthaft verteidigen, das ist klar zu spüren. Sie wird mehr als ihre Pflicht tun. Sie ist eine Verbündete. Und vielleicht möchte sie auch ein klein wenig verstehen, wer ich bin und was ich tatsächlich getan habe. Ich bin immerhin ein hochdekorierter Offizier der US-Armee.
Wenn ich ihr die Wahrheit erzählen würde, nämlich dass mir Agenten der Bundesregierung heimlich LSD in mein Abendessen gaben, um mich verrückt und fertigzumachen, dass dieser ungewollte Trip mich aber erst auf die Idee mit dem Zephyr brachte, würde sie fragen: Sind Sie sicher, dass es diesen Agenten nicht vielleicht gelungen ist? Also sage ich kein Wort darüber.
Dann betritt der Hilfssheriff den Raum und will mir die Handschellen anlegen.
«Bitte», sagt sie, «geben Sie uns noch eine Minute.»
«Gut. Aber keine Sekunde mehr. Ich lasse den Richter nicht gerne warten.» Er macht die Tür hinter sich zu.
Meine Anwältin beugt sich ein wenig vor, und der Indianerschmuck, den sie über ihrer Rüschenbluse trägt, klimpert. Sie scheint jetzt wirklich interessiert an der Sache.
«Ich kann Sie da rausholen. Aber irgendetwas sagt mir, dass Sie das überhaupt nicht wollen. Das mit der Pistole, das haben Sie gemacht, um die Sache eskalieren zu lassen. Stimmt’s?»
«Ich brauche nur etwas Zeit.»
«Zeit? Im Knast? Der Richter wird eine Kaution festsetzen. Ich könnte Ihnen dabei helfen, das Geld aufzutreiben, wenn das das Problem ist. Ich kenne jemanden.»
«Ich werde keine Kaution stellen. Noch nicht.»
«Und Ihre …» Sie sieht ein wenig an mir herab, mit einem leicht sorgenvollen Mund.
«Sie sind doch. Schwer …»
«Hautkrank? Ja, das bin ich. Aber es gibt keine Therapie. Spielt keine Rolle, wo ich mich aufhalte.»
«Sie werden in ein staatliches Gefängnis kommen. Wahrscheinlich hier in Hannibal. Das wird kein Vergnügen, da hört man nichts Gutes.»
«Ich werde schon klarkommen. Aber wenn Sie mir helfen wollen, dann nehmen Sie bitte diesen Schließfachschlüssel an sich und sagen niemandem, dass Sie ihn haben.» Und mit diesen Worten überwinde ich meine Schüchternheit und drücke ihr den Schlüssel in die Hand. Es ist ein typischer Schlüssel, wie man sie von Bahnhöfen kennt. Nummer 261. Aber es findet sich kein Hinweis auf den Standort des Schließfachs.
Sie ist ein klein wenig erschrocken, wirft mir einen scharfen Blick zu, bevor sie den Schlüssel schließlich, ohne ein Wort darüber zu verlieren, in ihre Wildlederhandtasche steckt. Ich habe ihr gerade meinen wichtigsten Trumpf übergeben.
Dann kommt der Deputy herein und tritt an den Tisch. Er nickt der Anwältin zu, und ich halte ihm gleichmütig meine Handgelenke hin. Er verzieht ganz leicht den Mund und versucht, meine Haut nicht zu berühren, während er die Fesseln um sie schließt.
Als ich noch ein Junge von elf oder zwölf war, in den frühen dreißiger Jahren in New York, zur Zeit der großen Wirtschaftskrise, spielten wir tatsächlich sehr oft Gangster. Neben Auflauern, Schutzgeldeintreiben, Einen-Überfall-Durchführen und Verfolgtwerden liebte ich besonders Ins-Gefängnis-Kommen.
Manchmal wurden wir in Fol-Som Pri-Son inhaftiert: vier Silben Willkür und Unterdrückung. Wir pafften aufgesammelte Zigarrenkippen und taten so, als seien es Opiumpfeifen. Dann wieder brachen wir aus dem stahlsilbrigen Star der amerikanischen Gefängnisse aus, dem nagelneuen Alcatraz. Unser Favorit aber war Sing-Sing, eine lokalpatriotische Selbstverständlichkeit. Denn nicht selten führten uns die Gangsterspiele an Sommernachmittagen durch das ganze Viertel und an den Fluss und endeten in Gedanken an jenem allerdüstersten Gebäude oberhalb des Hudson, dieser Ordensburg des Verbrechens.
Besonders gruselig waren Sing-Sings Mauern für mich auch deshalb, weil sie von seinen Insassen selbst errichtet worden waren, welche sich also gleichsam mit den eigenen Händen eingemauert hatten, um danach zusammengenommen Tausende, ja Hunderttausende Jahre von Kerkerhaft darin zu verbringen.
Doing Time.
Während die ägyptischen Gemüsehändler auf der Bowery dem Welken ihres Lettuce zusahen, hockten die Gefangenen in den Zellen oder liefen in stupidem Entenmarsch durch den Hof, eine Akkumulation von Lebenszeit, nachmittags und abends, Tausende von Stunden, die während einer normalen Stunde New Yorker Ortszeit dort abgesessen wurden und vergingen.
Nicht, dass ich als Kind das Bedürfnis verspürt hätte, mein Leben dem Verbrechen zu widmen, gar Berufskrimineller zu werden und ein Gefängnis möglichst bald von innen kennenzulernen. Aber wie die Rimbaud’sche Pflaume fühlte ich mich reif und bereit, jedem Schlag, jeder Verletzung, jedem Unrecht zu trotzen, und ich konnte mir kein noch so düsteres Schicksal vorstellen, über das ich nicht schließlich triumphiert hätte.
Ich hatte die lebhafte Phantasie, als ein amerikanischer Graf von Monte Christo ein paar Jahre nicht auf einer abgelegenen mediterranen Insel, sondern Up the River zu verbringen, natürlich zu Unrecht. Schließlich würde ich muskelgestählt, mit sämtlichen Kampftechniken der New Yorker Unterwelt vertraut und ein bedeutendes Romanmanuskript im Gepäck – denn dass ich dort neben den täglichen Kämpfen ums pure Überleben und meinem Training ausschließlich schreiben, die Geschichte meines abenteuerlichen Lebens erzählen würde, erschien mir selbstverständlich – die stählernen Tore Sing-Sings hinter mir lassen. Zuerst würde ich Rache an meinen Feinden nehmen, danach ein gefeierter Schriftsteller werden, der ein Apartment im Dakota beziehen würde, um dann irgendwann mit einem Luxusdampfer nach Hamburg zu reisen, in das geheimnisvolle Land meiner Vorfahren. Dort würde ich einen Schlafwagenzug nach Südeuropa besteigen, Madrid, Rom oder Istanbul sehen und eine Villa am Meer erwerben, um meiner Mutter eine Freude zu machen.
Sport, Nahkampftraining, Schreiben und dabei noch die Kinderzeit mit ihren hinderlichen Beschränkungen hinter mir zu lassen, das war die Formel, die mich stimulierte, mit meinen Kumpels aus der Nachbarschaft, sooft es ging, Verfolgung und Inhaftierung zu spielen. Hausecken, Gemüsekisten und Fischstände waren die Gefängnismauern, hinter die man uns gesperrt hatte. Es gab fiese Gerüche, die einiges erzählten. Ecken mit Geschichte. Hinterhöfe voller Innenleben. Wir kauerten zwischen fortgeworfenen Austernschalen, schmiedeten Ausbruchspläne und freuten uns, wenn tatsächlich mal ein oder zwei Cops mit schwingenden Knüppeln vorübergingen, die dann die Wärter darstellten, die wir gleich übertölpeln würden.
Oft steckte ich noch spätnachts in meiner Rolle, wenn ich längst mit sorgsam geschrubbten Knien im Bett lag, gegen den heranrückenden Schlummer ankämpfte und mir vorstellte, die Gespräche an der Haustür, die meine Mutter abends manchmal zu führen hatte, wären ihre Bemühungen, mich aus der Haft zu bekommen. Sie verhandelte mit dem Staatsanwalt, wenn sie in Wahrheit mit einem Handwerker herumstritt, der auf Vorkasse bestand und sonst am nächsten Tag nicht wiederkommen wollte, um die neue Wasserleitung fertig zu montieren. Da sie sich selbst trotz unserer finanziellen Schwierigkeiten keine Unkorrektheit erlaubte, war sie unerbittlich. Der liebe Gott habe ihr wenige Dollar, aber einen langen Atem gegeben, sagte sie immer.
«Nur weil man eine alleinerziehende Frau ist, eine Witwe noch dazu, glauben viele, sie könnten einen übers Ohr hauen. Aber nicht mit mir. Ich weiß, was ein Klempner verdient. Ehrlich währt am längsten, John, mein lieber Junge, merk dir das!», pflegte sie dann noch zu sagen. Damit beschloss sie grundsätzlich jede Ermahnung. Ehrlich währt am längsten.
Dem habe ich immer zu folgen gesucht, und wenn ich einmal lügen musste, dann nur aus ehrbaren oder lebenswichtigen Motiven heraus. Dass mich nun aber gerade der Versuch radikaler Ehrlichkeit ins Gefängnis bringt, ist eine Ironie unserer Zeit und eine Pointe meiner eigenen Lebensgeschichte. Und auch, dass das erste reguläre Gefängnis, dessen Insasse ich werde, am Mississippi liegt und nicht am Hudson.
Zumindest fürs Erste, denn wer weiß, wann die Spezialisten aus dem Weißen Haus meine Verlegung in ein Bundesgefängnis verlangen werden? Bis dahin aber trage ich, John Glueck, geboren am 13. Juni 1921 in New York und mithin also neunundvierzig Jahre alt, geschieden, Angestellter einer Non-Profit-Organisation namens RAND Corporation, wohnhaft in Santa Monica, Kalifornien, die fröhliche grün-orangefarbene Kleidung der Missouri Correction Authority.
Der Raum ist sauber und freundlich. An der strahlend weißen Wand hängt das neu herausgebrachte offizielle Plakat der NASA zu Apollo 14, das dem Para-Gedankenexperiment des Astronauten Mitchell gewidmet ist, der am 8. und 9. Februar Psi-Signale zur Erde geschickt hatte, die tatsächlich von vier Sensitiven auf vier Kontinenten empfangen worden waren.
Der Gefängnisdirektor persönlich händigt sie mir aus. Hunerwadel, der sämtlichen Formalitäten meiner Einlieferung beiwohnt, da ein echter Major der US-Army etwas Besonderes ist unter den Ladendieben, Vergewaltigern, Drogentypen und jenen zuletzt so stark vermehrten, von den normalen Insassen Drafties genannten Kriegsdienstverweigerern, die weder die Chuzpe besitzen, nach Kanada oder Mexiko zu fliehen, noch ein Elternhaus mit genügend Einfluss und die deshalb ins Gefängnis müssen.
So viele Möglichkeiten, inhaftiert zu werden, wie heute gab es noch nie.
Direktor Hunerwadel, eindeutig zu jung, um selber ein Veteran des Zweiten Weltkriegs zu sein, betrachtet meine Personalien längere Zeit, dann fragt er mich, wo ich überall gewesen bin.
«England. Frankreich. Dann an der Siegfriedlinie: Hürtgenwald.»
«Der Hürtgenwald, wirklich …», stellt er fest, innerlich beinahe strammstehend. «Da haben Sie wohl einiges gesehen?»
Es wäre jetzt korrekt, Direktor Hunerwadel ernst in seine schon ein wenig aufgeschwemmte, aber treu dreinblickende Augenlandschaft zu schauen (auf der linken Wange eine große, vorragende Warze, bei deren Anblick ich mir unwillkürlich vorstellen muss, wie schrecklich es wäre, sie beim Rasieren einzuschäumen und versehentlich abzusäbeln) und ihm wahrheitsgemäß mitzuteilen, dass ich ohne den Hürtgenwald vermutlich nicht hier vor ihm stünde, dass es tatsächlich der Hürtgenwald war, der mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Dort wurde ich zurechtgeschmiedet.
«Kann man so sagen.» Ich nicke und versuche zu lächeln, was meine rissigen Mundwinkel nur so hergeben.
Ich gebe mein Portemonnaie ab. Hunerwadel bittet den Wärter vorschriftsgemäß, den gesamten Inhalt herauszunehmen: vierhundert Dollar in Scheinen, der Rest jener tausendfünfhundert, mit denen ich meine Flucht vor einer guten Woche angetreten habe. Vorne finden sich ein gefaltetes Papier und ein paar Münzen, die der Wärter zusammen mit den Scheinen in einen Umschlag steckt, auf dem er die Summe notiert, die er auch in das Aufnahmeformular einträgt. Dann faltet er den Zettel auf, liest ihn und reicht ihn kommentarlos an Hunerwadel weiter.
Der Text darauf ist so sorgsam und sauber geschrieben, wie ein gewisser John Fitzgerald Kennedy es überhaupt nur konnte, ein Mensch, dessen vielfältige Leiden sich auf seinen Charakter wie auf die zerrissene Linienführung seiner Handschrift niedergeschlagen hatten, weshalb er sich auch bei dieser stets die größte Mühe gegeben hatte, um seine Schwächen zu kaschieren. Heraus kam eine gut lesbare Linie, und so braucht Hunerwadel nur ein paar Sekunden, bis er die Zeilen entziffert hat:
Bullfight critics ranked in rows
fill the enormous plaza full;
but there’s only one there who knows
and he’s the one who fights the bull.
Stierkampfrichter, überall,
Füllen ganz den weiten Platz.
Doch nur einer weiß Bescheid:
Der haut dem Bullen vor den Latz.
Dann studiert er die Widmung auf der Rückseite, die ihn stutzen lässt:
Für Major John Glueck!
John F. Kennedy
«Kann doch nicht sein, oder? Sie kannten Präsident Kennedy?»
«Kannten? Nein. Bin ihm mal begegnet und habe etwas für ihn getan. Dies Gedicht war sein Motto, und er hatte immer eine handgeschriebene Version davon im Geldbeutel, um es bei Gelegenheit verschenken zu können. Für den Gefallen bekam ich das Autogramm mit dem Gedicht. JFK war der Meinung, dass ihn das häufige Niederschreiben des memorierten Textes geistig fit halte. Es muss Hunderte von diesen Zetteln geben. Wenn Sie wollen, können Sie ihn behalten.»
«Aber er ist doch Ihnen gewidmet», entgegnet der Direktor.
«Ich hab’s aufgehoben, weil ich immer dachte, dass es sich gut am Anfang eines Romans machen würde, aber mittlerweile kann ich’s auswendig. Behalten Sie den Zettel, wenn es Ihnen Freude macht.»
«Hat … der Präsident es selbst gedichtet?»
«Nein, es ist von Domingo Ortega, einem spanischen Matador. Früher ziemlich bekannt, der Mann, noch bis in die Fünfziger.»
Hunerwadel geht es genauso, wie es mir ergangen ist, nachdem Kennedy mir völlig überraschend das von ihm selbst abgeschriebene Gedicht überreichte und mir die Hand drückte, als wären wir demnächst zum Segeln verabredet: Er ist ein klein wenig überwältigt. Nimmt das JFK-Autograph an. Und bedankt sich.
Es ist klar, dass es jetzt ans Eingemachte geht. Hunerwadel und seine Männer fürchten sich. Keiner will der sein, der mich anfassen muss, um mir die obligatorische Rasur zu verpassen. Das kommt mir gerade recht.
«Ich werde Ihnen sonst keinen Ärger machen, Herr Direktor», sage ich fast flüsternd zu Hunerwadel. «Aber denjenigen von Ihnen, der mein Haar anfasst, bringe ich unter die Erde. Egal wen. Versprochen. Und wenn Sie mir eine Betäubungsspritze geben. Ich werde herausfinden, wer es getan hat. Also lassen Sie mir mein Haar. Hat mit meiner Krankheit zu tun.»
Ich bin ein wandelnder, leibhaftiger Albtraum, ein Mischwesen aus einem Bestiarium. Ich verspreche Frieden, indem ich mit Mord drohe. Eine amerikanische Amphibie.
«Haben die Deutschen Ihnen das angetan?», fragt Hunerwadel schluckend, fast schon wieder hoffnungsvoll. Das wäre ihm zweifellos am liebsten. Ein Ungeheuer aus dem Hürtgenwald.
«Nein, das waren wir. Ein Unfall.»
Er überlegt noch einen Moment, dann lässt er seine Untergebenen wissen, dass sie bei «Major Glueck» eine Ausnahme machen sollen. Ich darf meine Haare behalten und bin damit der einzige Langhaarträger unter sechshundert kahlgeschorenen Gefangenen. Dafür bin ich Hunerwadel dankbar. Und auch, weil er mir eine Einzelzelle zuteilt, liniertes Papier und ein Arsenal von Schreibgeräten.
Es gibt – wie man gleich sehen wird – kein besseres Bild, um meine Herkunft zu beschreiben, als das eines alten, knorrigen Apfelbaums, dem ein frischer Trieb derselben Gattung aufgepfropft wurde, sodass meine Familiengeschichte auf der einen, stämmigen Seite genügend tief reicht, um ein ganzes Team munterer Genealogen zu beschäftigen, die jedem Wurzeltrieb und allen Verzweigungen nachforschen würden, bis sie irgendwann auf die unvermeidlichen Eintragungen in mythischen Logbüchern stießen, Lobpreisungen Gottes, dass ER – trotz fürchterlichster Stürme, mit denen er die atlantische Pfütze aufzuwühlen beliebte, der Sichtung von Walfischen und anderen Ungetümen des Meeres, trotz Krankheit und Pestilenz an Bord und sämtlichen Gebresten und Leiden, denen die Seefahrer und vor allem die einfachen Passagiere des achtzehnten Jahrhunderts nun einmal ausgesetzt waren – so außerordentlich gnädig gewesen war, ein junges Ehepaar Torstrick am Leben zu lassen. Wie ihre Schiffsgenossen waren die Torstricks religiöse Freidenker, die sich Freunde der Wahrheit nannten. Als sie schließlich die Südküste Pennsylvaniens erreichten, waren sie umso dankbarer, als ihrer beider kostbare Begleiter die Reise gleichwohl bestens überstanden hatten. Als da waren Gelbe Borsdorfer, Edelborsdorfer, Martens Sämlinge, Seestermüher Zitronen, Englische Spitalrenetten und etliche andere verlässliche Sorten, aus guter Schule stammende Apfelbäumchen. Diese Torstricks, Gotthilf und Elisa, erwarben von einem preußischen Quäker drei Hektar Land im heutigen Adams County, und zwar im Dorf Berlin, auf dessen zunächst unbefestigten, aber liberalen Straßen man zum Bader ging und Schrippen und Hippen beim Beckmeister kaufte.
Die Torstricks – Anhänger der GOP, als diese noch ganz jung war – verabscheuten immer schon die Sklaverei, aber nach Gettysburg, so erzählt die Familienlegende, wurden dennoch verletzte Konföderierte im Haus gepflegt, was mir mehr denn je zu denken gibt, denn das hatte ich bis gerade eben fast vergessen, und erst durchs ringende Schreiben wurde es aus meiner Erinnerung nach oben befördert.
Später dann – nicht nur das Dorf, sondern auch die Torstrickfarm war erheblich gewachsen – erforderte es die pennsylvanisch-postbürokratische Genauigkeit, unser Berlin von demjenigen im westlich gelegenen Somerset County unterscheidbar zu machen. Ich weiß nicht, wieso es unser Städtchen traf und nicht das andere, vielleicht wurde gelost, vielleicht fanden die Stadtväter die Betonung der Küstennähe verheißungsvoll: Aus Berlin wurde jedenfalls East Berlin. Vermutlich dürften selbst die dortigen Hinterwäldler mitbekommen haben, dass der irrlichternde Geist der Geschichte sich vor zwanzig Jahren einen Spaß daraus gemacht hat, ihnen in der Sowjetzone Deutschlands ein düsteres Riesengeschwisterchen desselben Namens an die Seite zu stellen. Ich war lange nicht mehr da. In East Berlin, Pennsylvania, meine ich, nicht in Berlin (Ost), Hauptstadt der DDR, da war ich noch nie. Nach West-Berlin aber will ich dann als Nächstes, wenn Hannibal hinter mir liegen wird.
Ein Rätsel ist es mir auch geblieben, wie es meiner Mutter, der jüngsten eines halben Dutzends von Schwestern, überhaupt gelingen konnte, der Gravitationskraft ihrer Mutter zu entgehen und das Pennsilfaanische Stammland zu verlassen, ohne sich zu zerstreiten, denn «mer sott em sei Eegne net verlosse, denn Gott verlosst die Seine ach ned». Meine Großmutter, Bäckchen wie zwei Apfelhälften und von imponierender Leibesfülle, war die stärkste Frau, die ich jemals kennengelernt hatte. Mir war es, als ich noch klein war, immer vorgekommen, als hätte ich die gesamte Zeit unserer Aufenthalte in East Berlin auf ihrem linken Arm verbracht, während sie, scheinbar ohne die geringste Einschränkung, ihre Arbeiten erledigte, die Schafe zusammentrieb, die die Sommer in den Obstgärten weideten, Wasser und Brennholzscheite schleppte und den großen Herd einschürte, auf dem sie dann grüne Apfelschnitze mit Speck briet. Dazu verschlang man warmes Brot, auf dem fingerdicke Butterstreifen schmolzen. Das Brot war deitsches Brot, dunkel wie Muttererde, da es aus vollem Roggen vierzehn Stunden gebacken wurde. Eine meiner frühesten Erinnerungen überhaupt besteht darin, wie die Großmutter mit einem riesigen Brotmesser die für mich bestimmten Scheiben von der steinharten Kruste befreite. Nach der Mahlzeit durfte ich die Kaninchen hinter dem Haus damit füttern. Die weiß-schwarzen Rieseschegge, die es gut auf fünf Kilo bringen mochten, sprangen wie verrückt in den strohduftenden Ställen hin und her, klopften mit den samtigen Hämmern ihrer Hinterläufe, drückten sich furchtsam in die hölzernen Ecken der Ställe, um sich dann zögerlich, die Köpfe weit vorstreckend, an die hingehaltenen Krusten heranzutasten. Wenn ihre Schnurrhaare meine Finger streiften und sie dann zu knurpsen begannen, wurde ich fast verrückt vor Aufregung und Glück. Egal wohin meine Großmutter ging, ob Tier, Pflanze oder auch das unbelebte Zeug – alles und jedes sprach sie Pennsilfaanisch Deitsch schwetzend an, nannte es beim Namen und verhieß ihm seinen rechten Ort. Auf ihrem Arm sitzend, lernte ich, dass es gebt viele schwatze Schof, awwer sie gewwe all weissi Millich, dass es Schnee gebbe wead, wenn sich da Hund auf sein Buckel lecht, und dass man immerzu fleissig sein müsse, denn alle Daag umhersitze macht em faul.
Nach East Berlins Schafen, den Kaninchen und den braven Kutschpferden, mit denen wir dann wieder zum Bahnhof von Harrisburg transportiert wurden (Gott segen eich!), erfolgten die von der Melancholie meiner Mutter gefärbten Zugfahrten zurück nach New York. Unser Abteil, erfüllt vom Duft der Apfelkisten, die auf den Ablagen bis unter die Decke gestapelt waren, bewegte sich durch die Wälder, die Mama, ihren schönen Kopf auf ihr Handgelenk gestützt, so intensiv betrachtete, als erwarte sie, dass dort ein Bekannter aus dem fernen Dickicht ihrer Jugend herausträte, der ihr zuwinken würde.
Am Ende sahen wir beide jedes Mal mit Spannung der schauerlichen Durchquerung des Tunnels unter dem Hudson entgegen, in dem selbst an Sommernachmittagen tiefste Mitternacht herrschte. Die paar Minuten, in denen die Abteilfenster nichts als Schwärze zeigten und ich die ganze Zeit daran denken musste, dass über uns die eiskalten Wasser des Stromes dahinflossen, auf dem die gewaltigsten Schiffe unterwegs waren, und wie das nur zusammengehen konnte: die Schiffe oben im Wasser, wir in der Eisenbahn drunter.
Das größte Wunder aber lag am Ende des Tunnels, denn aus der Dunkelheit erreichten wir schließlich eine Kathedrale des Eisenbahnzeitalters: Pennstation. Die Baumeister aller Epochen schienen beseligenden Geistern gleich bei seiner Errichtung mitgeholfen zu haben. Die Dome des christlichen Abendlands, des römischen Kaiserreichs Eleganz und Ägyptens Durst nach Unsterblichkeit, all dies schien hier nachgebaut, wiederholt, größer und gewaltiger in Szene gesetzt als in den Originalen, ein himmelwärts strudelnder Omphalos auf gutem amerikanischen Boden. Der Granit, mit dem seine Eingangshalle vollständig verkleidet war, faszinierte mich, und oft kroch ich mit meinen kurzen Hosen und nackten Knien auf ihm herum, um mich am Flirren der glänzenden Platten zu berauschen, das aus der Entfernung betrachtet jenes gräuliche Rosa ergab, das ich nirgendwo wieder gesehen habe. Und wohl auch niemals mehr sehen werde, denn vor ein paar Jahren ist es den vereinigten Kräften der New Yorker Immobilienspekulation unter Führung des skrupellosen Fred Trump, der sein Geld nach dem Krieg bekanntlich mit dem Bau schäbiger Sozialwohnungen auf Coney Island gemacht hat, endlich gelungen, Pennstation abzureißen und das Gelände gewinnbringend auszuschlachten.
So tief die verbürgten Erzählungen von den apfelbaumpflanzenden Torstricks reichten, freiheitsliebenden Pennsylvaniern und manchmal, wenn ich an meine Großmutter denke und daran, wie sie mit allen Dingen und Tieren zu plaudern pflegte, eigentlich so etwas wie Blumenkinder avant la lettre – so kurz reicht mein Wissen auf der Vaterseite.
Mein Großvater, Josef Maria Glück, hatte seinen prächtigen Namen (zumindest prächtig für die, die Deutsch verstehen) nicht von seinen Eltern bekommen, denn die waren unbekannt, sondern von den Schwestern vom armen Kinde Jesus. In deren Kölner Waisenhaus war mein Großvater nach seiner Geburt abgegeben worden. Es war üblich, den Findelkindern gott- oder herrschaftsgefällige Vornamen zu geben, sich aber bei den ja auch nötigen Familiennamen an den Umständen der Findung zu orientieren. Daher kommen all die Ostertags, Sonntags, Julys oder Espositos. Bei meinem Großvater Joe dachten die Nonnen vielleicht, er habe Glück gehabt, bei ihnen gelandet zu sein, oder er werde solches in seinem späteren Leben finden. Immerhin lernte er neben dem Beten, dem Beichten, dem Fasten und dem Ertragen von Prügeln auch das Lesen und Schreiben und, wenn auch wohl im Verborgenen und entgegen alle Billigung seiner geistlichen Erzieherinnen, das Kartenspielen. Es war eines der Tabuthemen bei uns zu Hause, aber ich glaube zu wissen, dass mein Großvater Joe, zumindest in Amerika, kein kleiner Vertreter, so die offizielle Legende, sondern ein Berufsspieler gewesen war.
Vielleicht hatte mein Großvater auch schon das Geld für die Schiffspassage für sich und seine Frau Elisabeth mit Kartenspielen verdient. Aber nachdem er gegen 1880, knapp zwanzigjährig, in Ellis Island angekommen war, hatte er sofort damit angefangen, sich seinen Anteil an den ungeheuren Geldmengen, die der Goldrausch sprudeln ließ, an den Spieltischen der boomenden Großstädte zu ergattern, wo die Betreiber mit viel Alkohol, leichten Mädchen und Glücksspiel Atmosphäre zu erzeugen versuchten. Jeder bessere Saloon hatte Berufsspieler und hübsche Frauen unter Vertrag. Während Joe wochenlang auf Tour in San Francisco, Cincinnati oder Atlantic City war, blieb seine Frau mit ihren kleinen Söhnen in der Einzimmerbehausung in der Lower East Side alleine, wo sie immer Angst haben mussten, in der Nacht von den Ratten angenagt zu werden, weshalb sie alle zusammen in einem Bett schliefen, das angeblich von einem ausrangierten, kleinmaschigen Fischernetz überspannt war. Ich habe auch anderswo gehört, dass es solche Netze als Rattenschutz in den deutschen Slums von New York tatsächlich gegeben hat.
Mein Großvater hatte mir schon als Zweijährigem beigebracht, wie man die Karten hält. Wir spielten deutsche Kinderkartenspiele wie Mau Mau oder amerikanische wie Take-The-Train, das mir besonders viel Spaß machte, und auch Dutch Blitz und Eucre, die die Pennsylvanier liebten. Aus dem Eucre-Spiel stamme auch der Joker, der, wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, Kaiser-Bauer, der höchste Trumpf im ganzen Spiel. Dieser Imperial-Bower, wie man den Joker auf Englisch mit deutscher Phonetik nannte, war eine amerikanische Erfindung, erklärte er mir. Der Joker stand ganz und gar für das, was Amerika für Generationen von Einwanderern vor und nach ihm war: ein Versprechen, eine Hoffnung, eine Möglichkeit, alles zu sein, alles erreichen zu können, was man sich nur vorstellen mochte.
Auf dem Joker der von meinem Großvater bevorzugten Kartenmarke Bicycle 808 fuhr ein König in märchenhaftem Gewand auf einem altmodischen Fahrrad durch die Gegend. Die andere, sonderbare amerikanische Karte hingegen war das Pik-Ass: Da stand nämlich eine Frau mit Krone und Schwert in der rechten Hand, und hinter ihr fielen die Sterne der amerikanischen Flagge wie Schneeflocken aus einem schwarzen Himmel. Es war eine Abbildung der Statue of Freedom – nicht der unsrigen, die heißt ja auch Statue of Liberty, sondern jener, die seit 1865 auf dem Kapitol in Washington stand. Für mich war sie eine mythische Figur, die ich mir stundenlang anschauen konnte.
Es gehört zu den bizarren Zufällen meines Lebens, dass ich ausgerechnet das geheimnisvolle Pik-Ass aus dem Bicycle 808-Spiel bei meinen Recherchen im Mekong-Delta wiedersehen sollte, ein Rätsel meines Lebens und eine unheimliche Begegnung, die sich kein romantischer Schauerdichter hätte ausdenken können.
Meine Mutter hatte Großvater eigentlich strikt verboten, mir das Kartenspielen beizubringen, aber der dachte überhaupt nicht daran, auf unser Vergnügen zu verzichten. Denn das Kartenspielen war nicht nur sein Talent, sondern auch seine Berufung und sein Schicksal. Gerne erzählte er, wie er in Pittsburgh in üblen Schwierigkeiten gewesen war. Weil er zu oft gewonnen hatte. Er habe nicht aufhören können, bis es seinem Gegenspieler einfach zu viel geworden sei.
«Oh Jung», hatte er in seinem phantastischen Kölsch erzählt, einem deutschen Dialekt, der dem Englischen ein wenig ähnlich ist, «et war so ne Moment, direkt spukisch war dat. Der Kerl beucht sich rüber, kommt mir immer näher, und dann sieht er mir tief in de Augen. ‹Glueck, isch weiß jetz, wat der Name heiß, du deutscher Dreckskerl. Du kannst maache, watte wills, aber an meinem Tisch spielst du nit mieh›, dat waren seine Worte», hatte mein Großvater erzählt, «und isch han jesinn, wie er unterm Tisch dat Messer ziehen tät.»
Ich war sein letzter Spielpartner. Und so lernte ich von ihm nicht nur die Tricks, mit denen man beim Black Jack memorierte, wie die Karten gefallen waren und wie man beim Pokern Wahrscheinlichkeiten errechnete, sondern auch, wie man in aller Seelenruhe dat Blaue vom Himmel log, ohne sich auch nur das Geringste dabei zu denken. Er war es auch, der mir erklärte, wie man den Gegner beim Pokern durch die Schaffung einer fiktiven Person, einer Rolle, täuschen konnte: klug sein, dumm erscheinen.
Wenn wir nicht Karten spielten, las er mir die Gebrüder Grimm vor. Besonders mochte ich Hans im Glück – wer hätte es mir verdenken können? – und Sieben gegen die Welt. Ich liebte die Illustrationen, die entzückenden Gänsemädchen, Riesen, klugen Däumlinge, die Stadtszenen mit den mittelalterlichen Gassen und die verwunschenen Häuschen in den geheimnisvollen, dunklen Wäldern.
Bei unseren Spaziergängen in der Bronx, wo wir wohnten, liefen wir jedes Mal zuerst an den Loreley-Brunnen, jene die Märchenwelt der Grimmbrüder fortsetzende Skulpturengruppe aus weißem Marmor, die dem Andenken Heinrich Heines gewidmet war.
Kein einziges Mal versäumte mein Großvater, mir zu erzählen, dass meine Großmutter, seine Lisbeth, aus Düsseldorf gebürtig gewesen sei, der Geburtsstadt des Dichters. Oftmals schneuzte er sich danach kräftig in sein Taschentuch, und dann gingen wir in den nahen Zoo, wo es einen ungeheuer beleibten Löwen gab, der genau so aussah wie der in der Illustration zu dem Märchen Der Löwe und der Frosch.
East Berlin, das archaische Pennsilfaanisch meiner Großmutter, wie auch mein Erlanger-Karten spielender Großvater mit seinem Kölsch, das ich bis zum heutigen Tage im Ohr klingen höre, mit dem Auf und Ab des mächtigen Rheinstromes darin, den Heinrich Heine besungen hatte. Das dunkle Brot. Das bayerische, in Brooklyn gebraute Bier, das mein Großvater genussvoll trank, obwohl es verboten war. Die Grimm’schen Märchen und ihre Bewohner. Das alles, so unterschiedlich und bestürmend und himmelweit auseinander wie die luftigsten Kapitelle auf den römischen Säulen der Pennstation, kam für mich in einer Schnittmenge zusammen, besaß einen gemeinsamen Ursprung: das mythische Land, welches Deutschland hieß. Das Land meiner Vorfahren.
Hier tut es jetzt ein bisschen weh.
Denn als ich neun Jahre alt war, kam mein Vater bei einem Autounfall ums Leben. Aus ungeklärter Ursache durchbrach sein Wagen die hölzernen Leitplanken auf einer Brücke über den Delaware. Er muss nach dem Aufprall sofort tot gewesen sein, denn in seinen Lungen war kaum Wasser.
Zuletzt arbeitete er als selbständiger Handelsreisender und war so viel unterwegs gewesen, dass ich wenig von ihm mitbekommen hatte. Weekend kannte er keines. Nur ein paar familiäre Szenen mit ihm sind mir noch deutlich in Erinnerung, merkwürdig belanglose Ereignisse. Wie die Sache mit einem streunenden Dalmatiner auf Long Island, der ihm eine Hähnchenkeule gestohlen hatte und daraufhin – zu meiner großen Freude – von Vater verfolgt wurde, bis beide fast am Horizont verschwunden waren. Als mein Vater zurückkam, hielt er triumphierend die lädierte Keule in die Höhe, und dann biss er vor unseren vergnügt-entsetzt geweiteten Augen triumphierend hinein.
Alles andere weiß ich nur aus den Erzählungen meiner Mutter und meines Großvaters. Mein Vater, Joseph (ohne Maria) Glueck (ohne Umlaut), galt zwar als gebürtiger Amerikaner, war aber noch auf dem HAPAG-Schiff auf die Welt gekommen, das seine Eltern nach Ellis Island gebracht hatte. Seine Mutter Elisabeth starb, als er fünfzehn Jahre alt war. An der Lower East Side war es nicht unüblich, vor seinem fünfzigsten Geburtstag zu sterben. Infektionskrankheiten gab es reichlich, schlechte Ernährung und eisige Winter auch. Während sein Vater mit durchaus wechselndem Erfolg weiterhin durch die Saloons und Hinterzimmer der Vereinigten Staaten tourte, kümmerte sich Joseph um seinen acht Jahre jüngeren Bruder Wilhelm, Will, der ihm seine – worin genau auch immer bestehenden – Erziehungsmethoden dadurch dankte, dass er sich später auf und davon machte, Richtung Westen, und kein Wort mehr mit ihm sprechen wollte. Er müsste jetzt um die siebzig sein, wenn er noch lebt.
Mein Vater hatte ab seinem vierzehnten Lebensjahr bei Keuffel & Esser drüben in Hoboken gearbeitet, einer Firma, die alteingesessenen Deutschamerikanern gehörte. Zu Beginn war er wohl so etwas wie ein Laufbursche am Hafen gewesen. Keuffel & Esser importierten große Mengen Präzisionsgläser aus dem Deutschen Reich, die sie in geodätischen Apparaten, Kalkulatoren und Ferngläsern verbauten. Deshalb verband ich mit Deutschland immer auch noch etwas sehr Technisches, repräsentiert durch die nimmermüde Ernsthaftigkeit meines Vaters, wenn er einen strengen Blick auf seine Armbanduhr warf, meiner Mutter zunickte und aufbrach, um seine Apparate mit deutschen Präzisionsgläsern an den Mann zu bringen. Deutschland – das Land der Präzision. Auch wenn wir in Amerika lebten, so war mein Vater doch irgendwie ein Teil davon gewesen, auch natürlich, weil wir zu Hause ausschließlich Deutsch sprachen.
Die Kunden waren Vermessungsämter, Geologenbüros und Architekten in allen Staaten, aber auch unsere Kriegsmarine. Diese war der wichtigste und potenteste Kunde.
Irgendwann begann die Firma, sich von den Importen aus Deutschland unabhängiger zu machen, und als in Europa der Große Krieg ausbrach, standen Keuffel & Esser zusammen mit anderen Industrieunternehmen aus den nordwestlichen Staaten in vorderster Linie dessen, was man die Prepared-Bewegung nannte. 1916, fünf Jahre vor meiner Geburt, gab es als vorläufigen Höhepunkt sogar den Preparedness-Day mit einer Parade in Manhattan. Keuffel & Esser war dabei, und auch mein Vater, inzwischen schon im Vertrieb, marschierte in Reih und Glied und schwenkte mit düsterer Miene die BE-PREPARED-Fähnchen. Bereit wozu? Zum Kampf gegen das Deutsche Kaiserreich. Zum Eintritt in den Großen Krieg.
Ich weiß nicht, wieso genau, aber meine liebste von den paar wenigen Fotografien, auf denen mein Vater abgebildet war, zeigte ihn bei jenem «Seid bereit, den kaiserlich deutschen Hunnen aufs Haupt zu schlagen, bevor sie ihre U-Boote und Truppentransporter bis vor die Küsten New Englands und Massachusetts schicken und pickelhaubentragende Monstren mit Bajonett und Flammenwerfer durch die Straßen New Yorks und Bostons ziehen, um, so wie sie es in Belgien und Frankreich getan haben, die Frauen zu schänden und Neugeborene aufzuspießen»-Marsch.
Mein Vater und seine Kollegen in ihren einfachen, streng geschnittenen Anzügen wirken ernst, aber ob sie wirklich an die über den Atlantik herannahenden Deutschen glaubten, wage ich zu bezweifeln. Es war einfach nur Firmenpolitik. Wegen der Navy.
Der russischstämmige Politiker Morris Hillquit in DERFORWERTS, einer jiddischen Sozialistenzeitung, in der auch Leo Trotzki schrieb, wurde nicht müde, die Fortschrittlichkeit Deutschlands zu betonen. Henry Ford charterte kurzerhand einen Ozeandampfer, um persönlich und zusammen mit anderen amerikanischen Industriellen bei den neutralen Regierungen Europas und der Welt vorzusprechen und für eine rasche Friedenslösung zu werben. Würden die USA in den vermaledeiten Krieg eintreten, so warnte er, würden sie eine Riesenmilitärmacht aufbauen und schließlich zur Gefahr für alle anderen werden.
Die kleinen Geschäftsleute und Krämer deutscher Abstammung aber, die traten auf die Straßen, weil sie die permanenten Anfeindungen ihrer italienischen oder englischen Nachbarn nicht mehr ertrugen, verbrannten öffentlich die deutsche Fahne und urinierten auf Bilder des Kaisers. Sie ließen ihre Kinder das Sternenbanner schwenken und küssen (und machten Fotos davon, die sie in ihre schäbigen Schaufenster hängten) und beteuerten bei jeder Gelegenheit, dass sie hinfort keine Deutschen mehr seien, sondern echte Amerikaner. Dabei knödelten sie mit einem herzhaften deutschen Akzent, als wären sie vorgestern auf Ellis Island angekommen. Das, was einmal Little Germany war, ein riesiges Stadtviertel, in dem man straßenweise kein Wort Englisch hörte, dafür aber so gut wie jeden deutschen Dialekt, begann sich aufzulösen.
Mein Großvater hatte Wilson gewählt, weil der hoch und heilig versprochen hatte, Amerika aus dem Krieg gegen Deutschland herauszuhalten. Jetzt, keine zwei Jahre später, verfolgte er grimmig, wie das ganze Land von staatlich bezahlten Propagandakräften überschwemmt wurde. Man kann es sich heute gar nicht vorstellen, aber bis dahin war psychologisch durchdachte Werbung für politische Inhalte völlig unüblich.
Der Erste Weltkrieg war der Kreißsaal der Propaganda.
In Amerika brütete sie das fliegende Riesenheer der Vier-Minuten-Männer aus, Freiwillige, die durch das ganze Land zogen und genau in jener knapp bemessenen Zeit, die es brauchte, um in den Kinos die Filmrollen zu wechseln, auswendig gelernte, exakt kalkulierte Reden schwangen, die den Kinobesuchern erklärten, warum Präsident Wilson sein Versprechen nun doch nicht würde halten können und es eigentlich sowieso ganz anders gemeint gewesen war.
Der Präsident war also ein Lügner.
Das war die erste Information über Politik, an die ich in meinem Leben geriet, mein Großvater sagte das immer und immer wieder – soll ich dies als eine spezifische oder als eine allgemeine Erfahrung beschreiben? Gibt es irgendein Land auf der Welt, in dem die Menschen etwas anderes sagen würden oder jemals gesagt hätten? Sind nicht Politik und Lüge ein geradezu obligatorisches Zwillingspaar, wenn es darum geht, den Wohlstand der Nation zu mehren, die Sicherheit zu bedenken, Krieg und Frieden zu erwägen? Muss Politik nicht grundsätzlich schmutzig, ihre Vertreter verlogen, ihre Ergebnisse einseitig und ungerecht sein?
Nein, sage ich.
Ich weiß, das klingt dieser Tage hohl. Aber ich kann mich an eine Zeit erinnern, als wir hinter dem Präsidenten standen, der ein rechtschaffener Mann war. Sein Name war Franklin Delano Roosevelt. Mitten in der größten Krise der Geschichte machte er kein Hehl daraus, was er sah, wenn er auf Amerika blickte. Er sah, dass ein Drittel der Nation schlecht ernährt war, unter schlechten Bedingungen lebte und in Löchern hauste, ohne Aussicht, jemals zu Eigentum zu kommen. Und er erkannte ein Übel, das die eine Generation an die andere weitergab: Millionen von amerikanischen Kindern hatten keinen Zugang zu guter Bildung.
Knallhart, ja, das war er als Analytiker. Er wusste, mit wem er sich anlegte – mit jenen Leuten, die er den Geldadel nannte, egal ob es Industrielle, Eisenbahnbesitzer, Ölbarone oder Banker waren. Zu unserem und der Welt Glück zog er sein Programm auch durch. Er hielt das Land zusammen, er zähmte das Geld und half den Menschen, die in ihrer Verzweiflung bereit waren, sich auf alles einzulassen, das Besserung versprach, aber er missbrauchte das Vertrauen nicht, das die Menschen in ihn setzten. Wir, meine Freunde und ich, deren Eltern, kleine Leute, die sahen, wie schlecht es dem Land ging: Wir liebten ihn.
In seinen Radioansprachen erklärte er seine Politik. Seine unprätentiöse, gelassene, manchmal auch ein wenig müde klingende Stimme führte uns durch die Untiefen dieser schwierigen Zeit – der vom Finanzsystem ausgelösten Wirtschaftskrise, die man auch die Große Depression nennt. Es war eine Zeit, die Gut und Böse voneinander schied wie Wasser und Öl. Aber an ihrem Ende stand der Eintritt in den Zweiten Weltkrieg, wo wieder alles zusammengequirlt wurde.
Für mich waren die dreißiger Jahre die Epoche, an deren Anfang der Tod meines Vaters stand und meine Kindheit mit einem Schlag vorüber war. Ich fand irgendwie einen Weg für mich, seinen Tod als rationale Größe zu akzeptieren und in meinem Sozial-, Schul- und Familienleben so damit umzugehen, dass mich keiner für bekloppt hielt, aber insgeheim, fühlte ich, war er gar nicht tot. Er sprach aus den Seiten guter und spannender Literatur, schien mir bei der Betrachtung von Weltkarten plötzlich auf geheimer Mission diesseits des Atlantiks unterwegs oder sah mir über die Schulter, wenn ich irgendwo mit dem Springseil trainierte. Es war ein Gefühl, über das ich mit niemandem sprechen musste und auch nicht wollte. Aber ich entdeckte in den Dreißigern nicht nur meine Liebe zur Literatur und zum Seilspringen, sondern lernte auch die Liebe zwischen zwei Menschen kennen, verlor mein Herz und sah zu, wie es – von den bösen Umständen der Zeit – gebrochen wurde.
Ihr Name war Gretchen Amann.
Da kam einiges zusammen, was mein Creative-Writing-Professor Whit Burnett bei der ersten Sprechstunde 1941 folgendermaßen zusammenfasste:
«Durchaus großzügig angenommen, lieber Mr. Glueck», sagte er, «dass die erste sexuelle Erfahrung eines sensiblen jungen Mannes sehr wohl der Stoff für eine ausgezeichnete Geschichte sein kann, ist es unglücklicherweise so, dass sie es nur ganz selten tatsächlich ist.»
Er machte eine genussvolle Pause und strich sich mit dem Zeigefinger über die Unterlippe, um dann fortzufahren: «Und wenn sie es ist, so kommt es darauf an, dass der Autor auch etwas aus dem Stoff macht. Das ursprüngliche Erlebnis, und wäre es auch etwas so Sensationelles wie sein erster von der Hilfsbereitschaft eines Mädchens ausgelöster Samenerguss, genügt nicht. Also denken Sie noch mal drüber nach, ob Sie nicht ein anderes Thema für Ihre Short Story finden.»
Wenn ich heute, dreißig Jahre später, darüber nachdenke, fällt mir ein Gegenbeispiel ein. Es gibt da diesen österreichischen Modeautor, den sie in den Villen und Privatstränden auf Marthas Vineyard und Long Island verschlingen, Peter Handke, der schreibt vielleicht so, über etwas, aber ohne Handlung. Mit Geschehen, aber ohne Inhalt. So pur.
Aber normale Autoren dürfen nicht an der Sache selbst kleben, die sie erlebt haben (klebrig, wie sie war), sondern müssen sich davon lösen können. Das Erlebnis ist nur das Material. Es dient dazu, das anzuordnen und zu gestalten, was Elmer Rice als Modell für das Schreiben einer Short Story vorgeschlagen hat:
Get Man Up Tree
Throw Stones At Him
Get Him Down
Bei der Armee, der christlichen Seefahrt und auch im Gefängnis mögen Ort und Umstände selten erfreulich sein – das, was sie im Zweifelsfall zur Hölle werden lassen, sind immer die anderen. Ein kleines Bergtal kann ein Wanderparadies oder eine Mördergrube sein. Eine Kompanie dein Zuhause oder dein Verhängnis.
Das traditionelle amerikanische Gefängnis verfolgt den Ansatz, einen Gutteil der Überwachungsarbeit nicht von den Wärtern erledigen zu lassen, sondern an die Gefangenen selbst zu delegieren. Im Grunde sind die Wärter eigentlich nur für die Türen da. Sie kontrollieren, was und wer rein- und nicht rauskommt. Im Inneren überlässt man dann vieles den freien Kräften der Insassen. Das birgt natürlich die Gefahr, dass sich diese ausnahmsweise einmal nicht gegenseitig terrorisieren, sondern sich verbünden, um einen Ausbruch zu wagen. Deshalb braucht die Gefängnisverwaltung verlässliche Informanten, denen sie beim Überleben hilft. Ein eher brutaler Ansatz.
Seit aber die Kinder der Geschlagenen, der Beatniks, in zunehmender Zahl einerseits wegen Drogengeschichten und andererseits als politische Gefangene, Wehrdienstverweigerer und Landfriedensbrecher in die Gefängnisse kommen, hat sich auch im Strafvollzug einiges getan. Progressive, studierte Leute, wie Hunerwadel, sind die gefragtesten Männer bei der Neubesetzung von Direktorenposten. Ich bin sicher, er wird es noch zum Leiter eines Bundesgefängnisses bringen.
Heute treffen wir zusammen, um ein paar Formalitäten zu klären. Der Sheriff ist auch da.
Das maschinengeschriebene Protokoll meiner Vernehmung wird mir vorgelegt. Ich lese es sorgsam durch. Lustige Formulierungen zum Teil, behauptete, den Nichtbesitz seines Führerscheins durch dessen vorsätzliche physische Vernichtung selbst herbeigeführt zu haben.
«Alles korrekt?»
«Ja.»
«Werden Sie das Protokoll heute unterschreiben?»
Hunerwadel zwinkert mir zu und schiebt seinen persönlichen Dienstkugelschreiber über den Tisch. Der Sheriff, der mit verschränkten Armen an der Wand steht, schaut mich skeptisch, aber nicht verächtlich an.
«Geben Sie mir noch ein paar Tage, Direktor.»
«Wozu?»
«Ein paar Tage. Bin mir noch unsicher.»
Hunerwadel dreht sich kurz zum Sheriff, der zuckt nur mit den Achseln.
«Also gut. Sobald Sie das Protokoll unterschrieben haben, dürfen Sie in die Bibliothek. Ist das ein Deal?»
«Noch kann ich aus dem Gedächtnis schreiben», sage ich und erhebe mich aus dem blau-orange gepunkteten Sessel, um in meine Zelle zurückgeführt zu werden. Beim Aufstehen fallen ein paar meiner langen, im Licht des Hunerwadel’schen Büros graublond schillernden Haare zu Boden.
Der größte Unterschied zwischen dem Schreiben von Literatur und dem Schreiben für die Regierung besteht im Umgang mit den Auslassungen. Ohne Auslassungen keine Dichtung. Auf der anderen Seite sind Auslassungen genau das, was man sich beim Verfassen eines Berichtes oder eines Protokolls unter keinen Umständen erlauben darf.
Was geschah, nachdem Sie von Ihrem Großvater gelernt hatten, dass Präsident Wilson ein Lügner war?
Wie oft haben Sie mit ihm darüber gesprochen?
Hat Ihr Großvater auch über andere Politiker dieser Zeit mit Ihnen gesprochen?
Hatten Sie überhaupt andere Gesprächsthemen politischer Natur?
Waren Sie jemals Mitglied einer Partei und wenn ja: welcher?
Protokolle solcher Vernehmungen müssen möglichst genau und vollständig sein. Wort für Wort. Die Quelle hat kein Recht, Informationen vorzuenthalten. Der die Quelle führende Offizier auch nicht. Die Entscheidung darüber, was von Relevanz ist und was nicht, liegt nicht bei ihm, sondern bei den höheren Rängen, die in der Lage sind, eine Beurteilung zu treffen.
Bei der Literatur hingegen ist es in der Tat der normale, unbedachte Leser, der am besten beurteilen kann, ob etwas wichtig oder unwichtig, gut und gelungen oder fade und langweilig ist. Legt er die Zeitschrift weg und blättert weiter, ist die Short Story nicht gelungen. Klappt er ihn zu, taugt ein Roman nichts.
Wir sind jetzt also wieder im Jahre 1941. Ich bin seit kurzem zwanzig Jahre alt und studiere im Hauptfach Germanistik an der Columbia. Ich bin Mitglied der Boxmannschaft, ein wendiges Mittelgewicht, vielleicht ein bisschen zu empfindlich, um ein wirklich guter Boxer zu sein, aber ich trainiere fleißig, denn das Boxen hat mir ja mein Stipendium eingebracht und ist also essenziell für mein Studium, das wir uns sonst nicht so einfach hätten leisten können.
Ich habe eine anspruchsvolle Seminararbeit über Erich Kästners Kinderbücher und ihre Verbindung zum Grimm’schen Märchen geschrieben, die meinen Germanistikprofessor entzückt hat. Er will, dass ich unbedingt bei ihm meinen Abschluss mache.
Meine Mutter ist wie immer nach East Berlin aufs Land gereist, aber diesmal alleine, da sie mir endlich meinen Herzenswunsch erfüllen konnte. Sie hat mir nämlich den Creative-Writing-Sommer-Kurs bei Whit Burnett zum Geburtstag geschenkt, den ich mir so sehr erhofft hatte.
Ein unglaublich heißer Sommer hat seinen Höhepunkt erreicht. Es ist kaum zu glauben, aber es wird tatsächlich jeden Tag immer noch heißer. Alles, was man sich unter New York in einem wirklich heißen August an fahrenheitlichen Sensationen nur vorstellen mag, ist geboten: schmelzender Asphalt und weit geöffnete Hydranten in den Seitenstraßen der Bronx, verdorbene Lebensmittel, an denen jeden Tag mehrere Dutzend Leute sterben, dazu Hitzschläge und Kreislaufzusammenbrüche.
Zehntausende Emigranten und Flüchtlinge aus Deutschland, Österreich, der ČSR und den anderen Ländern unter deutscher Besatzung sind in New York. Thomas Mann und die übrigen Berühmtheiten hat es nach Kalifornien gezogen, aber es gibt wieder so viele deutschsprachige Zeitungen und Buchverlage, Komitees und Theatergruppen hier wie kaum je in der guten alten Zeit, die mein Großvater noch erlebt hatte. Von einer guten Zeit würden die neuen Deutschen in den USA allerdings kaum sprechen. Viele sind bitterarm, manche teilen sich zu sechst oder zu siebt ein billiges Zimmer. Ich weiß das, weil meine Mutter sich bei einem Hilfskomitee für deutsche Flüchtlinge engagiert und ich einige kennengelernt habe. Ich lese die Schriftstellerin Anna Seghers, die in Mexiko Zuflucht gefunden hat, aber in New York unter den Emigranten sehr populär ist. Ihr Siebtes Kreuz ist faszinierend geschrieben und ein Fanal für den Widerstand gegen die Nazis. Seghers zeigt, dass diese keineswegs allmächtig sind, auch wenn Hitler mit seinen Blitzkriegen fast ganz Europa besiegt hat.