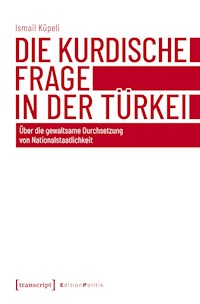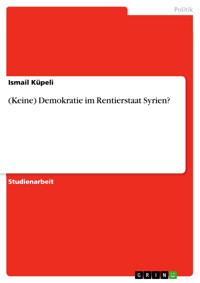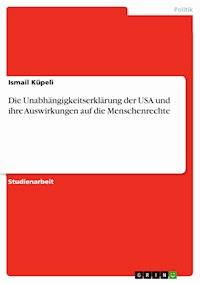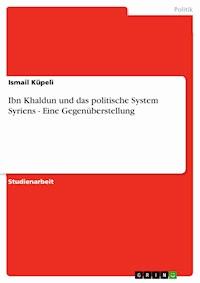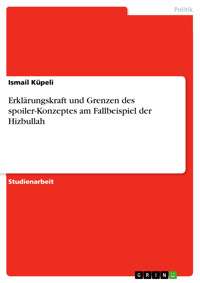11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der türkische Rechtsextremismus, hierzulande unter dem Namen ›Graue Wölfe‹ oder als Ülkücü-Bewegung bekannt, ist mit etwa 12.000 Anhänger*innen die zweitgrößte extrem rechte Bewegung in Deutschland. Die Ideologie des türkischen Rechtsextremismus ist zutiefst geprägt von autoritären, nationalistischen, rassistischen, antisemitischen und queerfeindlichen Elementen. Ebenso auffällig ist das Verschwörungsdenken im türkischen Rechtsextremismus, das mit zahlreichen Feindbildkonstruktionen unter anderem gegen Armenier, Juden, Kurden und allgemein gegen den Westen einhergeht. In den letzten Jahren hat insbesondere der israelbezogene Antisemitismus innerhalb des türkischen Rechtsextremismus an Relevanz und Intensität zugenommen, wie die antiisraelischen Mobilisierungen seit dem 7. Oktober 2023 zeigen. Küpeli beleuchtet die Geschichte, Ideologie, Akteure und Netzwerke der türkischen extremen Rechten, stellt aber auch antifaschistische Gegenstrategien vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dr. Ismail Küpeli ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich mit Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus in Deutschland und der Türkei – sowohl in der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft als auch innerhalb der jeweiligen Minderheiten. Als Koordinator des Projekts Dersim 1937/38 an der Ruhr-Universität Bochum ist er für die Aufarbeitung der Vernichtungsoperationen des türkischen Militärs in der Region Dersim zuständig. Seine Dissertation über die kurdische Frage in der Türkei an der Universität zu Köln erschien Juni 2022 im transcript Verlag. Die Promotion wurde durch ein Stipendium der Rosa-Luxemburg-Stiftung gefördert.
Ismail Küpeli
Graue Wölfe
Türkischer Rechtsextremismus in Deutschland
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Ismail Küpeli:
Graue Wölfe
1. Auflage, Mai 2025
eBook UNRAST Verlag, August 2025
ISBN 978-3-95405-236-3
© UNRAST Verlag, Münster 2025
Fuggerstraße 13 a, 48165 Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, der Übersetzung sowie der Nutzung des Werkes für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: David Hellgermann
Satz: syndikatART/séverine
_Inhalt
Einleitung
Geschichte und Ideologie des türkischen Nationalismus
- Der Genozid von 1915
- Die Entstehung der Türkei
- Exklusion und Vertreibung der Nicht-Muslim*innen
- Nicht-Muslim*innen in der Türkei
Rassismus als zentrale Säule des türkischen Nationalismus
- Die Türkische Geschichtsthese
- Die Nation und die Anderen
- Staatliche Gewalt gegen Kurd*innen
- Türöffner für die extreme Rechte
Die Entstehung der türkischen extremen Rechten in den 1940er-Jahren
Die Entwicklungen in den 1950er- und 1960er-Jahren bis zur Gründung der MHP
- Antikommunismus als Brücke zwischen Staatsapparat und der extremen Rechten
- Die Reorganisierung der türkischen extremen Rechten als Partei und Bewegung
Beziehung zwischen Nation und Glaube
Der Krieg in Kurdistan, die Rolle der Grauen Wölfe und die Situation in den 1980er- und 1990er-Jahren
- Die türkische extreme Rechte nach dem Putsch von 1980
Die gesamtgesellschaftliche Situation unter der AKP bis 2015
- Die türkische extreme Rechte unter der AKP-Herrschaft
Die AKP-MHP-Kriegskoalition und die oppositionelle extreme Rechte
- Der Putschversuch vom 15. Juli 2016 und das autoritäre Präsidialsystem
Die Geschichte des türkischen Rechtsextremismus in Deutschland
- Moscheevereine als rechtsextreme Organisierungsform
- Politische Gewalt und militante Organisationen
- Spezifika eines ›migrantischen‹ Rechtsextremismus in einer rassistischen Gesellschaft
- Mobilisierungen im Netz
- Gegenstrategien zum türkischen Rechtsextremismus
Fazit
Anhang
Zentrale Narrative des türkischen Rechtsextremismus
Chronologie
Glossar
Literatur
_ Einleitung
Das Buch ist mit dem expliziten Ziel entstanden, einen Beitrag für die politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen mit der türkischen extremen Rechten zu liefern. Ebenso explizit ist die demokratische und antifaschistische Positionierung, was keinen Widerspruch zur Faktentreue und Wissenschaftlichkeit bildet. Die Informationen, Einschätzungen und Thesen basieren, wenn nicht anders gekennzeichnet, auf meine eigenen Recherchen, Beobachtungen und Analysen in den letzten 15 Jahren. Der Anspruch ist, differenziert und genau sowohl eine gefährliche rechtsextreme Bewegung zu beschreiben, als auch Ansatzpunkte für Gegenstrategien und Möglichkeit der Verteidigung von Demokratie und Vielfalt zu bieten. Dabei sollte deutlich werden, dass in einer vielfältigen Gesellschaft, wie etwa in Deutschland, rechtsex-treme und sonstige menschenfeindliche Bewegungen ebenfalls vielfältig sind. Diese vielfältigen Gefahren zu erkennen und abzuwehren, ist im Interesse von demokratischen und antifaschistischen Akteuren – jenseits von ethnischen, sprachlichen oder religiösen Grenzen.
In den folgenden Kapiteln wird, ausgehend von der Geschichte der Ideologie und Praxis des türkischen Staates, die Entstehung und Entwicklung der türkischen extremen Rechten in ihren vielfältigen Formen dargestellt. Dabei wird in einem ersten Schritt der Fokus auf die politischen Grundlagen, die von dieser Ideologie und Praxis des Staates für die spätere Etablierung der extremen Rechten geschaffen wurden, gelegt. Nur so lässt sich die Stärke und Verwurzelung des türkischen Rechtsextremismus adäquat erklären. Im Anschluss werden die Entstehung der extremen Rechten in den 1930er- und 1940er-Jahren skizziert, wobei auch auf die besondere Rolle NS-Deutschlands in diesem Kontext eingegangen wird. Die Entwicklungen der 1950er- und 1960er-Jahre sind insbesondere vom Antikommunismus als einer gemeinsamen Kampagne der Staatsführung und der extremen Rechten bestimmt, die für spätere Bündnisse zwischen rechten und extrem rechten Akteure kennzeichnend wurde. Mit der Gründung der MHP 1969 kommt es zu einer parteiförmigen Organisierung der extremen Rechten, die die Organisationslandschaft bis heute prägt. So sind alle anderen relevanten Parteien der extremen Rechte in der Türkei, wie etwa die IYI Parti (Gute Partei, IYI), de facto Abspaltungen von der MHP. Die Analyse der 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahre fokussiert auf die MHP und Entwicklungen rund um die MHP. In einem thematischen Exkurs wird anschließend die türkisch-islamische Synthese als die Brückenideologie der gesamten türkischen Rechten beschrieben und dabei die besondere Rolle des Antisemitismus skizziert. Bei der Darstellung der 2000er-, 2010er- und 2020er- Jahre muss dann zusätzlich die rechte Regierungspartei AKP in den Blick genommen werden, weil viele Dynamiken und Entwicklungen der extremen Rechten auf die Wechselbeziehung zwischen AKP und MHP zurückzuführen sind. Im Folgenden wird der Blick auf die türkische extreme Rechte in Deutschland gelenkt, wobei zuerst die Geschichte der Bewegung seit den 1970er-Jahren dargestellt wird. Relativ rasch entwickelten sich dabei die Moscheevereine, die in mehreren Dachverbänden organisiert sind, zu der bis heute wichtigsten Säule der türkischen extremen Rechten in Deutschland. Über die lokalen Moscheevereine gelang den Grauen Wölfen eine stärkere Einflussnahme auf die Kommunalpolitik und Integrationspolitik, auch durch die Ausländer- und Integrationsräte. Die Analyse der Situation in Deutschland in den 1980er-, 1990er- und 2000er-Jahren fokussiert daher auf die Moscheevereine und Dachverbände und auf die Kommunalpolitik insbesondere in Westdeutschland. In den 2010er-Jahren treten neben den Moscheevereinen neue militante Organisationen wie etwa Osmanen Germania und Turan e.V. auf, die sowohl für Aktivitäten im Bereich der organisierten Kriminalität als auch politisch motivierte Gewalt verantwortlich sind. Durch diese Gruppierungen werden rechtsextreme Gewalttaten, die zuvor von einzelnen Tätern oder informellen Netzwerken verübt wurden, in einer systematischen und organisierten Form verübt. Anschließend folgen thematische Abschnitte, die weniger chronologisch angelegt sind, sondern sich vielmehr auf einzelne Aspekte fokussieren. So werden Gründe für die Attraktivität des türkischen Rechtsextremismus für türkischstämmige Menschen skizziert, die sehr stark mit Fragen der Identität, Selbst- und Fremdzuschreibungen und der Selbstaufwertung durch Abwertung anderer Menschen zusammenhängen. Es folgt eine Analyse der ideologischen Transformationen innerhalb des türkischen Rechtsextremismus in Deutschland, wobei die Wechselbeziehungen zwischen antiarmenischem Rassismus und Antisemitismus beleuchtet werden. Nach einer Skizze der Aktivitäten der türkischen extremen Rechten im Netz, so etwa auf den Social Media Plattformen, und ersten Überlegungen über Gegenstrategien seitens staatlicher, zivilgesellschaftlicher und explizit antifaschistischer Akteure folgt ein Gesamtfazit. Ein Exkurs über zentrale Narrative des türkischen Rechtsextremismus, eine Chronologie der Ereignisse in der Türkei und in Deutschland und ein Glossar über wichtige Namen und Begriffe schließen die Publikation ab. Dabei lässt sich der Exkurs auch unabhängig vom Gesamttext als kurze und niedrigschwellige Handreichung für die politische Bildungsarbeit einsetzen.
_ Geschichte und Ideologie des türkischen Nationalismus
Der türkische Nationalismus ist seit der Entstehungsphase zu Beginn des 20. Jahrhunderts davon geprägt, dass er eine Einheit von Glauben, Sprache und Abstammung einfordert. Die Staatsbürger*innen sollen die gleiche Abstammung, die gleiche Religion und die gleiche Sprache besitzen. Das Überleben und Erstarken der Nation wird daran geknüpft, ob diese Einheit hergestellt und verteidigt werden kann oder nicht. Folgerichtig werden alle Bevölkerungsgruppen und Individuen, die nicht in diese Einheit passen, als Störfaktoren und als Feinde angesehen. Im Zuge dessen wurde die vielfältige Bevölkerung des Osmanischen Reichs in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Neben den sunnitischen Türk*innen, die die Herrschernation bilden sollten, wurde zwischen nicht-türkischen Muslim*innen, die es zu türkisieren galt, und Nicht-Muslim*innen, die a priori als nicht assimilierbar definiert wurden (vgl. Akçam 2004: 130–134), unterschieden.
Diese Verknüpfung zwischen der ethnisch-religiösen Einheitlichkeit und der Entwicklung der eigenen Nation spiegelt sich bereits im Namen der wichtigsten Organisation der türkisch-nationalistischen Jungtürken-Bewegung wider, die 1908 die Macht ergriff: Ittihad ve Terakki Cemiyeti (Komitee für Einheit und Fortschritt, ITC). Die ITC setzte von Anfang an auf eine Türkisierung des Osmanischen Reiches. Davon betroffen waren prinzipiell alle nicht-türkischen Bevölkerungsgruppen, aber insbesondere nicht-muslimische Bevölkerungsgruppen wie etwa die Armenier*innen. Im August 1909 erließen die Jungtürken ein neues Vereinsgesetz. Dessen Paragraf 13 erklärte sämtliche Organisationen und Vereinigungen, die die Interessen einzelner ethnischer Gruppen vertraten, für illegal. Dies betraf Vereinigungen, die sich etwa mit der kurdischen Sprache, Kultur und Geschichte befassten, aber im Sinne der staatlichen Türkisierungspolitik nicht Institutionen, die sich mit der türkischen Sprache, Kultur und Geschichte beschäftigten.
Die Jungtürken wandten bei ihrer Homogenisierungspolitik gegen verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Methoden an. Muslim*innen aus Gebieten, die das Reich nach den Balkankriegen 1912/1913 abtreten musste, sollten kulturell und sprachlich assimiliert werden, d.h. sie sollten Türkisch als Muttersprache sprechen und sich als Türk*innen bezeichnen. Dafür bekamen sie bei der Einwanderung ins Osmanischen Reich Land und Ressourcen. Im Rahmen der Türkisierungspolitik wurden sie als staatsloyale Gruppe angesehen und in nicht-türkischen oder eher als unruhig geltenden Regionen angesiedelt, etwa in Ostanatolien. Waren sie bereit, sich assimilieren zu lassen, wurden sie gegenüber anderen Nicht-Türk*innen bevorzugt behandelt.
Während die Jungtürken muslimische Bewohner*innen ehemaliger Reichsgebiete auf dem Balkan explizit aufforderten, ins verbleibende Reichsgebiet umzusiedeln, sahen sie die nicht-muslimischen Bevölkerungsgruppen im Reich als Problem an. Deren Strukturen und Organisationen waren daher staatlicher Repression ausgesetzt. Das Ziel war, zusammenhängende Gebiete mit nicht-muslimischer Bevölkerung aufzulösen, etwa durch die Vertreibung der bisherigen Einwohner*innen und die Ansiedlung vermeintlich echter Türk*innen. Die Vertreibungen mündeten in Massakern an Angehörigen nicht-muslimischer Bevölkerungsgruppen. 1914 begann die jungtürkische Regierung eine staatliche Terrorkampagne gegen die griechischsprachige christliche Bevölkerung in Westanatolien, die diese zur Flucht trieb. Dazu wurde eine Geheimorganisation namens Teşkilat-ı Mahsusa (Spezialorganisation) unter Federführung ihres späteren Vorsitzenden, Eşref Kuşçubaşı, eingesetzt. Die Spezialorganisation verübte Überfälle auf vermeintlich griechische Dörfer, Plünderungen und Morde (vgl. Akçam 2004: 145–146). Nachdem die Terrorkampagne auf außenpolitischen Druck durch Frankreich kurz ausgesetzt worden war, setzte die jungtürkische Regierung sie nach Beginn des Ersten Weltkriegs wieder fort. Die Gesamtzahl der getöteten und vertriebenen vermeintlichen Griech*innen wird auf über eine Million geschätzt. Die erfolgreiche Durchführung der Massaker und die Vertreibungen von 1914 ermutigte möglicherweise die jungtürkische Regierung zum Genozid an den Armenier*innen im Jahr 1915 (vgl. Akçam 2004: 147, 150).
Die nationalistische Bewegung unter der Führung von Mustafa Kemal, die nach der Niederlage des Osmanischen Reichs im Ersten Weltkrieg das Programm der Jungtürken fortsetzte, fügte ein weiteres Element zur geforderten Einheit hinzu: Neben Glauben, Sprache und Abstammung sollte auch das Denken, anders gesagt: die Normen und Werte der Nation, einheitlich sein. Die Kemalisten benutzen für dieses Denken den Begriff Ülkü (Ideal), und die Nation sollte nach ihrer Vorstellung als eine Einheit dieses Ideal anstreben.
Der Genozid von 1915
Nachdem andere nicht-muslimische Bevölkerungsgruppen vertrieben und marginalisiert worden waren, bildete aus Sicht des ITC die armenische Bevölkerung das Haupthindernis für eine homogene türkische Nation. Die Ansprüche der Armenier*innen auf volle Rechte als Bürger*innen sowie ihre Zurückweisung der ihnen zugewiesenen untergeordneten gesellschaftlichen Position gefährdeten das jungtürkische Projekt, das multiethnische Osmanische Reich in einen türkischen Nationalstaat zu überführen.
Dieser Sichtweise entspricht auch das Narrativ, den Genozid von 1915 als schmerzliche, aber notwendige Maßnahme im Sinne der türkischen Nation zu beschreiben. Auch Talat Paşa, jungtürkischer Innenminister und einer der Hauptverantwortlichen für den Genozid, nutze dieses Narrativ. In einem Gespräch mit der bekannten Schriftstellerin Halide Edib Adıvar sagte er in Bezug auf die Durchführung des Genozids:
»Sieh, Halide Hanum. Ich habe ein Herz so gut wie das Eure, und bei Nacht hält es mich wach, an das menschliche Leid zu denken. Aber dies ist eine persönliche Angelegenheit, doch ich bin hier auf der Welt, um an mein Volk zu denken und nicht an meine Empfindlichkeiten« (Dabag 2006: 168).
In der Öffentlichkeit hingegen beschuldigte die türkisch-nationalistische Staatsführung wahrheitswidrig die Armenier*innen, dass sie angeblich das Osmanische Reich verraten hätten und mit den Kriegsgegnern des Reichs zusammenarbeiten würden. Mit dieser Dolchstoß-Erzählung wurde schlussendlich der Genozid von 1915 legitimiert.
Tatsächlich begann die jungtürkische Regierung bereits im Herbst 1914 mit den ersten Maßnahmen, die sich nachträglich als Vorzeichen des Genozids deuten lassen. Im Zuge der Türkisierung der Wirtschaft gab es zuerst Boykottaufrufe und -maßnahmen gegen armenische Geschäfte. Es folgten Verhaftungen und »gezielte Morde an kirchlichen, politischen und wirtschaftlichen Repräsentanten« (Dabag/Platt 2015: 293). Im Februar 1915 wurden die armenischen Soldaten der osmanischen Reichsarmee entwaffnet und später in Arbeitsbataillone überführt sowie schlussendlich ermordet. Diese Maßnahmen wurden in vielen Regionen von Überfällen und Massakern türkischer und kurdischer Täter*innen an der armenischen Bevölkerung begleitet. Am 20. April 1915 begann daraufhin in Van ein armenischer Aufstand, der insgesamt vier Wochen andauerte (vgl. Dabag/Platt 2015: 292). Als Reaktion darauf ließ die jungtürkische Regierung am 24. April 1915 »in einer breit angelegten Aktion armenische Notabeln und Intellektuelle in Konstantinopel verhaften, deportieren und ermorden« (Dabag/Platt 2015: 292). Dies kann als Auftakt zum Genozid angesehen werden. Es folgten Vernichtungsmaßnahmen in vielen Regionen des Osmanischen Reiches, die als Umsiedlungen kaschiert wurden. Dabei wurden die »armenischen Männer […] zumeist unmittelbar von den Frauen und Kindern getrennt und außerhalb der Städte und Dörfer exekutiert, so dass die Deportationszüge überwiegend aus Frauen und Kindern bestanden« (Dabag/Platt 2015: 294). Die Deportationszüge wurden immer wieder von türkischen, kurdischen und anderen muslimischen Täter*innen in Gruppen angegriffen, wobei viele Armenier*innen ermordet oder verschleppt wurden. Die kurdischen Eliten beteiligten sich am Genozid, einerseits, um sich ökonomisch zu bereichern und andererseits, um auf Kosten der Armenier*innen ihre Macht auszubauen. Die Eliminierung der Armenier*innen in Ostanatolien führte dazu, dass die Kurd*innen in diesen Regionen zur stärksten Bevölkerungsgruppe wurden. Diese Angriffe sowie Hunger, Durst und Krankheiten führten dazu, dass »nur wenige die Konzentrationslager in Mesopotamien [erreichten], in denen die Menschen weiteren Massakern, Hunger und Durst ausgeliefert waren« (Dabag/Platt 2015: 295). Insgesamt wurden im Zuge des Genozids von 1915 bis zu 1,5 Millionen1 Armenier*innen ermordet (vgl. Dabag/Platt 2015: 284).
Aufgrund der fortdauernden Leugnung des Genozids in der Türkei und der damit einhergehenden und anhaltenden Schließung der Archive des Osmanischen Reiches ist eine genauere Bestimmung der Opferzahlen leider nicht möglich.
Die Entstehung der Türkei
Durch die Vertreibungen von und Massakern an Angehörigen nicht-muslimischer Bevölkerungsgruppen sowie schließlich durch den Genozid an den Armenier*innen wurde das Kerngebiet des Osmanischen Reiches in religiöser Hinsicht homogenisiert. Stellten Nicht-Muslim*innen vor dem Ersten Weltkrieg auf dem Gebiet der heutigen Türkei etwa 20 Prozent der Bevölkerung, so waren es 1918 nur noch 2,5 Prozent. Westanatolien und Thrakien wurden türkisiert, während Ostanatolien mehrheitlich kurdisch wurde.
Die Niederlage des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg schien diese Homogenisierung zu bedrohen. Mit dem Waffenstillstand, der am 30. Oktober 1918 in Moudros zwischen der Entente und dem Osmanischen Reich geschlossen wurde, übergab Letzteres die Kontrolle über weite Gebiete an Erstere. Nach langen Verhandlungen zwischen den Siegermächten und dem Osmanischen Reich führte der Waffenstillstand am 10. August 1920 zum Friedensvertrag von Sèvres. Dieser bestimmte die Übergabe von Gebieten in Ostanatolien an Armenien, die Errichtung eines kurdischen Autonomiegebietes in Südostanatolien, die Übergabe Thrakiens und der späteren Provinz Izmir an Griechenland sowie eine Kontrolle der Entente über das Gebiet um die Reichshauptstadt Istanbul, das Marmarameer, den Bosporus und die Dardanellen. Der Friedensvertrag von Sèvres beinhaltete eine Klausel, der zufolge das kurdische Autonomiegebiet eine staatliche Unabhängigkeit erhalten könnte, sollte eine Mehrheit der dortigen Bevölkerung dafür stimmen. Die letztendliche Entscheidung hierüber sollte beim Völkerbund liegen. Darüber hinaus wurden weitere Gebiete des Osmanischen Reiches als Mandatsgebiete unter englische oder französische Verwaltung gestellt, darunter die heutigen Staaten Syrien und Irak.
Der Widerstand der muslimischen Eliten gegen den Waffenstillstand und den Friedensvertrag speiste sich aus unterschiedlichen Quellen. Bereits vor Kriegsende hatte die jungtürkische Regierung angesichts der bevorstehenden Niederlage Geheimorganisationen gegründet. Diese blieben auch nach der Flucht der jungtürkischen Führung aus dem Land intakt. Eine der bekannteren Geheimorganisationen war die Karakol-Vereinigung, die sich aus ITC-Mitgliedern zusammensetzte und unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs aktiv wurde. Die Karakol-Vereinigung versorgte die entstehende türkische Nationalbewegung mit Waffen und Munition und sorgte dafür, dass Freiwillige aus Istanbul zu den Milizen in Anatolien gelangten. In der Folgezeit entstanden in vielen Regionen Anatoliens Kräfte, die sich gegen den Waffenstillstand und den späteren Friedensvertrag stellten. Die offizielle Reichsführung verlor zunehmend die Kontrolle über das osmanische Militär. Nach der griechischen Besetzung von Izmir am 15. Mai 1919 schlossen sich zahlreiche Offiziere der Reichsarmee der muslimischen Widerstandsbewegung an. Diese wurde indes zunehmend zu einer türkischen Nationalbewegung. Zu ihren Offizieren gehörten Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay und İsmet İnönü. All diese Personen machten in der späteren Republik Türkei unterschiedliche politische Karrieren.
Die türkische Nationalbewegung organisierte sich unter der Führung von Mustafa Kemal neu und beschloss auf zwei Kongressen in Erzurum (23. Juli bis 7. August 1919) und Sivas (4.–11. September 1919) ihr politisches Programm. Als Staatsterritorium forderte sie das gesamte Territorium, das zum Zeitpunkt des Waffenstillstandsabkommens von Moudros am 30. Oktober 1918 unter Kontrolle des Osmanischen Reichs gestanden hatte. Ebenso wurde die Einheit der muslimischen Bevölkerungsgruppen betont. Diese territorialen Vorstellungen standen im Widerspruch zu den Plänen der Entente, wie sie letztlich im Vertrag von Sèvres festgelegt worden waren. Die türkische Nationalbewegung definierte insbesondere die vermeintlichen Griech*innen sowie die Armenier*innen als ihre Feind*innen, erwähnte aber die Siegermächte selbst nicht unmittelbar als Feind*innen. In der Abschlusserklärung des Kongresses von Balıkesir (16.–25. August 1919) wurde dies so formuliert:
»Das einzige Ziel der nationalen Bewegung ist die Entfernung der Griech*innen, die der Feind unserer Rasse sind, aus unserer geliebten Heimat, die seit mehr als 1.500 Jahren türkisch und islamisch ist« (zitiert nach Göktürk 2008: 105).
Angesichts des Wachstums der Bewegung unter Führung von Mustafa Kemal verhandelte die Reichsregierung im Oktober 1919 mit der türkischen Nationalbewegung in Amasya über das Verhältnis beiden Akteure zueinander. Kurz nach den Verhandlungen in Amasya ordnete die Reichsführung Parlamentswahlen an, die im Dezember 1919 stattfanden und bei der überwiegend die Kandidaten der türkischen Nationalbewegung gewannen. Das Parlament verkündete im Januar 1920 den Misak-ı Milli (Nationalpakt), der im Wesentlichen die Beschlüsse und territorialen Vorstellungen der Kongresse von Erzurum und Sivas bestätigte.
Der Friedensvertrag von Sèvres bedrohte nicht nur die Interessen der türkischen Eliten. Auch die kurdischen Eliten wandten sich (trotz der Aussicht auf eine Autonomie) gegen den Vertrag. Grund dafür war der geplante armenische Staat. Dieser sollte viele Regionen in Ost- und Südostanatolien umfassen, deren Bevölkerung seit 1915 mehrheitlich kurdisch war und in denen kurdische Eliten an Macht gewonnen hatten. Sie rechneten damit, dass ein armenischer Staat den Raub von Boden und Reichtümern während des Genozids von 1915 wieder rückgängig machen wollen würde. Der Vertrag von Sèvres hätte also für die kurdischen Eliten einen Verlust an Macht und Raubgütern bedeutet – dagegen wehrten sie sich. Angesichts der Schwäche der Reichsführung schien auch ihnen die türkische Nationalbewegung die einzige Kraft zu sein, die einen armenischen Staat verhindern und die Stellung der kurdischen Eliten bewahren könne. Dementsprechend entschied sich die überwiegende Mehrheit der kurdischen Eliten, insbesondere in den kurdisch besiedelten Regionen Anatoliens, gegen den Friedensvertrag von Sèvres und damit auch gegen eine kurdische Autonomie oder gar Unabhängigkeit. Die türkische Nationalbewegung wiederum sorgte dafür, dass die ablehnende Haltung der kurdischen Eliten öffentlich bekannt wurde, etwa indem sie kurdische Persönlichkeiten offene Briefe schreiben und diese dann im Parlament verlesen und debattieren ließ. In einem Telegramm aus Erzincan, das am 26. Februar 1920 verlesen wurde, hieß es beispielsweise:
»Das Kurdentum und das Türkentum sind eine Einheit. Sie sind Brüder und Glaubensbrüder, das Vaterland gehört beiden Nationen zusammen. Sie wollen bis zum Ende der Welt in dieser islamischen Gemeinschaft und in der Gemeinschaft der Osmanen zusammenleben.«
Auch andere Botschaften aus den kurdischen Provinzen, die im Parlament verlesen wurden, betonten die Loyalität zum Osmanischen Reich und die islamische Einheit.
Die Unterstützung der kurdischen Eliten für die türkische Nationalbewegung ging auch darauf zurück, dass Letztere vor der Gründung der Republik 1923 als Bewegung für den Schutz des Osmanischen Reiches und für die Interessen der muslimischen Herrschernation aufgetreten war. In einem Telegramm an zwei kurdische Führungsfiguren vom 15. September 1919 schrieb Mustafa Kemal, dass »Türk*innen und Kurd*innen zwei unzertrennliche Geschwister« seien, die gemeinsam das Kalifat vor inneren und äußeren Feind*innen verteidigen würden. Eine ähnliche Stoßrichtung hatte Mustafa Kemals Rede im türkischen Parlament vom 1. Mai 1920:
»Die Personengruppe, die sich hier versammelt hat, besteht nicht nur allein aus Türk*innen2 oder aus Tscherkess*innen oder aus Kurd*innen oder aus Las*innen. Vielmehr ist sie eine aufrichtige Gemeinschaft aus all diesen islamischen Volksgruppen. […] Wir haben dies immer wieder wiederholt und heute gemeinsam aufrichtig beschlossen, dass wir die jeweiligen rassischen, gesellschaftlichen und geografischen Regeln [der Volksgruppen] respektieren.« (Atatürk Araştırma Merkezi 2006: 74–75)