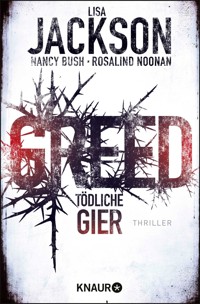
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wyoming-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die drei amerikanischen Bestseller-Autorinnen Lisa Jackson, Nancy Bush und Rosalind Noonan bündeln ihre Kräfte in "Greed – Tödliche Gier", einem hochspannenden Thriller, in dem ein psychopathischer Killer Jagd auf eine ganze Familie macht. Prairie Creek, Wyoming, USA: Vor zwanzig Jahren vernichtete ein Feuer das Anwesen der Dillinger-Familie, kostete Judd Dillinger das Leben und ließ seine Freundin für immer verkrüppelt zurück. Man beschuldigte damals einen Serien-Brandstifter, der zu jener Zeit sein Unwesen trieb. Doch heute geschehen erneut ominöse Dinge in Prairie Creek … Ira Dillinger, Patriarch der Familie, hat seine Kinder zu seiner bevorstehenden Hochzeit nach Hause beordert. Sein ältester Sohn ebenso wie dessen Geschwister sind keine großen Fans der Braut, die es in ihren Augen nur auf den Familien-Reichtum abgesehen hat. Doch sie scheinen nicht die einzigen zu sein, denen die anstehende Hochzeit ein Dorn im Auge ist. Erst wird die rituell gehäutete Leiche eines Kojoten auf der Dillinger-Ranch gefunden, dann brennt die Kirche ab, in der die Hochzeit stattfinden soll. Aus der Asche geborgen wird ein bizarr entstellter Leichnam ... "Greed – Tödliche Gier" ist der Auftakt einer Thriller-Reihe, die ein Gemeinschaftswerk von Lisa Jackson, ihrer Schwester Nancy Bush und der befreundeten Rosalind Noonan ist. Schauplatz der Thriller-Reihe wird Wyoming sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Nancy Bush / Lisa Jackson / Rosalind Noonan
Greed – Tödliche Gier
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kristina Lake-Zapp
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Prairie Creek, Wyoming, USA: Vor zwanzig Jahren vernichtete ein Feuer das Anwesen der Dillinger-Familie, kostete Judd Dillinger das Leben und ließ seine Freundin für immer verkrüppelt zurück. Man beschuldigte damals einen Serien-Brandstifter, der zu jener Zeit sein Unwesen trieb. Doch heute geschehen erneut ominöse Dinge in Prairie Creek.
Ira Dillinger, Patriarch der Familie, hat seine Kinder zu seiner bevorstehenden Hochzeit nach Hause beordert. Sein ältester Sohn ebenso wie dessen Geschwister sind keine großen Fans der Braut, die es in ihren Augen nur auf den Familien-Reichtum abgesehen hat. Doch sie scheinen nicht die einzigen zu sein, denen die anstehende Hochzeit ein Dorn im Auge ist. Erst wird die rituell gehäutete Leiche eines Kojoten auf der Dillinger-Ranch gefunden, dann brennt die Kirche ab, in der die Hochzeit stattfinden soll. Aus der Asche geborgen wird ein bizarr entstellter Leichnam …
Inhaltsübersicht
Teil eins
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Teil zwei
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Teil drei
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Teil vier
Epilog
Teil eins
von Lisa Jackson
Kapitel eins
Gott, war das kalt! Die Temperaturen bewegten sich um den Gefrierpunkt oder besser gesagt darunter. Doch was sollte man im Winter im westlichen Wyoming schon anderes erwarten? Ambers Gedanken wirbelten durcheinander wie die Schneeflocken vor ihren Scheinwerfern – Tausende winzige Flöckchen tanzten in den beiden Lichtkegeln, die die Dunkelheit der zerklüfteten Landschaft um sie herum durchschnitten.
Die Gegend hier erinnerte an ein Schwarzes Loch, doch ihr GPS zeigte eine Stadt in dem lang gezogenen Tal vor ihr an, weniger als fünf Meilen entfernt. Hoffentlich fand sie dort eine Vierundzwanzig-Stunden-Tankstelle, wo sie eine Pause einlegen und tanken konnte! Laut Benzinanzeige war der Tank noch ein Viertel voll, doch man musste vorsichtig sein, hier draußen, am Ende der Welt. Meilenweit nichts als Dunkelheit – das war ihr Eindruck von Wyoming. Amber hasste das Gefühl, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein, es machte sie höllisch nervös.
Doch andererseits machte sie in letzter Zeit alles nervös, nicht zuletzt Roberts Eltern. Sie hatte sie bereits kennengelernt, im Sommer, und sie hatten sich so einige Schlagabtausche geliefert. Diesmal allerdings war die ganze Familie drei lange Tage zusammengekommen, um gemeinsam Thanksgiving zu verbringen, und Frankie und Philip Petrocelli waren einander unaufhörlich an die Kehle gegangen. Von dem Moment an, in dem Phil den Truthahn nicht perfekt tranchiert hatte, bis Mitternacht, als Frankie auf der Treppe stolperte – »Ups, das war wohl ein Manhattan zu viel!« –, hatten sie mehr als deutlich ihren Abscheu füreinander kundgetan.
Sie wäre doch verrückt, in diesen Haufen Irrer einzuheiraten! »Komm endlich zur Vernunft«, murmelte sie und warf einen Blick in den Rückspiegel. Robert war für gewöhnlich ein echt süßer Kerl, das genaue Gegenteil seiner verbitterten, boshaften Eltern. Allerdings hatte ihr dieser Besuch eine andere Seite ihres Beinahe-Verlobten gezeigt. Während des Großteils ihres Aufenthalts hatte er in völliger Lethargie die Gehässigkeiten seiner Eltern an sich abprallen lassen und war nur aus seinem Dämmerzustand erwacht, als »zufällig« seine Exfreundin Joy hereinschneite. Nur Joy hatte ihn aus seiner düsteren Starre herausreißen können.
Eigentlich hatte Amber geplant, bis Montag zu bleiben und mit Robert zurückzufahren, doch als Roberts Eltern beim Mittagessen schon wieder zu streiten begonnen hatten, war sie froh gewesen, den Reißverschluss ihres Koffers zuziehen und den verrückten Petrocellis adios, sayonara, au revoir und Auf Nimmerwiedersehen sagen zu können.
»Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm«, murmelte sie und fummelte am Suchlauf des Autoradios. Endlich fand sie einen Sender, doch sie konnte Adeles Stimme vor lauter Rauschen kaum hören. Daher stellte sie das Radio aus, was ihre schlechte Laune noch weiter in den Keller sacken ließ.
Vielleicht sollte sie sich die Sache mit dem »Bis dass der Tod uns scheidet« noch mal überlegen. Vielleicht keine gemeinsame Zukunft mit Robert planen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass sie einen Rückzieher machte. Mit ihren sechsundzwanzig Jahren war sie »dem Einen« anscheinend noch nicht begegnet. Während ihre Highschool- und Collegefreundinnen damit beschäftigt waren, ihre Hochzeiten zu planen oder letzte Hand an die Einrichtung des Kinderzimmers zu legen, stand sie kurz davor, mit dem einzigen Mann Schluss zu machen, mit dem sie je ernsthaft über das Thema Ehe gesprochen hatte.
»Toll«, sagte sie gereizt und spähte mit zusammengekniffenen Augen durch die Windschutzscheibe. Robert war sauer auf sie, weil sie vorzeitig abgereist war. Sie wusste nicht, ob sie das wieder hinbiegen konnte, aber sie wusste auch nicht, ob sie das wirklich wollte.
Trotz der auf Hochtouren arbeitenden Lüftung begannen die Scheiben zu beschlagen, die Heizung blies kaum warme Luft ins Wageninnere. Hier oben in den Bergen war es scheußlich kalt.
Amber griff nach ihrer Handtasche auf dem Beifahrersitz, tastete nach den Zigaretten und stellte fest, dass nur noch eine in der Packung steckte. Großartig. Obwohl sie geschworen hatte, mit dem Rauchen aufzuhören – ebenfalls eine von Roberts tollen Ideen –, hatte sie in Wahrheit nicht vor, mit dieser Angewohnheit Schluss zu machen, zumindest nicht vor Neujahr. Womit sie noch sechs Wochen lang so viel rauchen konnte, wie sie wollte. Silvester um Punkt Mitternacht würde sie aufhören, und zwar radikal.
Gerade als sie die Zigarette anzündete, kam das Neonschild eines Diners in Sicht. Amber kurbelte das Fenster nur so viel hinunter, dass der Rauch abziehen konnte, ohne dass die kalte Luft von draußen das Wageninnere in eine Eishöhle verwandelte.
Sie vermisste Kalifornien. Noch fünfzehn Stunden bis Sacramento, vielleicht mehr, je nach Wetter und Straßenverhältnissen und wie lange sie durchhalten würde. Sie hatte bereits den ganzen Weg über die Staatsgrenze von Montana nach Billings zurückgelegt.
Amber setzte den Blinker, bog vom Highway ab und stellte fest, dass es in Big Bart’s Restaurant auch eine Bar gab – die Buffalo Lounge, in der laut Reklameschild jeden Samstagabend Livemusik gespielt wurde.
Endlich ein Lichtblick an diesem trostlosen Abend!
Statt eine Tasse heißen Kaffee und einen Hamburger zu bestellen, würde sie sich einen Drink gönnen … oder einen Irish Coffee. Ja, das klang gut. Mit Schlagsahne. Vielleicht konnte sie den Barkeeper überreden, einen Spritzer Crème de Menthe obendrauf zu geben – immerhin war Thanksgiving. Hmmm!
Vor lauter Vorfreude lief ihr das Wasser im Mund zusammen, als sie auf den fast leeren Parkplatz des Big Bart’s einbog. Sie holperte durch ein Schlagloch, das von einer Schneeschicht verdeckt war. Der fünfzehn Jahre alte Honda setzte unangenehm hart mit der Unterseite auf.
»Verdammt!«, murmelte sie. Hoffentlich war die Achse nicht gebrochen. Zum Glück war der kleine Civic unverwüstlich und hatte schon einiges ausgehalten.
Sie nahm ihre Handtasche vom Beifahrersitz, stieg aus, sperrte die Tür ab und stapfte durch den Schnee zum Eingang. Die große Glastür wurde umrahmt von einer Weihnachtskette, deren Lichter nur zur Hälfte brannten. Oh, richtig. Bald war Weihnachten!
Als sie eintrat, schlug ihr ein Hitzeschwall entgegen. Herrlich! Sie hoffte, ihre Zehen würden auftauen, bevor sie sich an die Weiterfahrt machte. Der Eingangsbereich führte zu einem kleinen Treppenabsatz, dann teilte er sich. Amber blieb stehen, um einen Blick in den Spiegel an der Wand zu werfen. Obwohl die Haut um ihre Augen herum müde und leicht gequollen war, sah sie umwerfend aus. Ihr schwarzes Haar glänzte bläulich in dem gedämpften Licht. André, ihr Hairstylist, hatte ordentlich zugelangt, aber die Farbe war jeden Penny wert. Sie wandte sich ab von dem hell erleuchteten Restaurantbereich und ging Richtung Lounge, von wo ihr laute Country-and-Western-Musik entgegenwummerte.
Amber rutschte auf einen leeren Hocker am Ende der Bar und bestellte ihren Irish Coffee bei einem großen, hageren Barkeeper mit einem Goldzahn, der schimmerte, wenn er lächelte.
»Ausweis?«, fragte er.
Seufzend durchwühlte Amber ihre Handtasche, frustriert darüber, dass sie immer wieder nach ihrem Ausweis gefragt wurde, obwohl sie weit über einundzwanzig war. Sie entdeckte ihren Führerschein und schob ihn dem Barkeeper über den Tresen.
»Ein Irish Coffee, kommt sofort, Amber.« Er zwinkerte ihr zu, als er ihr den Führerschein zurückreichte, was sie nur noch mehr aufbrachte.
Während sie auf ihr Getränk wartete, schaute sie sich in der Lounge um. Außer ihr saßen zwei weitere Gäste an der Bar, mehrere Pärchen besetzten die Tische, die um eine kleine runde Tanzfläche vor der Bühne angeordnet waren. Anscheinend hatte sie den Samstagabendansturm verpasst. Sollte tatsächlich eine Band gespielt haben, war sie längst fort. Die Bühne war leer, abgesehen von ein paar Mikrofonen an der Rückwand.
Ihr Irish Coffee wurde serviert, wie gewünscht mit einem Schuss grünem Pfefferminzlikör. »Sláinte, Missy«, sagte Goldzahn mit erbärmlichem irischem Akzent.
Amber griff nach der Karte und lauschte mit halbem Ohr Randy Travis, der eine Ballade zum Besten gab. Als sie an ihrem Drink nippte, stellte sie fest, dass sich ihre verspannten Schulter- und Nackenmuskeln lockerten, und beschloss, sich etwas zu gönnen. Zum Teufel mit ihrer Diät! Was machte es schon, dass sie fünf Pfund abnehmen musste? Es war schließlich nicht so, dass sie sich in absehbarer Zeit in ein Hochzeitskleid quetschen musste. Entschlossen bestellte sie Hähnchensticks mit Pommes frites, dann leerte sie mit großen Schlucken ihren Irish Coffee.
Einige Biertrinker an einem der Tische schoben ihre Stühle zurück und nahmen Billardqueues von dem Halter an der Wand neben dem Pooltisch.
Die Bälle klackerten laut, die Pärchen an den anderen Tischen lachten und scherzten und schlossen Wetten auf die Spieler ab, während aus den Lautsprechern ein Countrysong dudelte, den Amber nicht kannte. Als ihr Essen kam, hatten ihre Zehen aufgehört zu kribbeln. Genüsslich tauchte sie eine fettige Fritte in ein Pappschälchen mit Ranch-Dressing. Ja, ihr Blut zirkulierte wieder. Der Barkeeper fragte sie, ob sie noch einen Drink wünsche, und sie nickte. Der erste Irish Coffee zeigte bereits seine Wirkung, aber die würde schon verfliegen, wenn sie die Hähnchensticks und die Pommes im Magen hatte.
Jetzt erst bemerkte sie den Mann, der an der Ecke der L-förmigen Bar saß, dem Aussehen nach ein Cowboy. Ein großer Mann mit breiten Schultern, der seinen schwarzen Stetson tief in die Stirn gezogen hatte. Genau ihr Typ. Sie hatte immer schon auf große Männer gestanden, aber das hatte sie Robert, der nur ein paar Zentimeter größer war als sie selbst, nie gesagt. Dieser Cowboy sah echt zum Anbeißen aus. Lecker.
Er beobachtete sie, nicht direkt, sondern im Spiegel hinter der Bar. Als sie seinen Blick in dem reflektierenden Glas auffing, wandte er sich eilig ab, doch nur für einen kurzen Moment, dann musterten seine durchdringenden Augen sie erneut. Er deutete ein Lächeln an, hob sein Glas und nahm einen großen Schluck von seinem Bier.
Amber hob ihr Glas mit dem zweiten Irish Coffee, was schließlich noch lange kein Flirten war. Zu dem Stetson trug der Cowboy Jeans und eine warme Jacke, scheinbar die Uniform aller männlichen Gäste in der Buffalo Lounge.
Tu’s nicht, Amber. Spiel nicht mit einem Mann, den du nicht kennst. Denk an Robert, und sei um Himmels willen vorsichtig. Ja, der Typ ist heiß. Na und? Sei einmal im Leben clever und verkneif dir dieses Abenteuer. Du weißt, dass es sich in der Regel ohnehin nicht lohnt.
Sie tauschte ein paar weitere Blicke mit dem Kerl, dann widmete sie sich ihrem zweiten Drink. Ein paar Minuten später begegneten sich ihre Augen erneut. Er tippte mit dem Finger an seine Hutkrempe, legte ein paar Scheine auf den Tresen und glitt von seinem Hocker, wobei er ihr einen weiteren Blick zuwarf, diesmal direkt, nicht über den Spiegel. Er nickte, als wolle er ihr stummes Gespräch bestätigen, dann schlenderte er lässig zur Rückseite der Lounge, entweder um zur Toilette zu gehen oder um den Laden durch den Hinterausgang zu verlassen.
Amber sah ihm nach. Albernerweise spürte sie Enttäuschung in sich aufsteigen, als er in einem spärlich beleuchteten Durchgang verschwand. Wie blöd war das denn? Der Irish Coffee hatte ihr anscheinend das Hirn vernebelt. Immerhin war sie inoffiziell – kein Ring! – mit Robert verlobt, und wenn er nach Sacramento zurückkehrte, würde sie ein klärendes Gespräch mit ihm führen müssen. Entweder lag in diesem Jahr ein stattlicher Diamant unter dem Weihnachtsbaum, oder er bekam an Neujahr einen ordentlichen Tritt in den Hintern. Das Rauchen aufzugeben war nicht ihr einziger Neujahrsvorsatz. Sie würde nicht nur Zigaretten, sondern auch Losern abschwören, die sich nicht binden wollten.
Amber ließ die Hälfte der zu lange frittierten Hähnchensticks und ein paar Pommes liegen und bestellte einen dritten Irish Coffee, den sie innerhalb der nächsten halben Stunde zusammen mit einem Glas Wasser trank. Als sie bezahlte, fühlte sie sich leicht benebelt. Hm. Vielleicht sollte sie in diesem Zustand lieber nicht Auto fahren, aber in der Buffalo Lounge konnte sie auch nicht bleiben. Gästezimmer hatte das Big Bart’s nicht. Leider. Sie würde weiterfahren müssen.
Ausgeschlossen, dass sie es bis Sacramento schaffte, auch wenn die Straßen zu dieser späten Stunde so gut wie leer waren. Schon Salt Lake City wäre eine Herausforderung. Sie stützte den Ellbogen auf die Bar und den Kopf auf ihre Faust, um ihre müden Gedanken zu sortieren.
Am besten suchte sie sich eine Unterkunft für die Nacht.
Amber nahm ihre Handtasche, zog den Reißverschluss der Jacke hoch und beschloss, der Straße zu folgen, bis sie zum nächsten Motel kam. Am Morgen konnte sie sich dann frisch und ausgeschlafen auf den Weg nach Sacramento machen.
»Klingt nach einem guten Plan«, murmelte sie, als sie das Big Bart’s verließ und über den schlaglochübersäten Parkplatz zu ihrem Wagen ging. Wolken verdeckten den Mond, es hatte nicht aufgehört zu schneien. Bibbernd blieb sie vor ihrem blauen Honda stehen und erstarrte. Der Vorderreifen, mit dem sie zuvor durch das Schlagloch geholpert war, war völlig platt.
»Verdammt!«, fluchte sie leise. Auch wenn ihr Vater ihr beigebracht hatte, wie man einen Reifen wechselte, als sie ihren Führerschein machte, wusste sie nicht, ob ihr Ersatzreifen funktionstüchtig war und ob sie einen Wagenheber dabeihatte und was auch immer man sonst noch zum Reifenwechseln brauchte.
Und jetzt?
Sie konnte wieder hineingehen, um Hilfe bitten oder sich ein Taxi bestellen, das sie – wohin brachte? Mist. Ob es ihr gefiel oder nicht, sie wäre vollends auf die Freundlichkeit Fremder angewiesen. Der bitterkalte Wind, der durchs Tal pfiff, fuhr ihr durch die Jacke und biss in ihre Augen.
»Brauchst du Hilfe?«, fragte eine raue Stimme hinter ihr.
Sie drehte sich um und sah den Kerl mit dem schwarzen Stetson über den Parkplatz kommen.
Erleichtert stammelte sie: »Mein Reifen – er ist platt wie ein Pfannkuchen.«
»Lass mal sehen.« Er trat um den Honda herum zur Fahrerseite und ging vor dem Vorderreifen in die Hocke. »Ja. Das schaut böse aus. Sieh mal hier …« Er deutete auf den Reifen, richtete sich auf und trat ein kleines Stück zurück, damit sie den Schaden begutachten konnte.
War es nicht seltsam, wie sich manche Probleme einfach von selbst lösten? Dass sich der große Cowboy aus der Bar als ihr Retter entpuppen sollte, hätte sie niemals gedacht, und vielleicht wäre er ja nicht nur ihr guter Samariter, sondern ein Freund, ihr Geliebter, wenn die Dinge in die richtige Richtung liefen. Gegen sein Schicksal kam man nun mal nicht an.
»Sieht nicht so aus, dass ich damit fahren kann …« Ihre Augen waren auf den platten Reifen gerichtet, als er plötzlich eine schnelle Bewegung machte. Amber zuckte zusammen.
Bevor sie zur Seite springen konnte, packte er sie und drückte sie an sich.
»He!«, rief sie, halb erschrocken, halb fasziniert, bis er ihr die Hand über den Mund legte. Sein dicker Lederhandschuh erstickte ihren Schrei.
Panik durchfuhr sie. Was zum Teufel ging hier vor?
All die grauenvollen Geschichten, die sie über Vergewaltigungen und Entführungen gehört hatte, schossen ihr durch den Kopf. O nein! Dass das ausgerechnet ihr passierte! Sie musste ihn aufhalten. Nicht, dass sie das konnte, dazu war er viel zu groß und kräftig. Aber vielleicht ein anderer Gast, der in diesem Augenblick die Bar verließ …
Sie wand sich in seinen Armen, trat nach seinen Beinen, doch er zuckte nicht mit der Wimper. Ein Baum von einem Mann.
»Sei ein braves Mädchen, dann wird dir nichts passieren«, flüsterte er ihr ins Ohr. Seine Stimme triefte vor Bosheit.
O mein Gott! Du musst ihn zur Vernunft bringen! Wehr dich! Sollte man so nicht mit potenziellen Vergewaltigern umgehen?
Ihr Blick schweifte über den Parkplatz zum Lokal. Hoffentlich öffnete jemand die Tür und eilte ihr zur Rettung! Bitte, lieber Gott, bitte mach, dass die Tür aufgeht!
Sie spürte, wie er das Gewicht verlagerte, seinen Griff minimal lockerte, und nutzte die Gelegenheit, erneut nach ihm zu treten und ihre Arme zu befreien. Gleichzeitig biss sie, so fest sie konnte, in seinen Handschuh, der nach Staub und Schmutz und altem Leder schmeckte.
Wieder zuckte er nicht mit der Wimper.
Sie warf sich gegen ihn, doch sein tiefes, kehliges Lachen zeigte ihr, dass ihre Bemühungen vergeblich waren.
Denk nach, Amber. Irgendwie musst du diesen Hurensohn austricksen!
In diesem Moment sah sie das Messer in seiner freien Hand. Die lange, scharfe Klinge blitzte im schwachen Schein der Parkplatzlaterne. Ach du lieber Himmel!
Als sie einen neuerlichen verzweifelten Anlauf unternahm, sich zu befreien, hob er sie einfach von den Füßen und trug sie zu einem Schneehaufen hinter dem Abfallcontainer. Hier hinten würde sie keiner der Gäste sehen, die aus dem Big Bart’s auf den Parkplatz traten. Keiner!
»Lass mich los!« Ihre Worte waren kaum zu verstehen, doch tatsächlich löste er seinen Griff. Sie schnappte nach Luft.
Frei! Du bist frei!
Das war ihr letzter klarer Gedanke, bevor sie mit dem Kopf auf den gefrorenen Boden aufschlug. Vor ihren Augen explodierten Sternchen.
Steh auf! Lauf weg! Sofort!
Ihr Kopf schmerzte höllisch, und ihre Knochen fühlten sich an, als wären sie aus Blei. Trotzdem riss sie sich zusammen und versuchte, sich hochzurappeln, doch dann war er plötzlich auf ihr, sein schweres Gewicht drückte ihre Brust zu Boden, starke Hände umschlossen ihren Hals und schnürten ihr die Luft ab.
»Ich sagte, du sollst ein braves Mädchen sein!«
Im schwachen Licht der Außenbeleuchtung sah sie nur seine Augen. Das pure Böse, das darin schimmerte, ließ sie schaudern bis ins Mark.
»Du tust mir weh«, krächzte sie. »Was soll das?«
Seine Lippen verzogen sich zu einem eiskalten Grinsen. »Übung macht den Meister.«
Dann hob er wieder das Messer, und Amber Barstow, umweht von Schneeflocken und den Fetzen der Musik aus der Bar, wurde klar, dass sie ihr Zuhause in Kalifornien nicht mehr wiedersehen würde.
Der Killer stand vor dem Eingang der Höhle und sah den Flocken zu, die das Tal unter einer immer dicker werdenden Decke begruben. Von hier oben konnte er den Fluss durch den weißen Vorhang sehen, eine dunkle Schlange, die sich in Richtung der funkelnden Lichter wand – Hunderte von Glühbirnen, die die tief verschneiten Straßen von Prairie Creek, Wyoming, erleuchteten.
Eine Nachteule schrie, dann war alles wieder still.
Er wischte das Blut von der Messerklinge an seiner abgewetzten Jeans ab und überlegte, was die Zukunft wohl bringen würde. Während er den scharfen Stahl reinigte, kroch der Anflug eines Lächelns über seine Lippen, und er hörte das vertraute Summen der Vorfreude in seinen Ohren.
Niemand wusste davon.
Niemand ahnte etwas.
Das Mädchen war mittlerweile seit fast einer Woche tot, und keine Menschenseele suchte nach ihm.
Der Wind heulte durchs Tal, wehte den Schnee von den Zweigen, wirbelte weiße Wolken auf und brachte die Kälte von Norden. Gut so, dachte er und duckte sich, um durch den zwischen zwei Felsen verborgenen Eingang in seine Höhle zu schlüpfen, in der ein wärmendes Lagerfeuer brannte. Schwarzer Rauch stieg zur Decke empor. Gleich neben dem Feuer hing der gehäutete Kadaver eines Kojoten. Blut tropfte auf den felsigen Boden.
Es war herrlich gewesen, ihn zu töten.
Mit bloßen Händen und seinem Messer. Wieder dachte er voller Wonne daran, wie die Klinge durch das zottelige Fell des Kojoten geglitten war. Hörte erneut sein Todesgeheul, sah die noch schnappenden Zähne. Durchlebte noch einmal den Rausch des Tötens, spürte, wie das Tier kapitulierte, sein Leben aushauchte, einen letzten schaudernden Atemzug tat.
Das Feuer zischte. Er machte seit Jahren Jagd auf Tiere, aber sie waren leichte Beute. Ließen sich leicht überlisten.
Menschen dagegen … Menschen waren die ultimative Herausforderung, das oberste Ziel.
Sein Daumen strich über den Messergriff, als er sich in Erinnerung rief, wie er die Frau getötet hatte: der plötzlich schlaffe Körper in seinen Armen, das Blut, das aus ihrem Hals sprudelte, der Schock in ihren Augen, als sie ihren letzten gurgelnden Atemzug tat. Er spürte, wie er eine Erektion bekam. Sie war so naiv gewesen, ein blökendes Lämmchen, das man zur Schlachtbank führte. Sie umzubringen hatte sich als Kinderspiel erwiesen.
Die Vorstellung ließ ihn schaudern vor Lust, dabei war sie lediglich eine Art Generalprobe für die ganz große Vorstellung gewesen.
Er hatte ihren Leichnam gut versteckt, hatte sie auf einer Plane ausgeweidet, lang nachdem er sie in seinem Wagen hierher verfrachtet hatte, ohne einen einzigen Blutstropfen auf dem Parkplatz zu hinterlassen. Darauf hatte er geachtet. Niemand hatte auch nur den leisesten Schimmer, was hinter dem Abfallcontainer passiert war. Niemand schien sie zu vermissen. Die arme Amber. So hieß sie laut dem Führerschein, ausgestellt in Kalifornien, den er in ihrer Handtasche entdeckt hatte.
Doch jetzt war es Zeit, den nächsten Schritt zu tun. Deshalb war er hier. Die Dillingers … Ihre Ranch erstreckte sich unter ihm … ihre schwarzen Seelen … ihre Zeit war gekommen.
Er musste jetzt ganz besonders vorsichtig sein. Sorgfältig vorgehen.
Mit beiden Händen umfasste er den Griff des Messers und hob es über den Kopf, spürte, wie ihn die Macht des Tötens überkam, ihm Auftrieb verlieh, in eine höhere Bewusstseinsebene beförderte.
Könnt ihr mich spüren?, fragte er stumm seine Beute.
Ich komme, euch zu holen.
Kapitel zwei
Sabrina drückte mit der Schulter die Glastür der Tierklinik von Prairie Creek auf. In den Händen hielt sie einen Becher Kaffee, den sie bei Molly’s Diner gekauft hatte, ihre Handtasche, ihre Notebook-Tasche und die Geschäftspost, die sie aus dem Briefkasten genommen hatte.
»Oh, Dr. Delaney, prima, dass Sie die Post mitgebracht haben!«, rief Renee, die Empfangssekretärin der Tierklinik, und wedelte mit einem Briefumschlag. »Sehen Sie mal, was ich gestern entdeckt habe!« Sie saß bereits an ihrem Schreibtisch, ausstaffiert mit einem Headset, um eingehende Telefonate entgegenzunehmen, und hatte die Geschäftskarten und Broschüren auf dem Empfangstresen zurechtgerückt. Obwohl es noch gute zehn Minuten waren, bis die Klinik offiziell öffnete, hatte Renee bereits ihren Computer hochgefahren und den Terminplan für den heutigen Tag aufgerufen.
Sabrina klopfte sich auf der Fußmatte am Eingang den Schnee von den Stiefeln. Der Geruch nach Desinfektionsmitteln schlug ihr entgegen. Gepolsterte Bänke säumten die Wände, der Fußboden war zerkratzt von Tausenden ängstlicher Pfoten.
Die Klinik gehörte ihr – zur Hälfte. Das war eines ihrer großen persönlichen Ziele gewesen: in ihrer eigenen Praxis zu arbeiten und in Prairie Creek zu bleiben. Jeden Tag dankte sie ihren Glückssternen, dass sie dieses Ziel von der Liste mit den Dingen streichen konnte, die sie im Leben erreichen wollte.
Nun ja … fast jeden Tag, dachte sie jetzt und stellte ihren Kaffee ab, um nach dem dicken Umschlag zu greifen, den Renee durch die Luft schwenkte.
»Sieht aus wie eine Hochzeitseinladung!«, rief die Empfangssekretärin aufgekratzt.
»In der Tat.« Es war die Einladung, um die sie meinte, herumgekommen zu sein. Praktisch alle, die die Dillingers kannten, hatten eine Einladung erhalten, und sie hatte sich gefragt, ob man sie versehentlich vergessen hatte. Nein, das stimmte nicht ganz, sie hatte es gehofft. Etwas missmutig schaute sie auf den Poststempel und stellte fest, dass der Brief schon vor sechs Wochen abgeschickt worden war. Renees Lächeln wurde unsicher.
»Ich weiß. Meine Schuld«, sagte sie schnell, noch bevor Sabrina ein Wort hervorbringen konnte. »Ich, ähm, ich … ich glaube, ich hab den Brief zwischen die Werbepost gesteckt und zum Altpapier gegeben, und dann … na ja, dann hab ich ihn plötzlich aus einem Stapel aussortierter Zeitschriften herausragen sehen, einen Blick draufgeworfen und festgestellt, dass er an Sie adressiert ist. Es tut mir leid.«
»Schon gut«, winkte Sabrina ab. »Aber …«
»Ich verspreche, dass ich in Zukunft sorgfältiger mit der Post umgehe. Ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte.« Renee blinzelte hinter ihren Brillengläsern, als würde sie jeden Augenblick in Tränen ausbrechen.
»Es ist nicht schlimm, wirklich.« Und das war es auch nicht. Renee Aaronson war für gewöhnlich ausgesprochen zuverlässig, und sie hatte eine charmante Art, mit den Kunden umzugehen. Außerdem konnte sie mehrere Telefonate gleichzeitig führen und noch dazu einen kläffenden Chihuahua oder eine panische Siamkatze beruhigen oder – noch schlimmer – ihre Besitzer, die vor lauter Sorge nicht selten völlig aus dem Häuschen gerieten. Sabrina hätte Renee beinahe gestanden, dass es ihr lieber gewesen wäre, die Einladung wäre im Altpapiercontainer gelandet, aber sie wollte der jungen Frau nicht ihre Lebensgeschichte aufdrücken.
»Wirklich, Dr. Delaney, das kommt nicht wieder vor.«
»Gut. Also«, fuhr sie fort, bemüht, das Thema zu wechseln, »haben wir heute einen vollen Terminplan?«
»Rappelvoll.« Renee schaute auf den Bildschirm. »Wow. Ja. Ein Termin nach dem anderen. Und das ohne Notfälle.«
»Dann mache ich mich mal lieber an die Arbeit.« Sabrina schob bereits die halbhohe Schwingtür zum hinteren Teil der Klinik auf. Eilig ging sie den kurzen Flur entlang zu ihrem winzigen Büro – nicht viel mehr als ein Kabuff –, wo sie ihre Jacke gegen einen lila Kittel und ihre Stiefel gegen die Schuhe tauschte, die sie bei der Arbeit zu tragen pflegte.
Anschließend warf sie einen prüfenden Blick in den Spiegel hinter der Tür. Ihr honigblondes Haar war zu einem ordentlichen Zopf geflochten, der normalerweise einen ganzen hektischen Arbeitstag lang hielt. Die Stirn in Falten gelegt, musterte sich Sabrina nüchtern. Ihre Haut war noch immer glatt, die warmen, bernsteinfarbenen Augen machten ihr scharf geschnittenes Gesicht mit den hohen Wangenknochen und der geraden Nase weicher. Nein, sie war nicht mehr das Mädchen, das sich vor fast zwanzig Jahren in Colton Dillinger verliebt hatte, aber im Großen und Ganzen hatte sie sich gut gehalten.
Sabrina setzte sich an ihren Schreibtisch, öffnete den Briefumschlag und zog eine Einladung zur Hochzeit von Pilar Larson und Ira Dillinger heraus, die am letzten Wochenende vor Weihnachten stattfinden sollte.
Kopfschüttelnd fragte sie sich, ob Colt ebenfalls zur Hochzeit käme und was er denken würde, wenn sie einander nach so langer Zeit wieder gegenüberstünden. Was war bloß los mit ihr, dass ihr diese Romanze auch nach zwei Jahrzehnten noch unter die Haut ging?
Ihr Blick blieb an einem kleinen Kärtchen hängen, das zusammen mit einem adressierten Umschlag ebenfalls aus dem großen Büttenumschlag gefallen war. R.s.v.p. – die französische Variante von »Um Rückantwort wird gebeten«.
»Na prima«, murmelte sie, da die Frist für ebendiese Rückantwort längst verstrichen war. Sie überlegte, ob sie sich eine Ausrede einfallen lassen sollte, um nicht an der Veranstaltung teilnehmen zu müssen, doch da die Dillingers zu den besten Kunden der Klinik gehörten, schien ihr das nicht unbedingt vorteilhaft. Davis Featherstone, der Vorarbeiter der Rocking-D-Ranch, wusste bereits, dass sie in jener Woche Dienst hatte, weil Antonia nicht in der Stadt sein würde. »Da nutzt selbst lügen nichts«, murmelte sie.
»Wieso willst du lügen?«, fragte eine Stimme von der Tür her. Sabrina blickte auf und sah ihre Partnerin hereinkommen. Sie hatte ihr glänzendes, dunkles Haar zu einem Knoten geschlungen, der die meisten Frauen wie eine Schuldirektorin hätte aussehen lassen, doch nicht Antonia. »Hab ich dich bei einem Selbstgespräch oder irgendwelchen frühmorgendlichen Bekenntnissen unterbrochen?«
Sabrina warf die elegante Büttenpapierkarte auf den Schreibtisch. »Meine Einladung ist gekommen. Ein bisschen spät, aber hier ist sie.«
Antonia schnappte sich die Karte und fasste sie genauer ins Auge. »Wahrscheinlich standest du auf der B-Liste.« Mit ihren vierunddreißig Jahren und als ehemalige Finalistin eines Schönheitswettbewerbs war Toni genauso clever wie attraktiv.
»Nein, die Einladung ist in der Post untergegangen. Jetzt hab ich ein Problem: Einerseits möchte ich nicht unseren wichtigsten Kunden vor den Kopf stoßen, andererseits kann ich unmöglich hingehen.«
»Warum nicht?«
»Weil Colt da sein könnte.«
»Aha, deshalb war also jede Beziehung, die du seit Colt eingegangen bist, bestenfalls lauwarm. Jetzt kapiere ich!« Sie zuckte die Achseln, dann wurde sie ernst. »Hör mal, Sabrina, ihr habt euch beide weiterentwickelt. Er hat eine Familie gegründet und eine Ranch in Montana gekauft.«
»Er hatte eine Familie«, korrigierte Sabrina ein bisschen zu schnell. Colton hatte Frau und Tochter bei einem schrecklichen Autounfall verloren.
»Stimmt.« Toni zog scharf die Luft durch die Zähne. »Das war mit Sicherheit hart, aber es ist schon eine Weile her. Der Punkt ist doch, dass er ein Leben hat – ein Leben ohne dich.«
»Ich weiß.«
»Und du, du hast diese fantastische Tierklinik mit einer megafantastischen Partnerin.«
Sabrina verdrehte die Augen, aber sie musste zugeben, dass Toni mit ihren Worten ins Schwarze traf. Ihre Liebschaft mit Colton war seit Ewigkeiten vorbei. »Du hast recht. Und was mache ich jetzt mit der Einladung?«
»In der Stadt kursiert ohnehin das Gerücht, dass Colton nicht zur Hochzeit kommt. Abgesehen davon wird eine solche Sause nur alle hundert Jahre in Prairie Creek gefeiert – das kannst du dir nicht entgehen lassen, bloß weil du Schiss hast, deinem früheren Freund über den Weg zu laufen. Wusstest du, dass rein statistisch nicht mal zehn Prozent der Jugendliebeleien halten?«
»Das denkst du dir bloß aus. Außerdem hast du gut reden: Du bist bereits verheiratet.«
Antonia zog einen Kugelschreiber aus ihrer Kitteltasche, beugte sich über den Schreibtisch und rückte das beigefügte Antwortkärtchen zurecht. »Man könnte meinen, ich würde dich zum Wet-T-Shirt-Contest in Jackson Hole anmelden.« Sie steckte das Antwortkärtchen in den kleinen, adressierten Umschlag und klebte ihn zu. »Fertig. Jetzt hast du zugesagt, und du wirst einen Mordsspaß haben.«
»Unwahrscheinlich.« Sabrina streckte die Hand nach dem Umschlag aus. »Ich werde mir eine Ausrede einfallen lassen.«
»Nein.« Antonia presste das Antwortschreiben an ihre Brust und strebte zur Tür. »Tu’s für unsere Klinik. Denk an die Tiere, die darauf angewiesen sind, dass du es dir nicht mit Ira Dillinger verdirbst.«
»Das ist nicht fair.« Sabrina verschränkte die Arme.
»Das ist gut fürs Geschäft«, entgegnete ihre Partnerin grinsend.
»Ich werde trotzdem nicht hingehen, weil ich … weil ich in letzter Minute die Grippe bekomme.«
Antonia hielt den Umschlag in die Höhe. »Ach, Renee?«, rief sie durch den Flur in Richtung Empfang. »Ich hab hier etwas, was heute noch mit der Post raus muss!« Dann war sie verschwunden.
Sabrina schnaubte genervt. Sie hatte keine Lust, Colton wiederzusehen, doch was, wenn Antonia recht hatte? Vielleicht reagierte sie tatsächlich über. Colton Dillinger war nur kurz Teil ihres Lebens gewesen. Er hatte Prairie Creek und sie vor zwei Jahrzehnten hinter sich gelassen, und obwohl sie sich alle Mühe gegeben hatte, das Gleiche zu tun, war es ihr nicht gelungen.
»Aber das ist Schnee von gestern«, sagte sie laut. Sie und Colton hatten nichts mehr miteinander zu tun. Und das würde auch so bleiben.
Sie hörte den Summer an der Eingangstür, stand auf und schaute durch den Flur Richtung Empfang. Ihr erster Patient, ein kleiner, giftiger Corgi-Beagle-Gott-weiß-was-noch-Mischling, wurde soeben von seinem Herrchen hereingetragen.
Sabrina setzte ein Lächeln auf, versuchte, die Einladung für den Moment aus dem Kopf zu bekommen, und ging durch den Flur, um ihren Patienten ins Untersuchungszimmer zu bringen.
»He«, begrüßte sie den Mischling freundlich, der prompt die Lefzen bleckte, wild mit den Augen rollte und ein ohrenbetäubendes Gebell anstimmte.
»Tut nichts, was ich nicht auch tun würde«, riet Colton Dillinger den Rindern, als er das Stalltor schloss. Draußen heulte der Wind, rüttelte an Dach und Wänden und verschluckte beinahe seine Worte. Manche der Kühe muhten protestierend und scharrten mit den Hufen im Stroh. Einen Augenblick lang dachte er an den Menschen, der ihn überzeugt hatte, dass es ausgesprochen gesund war, mit seinem Vieh zu reden.
Sabrina Delaney.
Colton schmunzelte. Er hatte gehört, dass Sabrina heute Tierärztin war. Das ergab Sinn. Sie hatte sich schon früher ausgezeichnet mit Tieren ausgekannt.
Colton hatte seine Rinder während der vergangenen Tage zusammen mit Cub Jenkins, seinem Vorarbeiter, und mehreren Helfern zusammengetrieben. Er musste die Herde in Sicherheit bringen, denn von Kanada war der nächste Blizzard nach Montana unterwegs. Den Rindern machte der Schnee nicht viel aus, der Wind dagegen schon, und wenn er zu stark wehte, begaben sie sich auf die Suche nach einem schützenden Unterschlupf, was oft genug ihr Verderben war. Als Kind hatte Colton einmal mitbekommen, wie sich mehrere verirrte Rinder an einem Zaun zusammengedrängt hatten und einander erdrückten. Und jeder Rancher kannte die Geschichten über den großen Schneesturm 1949, der unzählige Rinder das Leben gekostet hatte.
Sicher, der Blizzard, der im Augenblick mit arktischen Temperaturen über diesen Teil von Montana hinwegzog, war nichts im Vergleich zu dem von 1949, aber Colton wollte sein Vieh in Sicherheit wissen. Er trat hinaus in die eisige Kälte, zog seinen Schal über Mund und Nase und schloss sorgfältig das Stalltor. Ein paar Minuten in diesem Sturm, und er wäre ein toter Mann. Eilig schwang er sich auf Mojave, einen Kiger Mustang und sein bestes Arbeitspferd, das seinen Job selbst bei schneidendem Wind und dichtem Schneefall machte.
Wenn nur manche seiner Rancharbeiter so zuverlässig wären! Colton schnaubte abschätzig, sein warmer Atem wärmte seinen mit Schnee bedeckten Schal.
Er brachte Mojave in den Pferdestall und striegelte ihn. Nachdem auch das Pferd sicher untergebracht war, wagte er sich ein letztes Mal in den Sturm hinaus. Laut Vorhersage sollte das Wetter bald umschlagen. »Das wird aber auch Zeit«, knurrte er. Seine Tiere waren in Sicherheit, aber sie würden bald unruhig werden, rastlos, was er ihnen kaum verübeln konnte.
Gebückt kämpfte sich Colt durch den Sturm zum Haus und drückte die Hintertür auf. Ein Schwall warme Luft schlug ihm entgegen. Er zog seine Stiefel aus, hängte die Jacke an einen Haken neben der Tür und schlenderte durch die Küche. Auf dem Herd stand eine gusseiserne Pfanne mit kaltem Fett, aber die konnte ruhig noch bis morgen dort stehen bleiben.
Im Wohnzimmer kniete er sich vor den Kamin, um das Feuer zu schüren. Ein weiteres Holzscheit und etwas Altpapier würden genügen. Er griff in den Papierkorb und bekam den dicken Umschlag aus Büttenpapier zu fassen.
Die Einladung.
Er zog die gedruckte Karte heraus und las sie ein letztes Mal. Sie war schon vor Wochen eingetroffen, ein cremefarbener Umschlag mit der Hiobsbotschaft.
Uns mit deiner Anwesenheit zu beehren …
Das glaubten die beiden doch wohl selbst nicht! Eine große Familienhochzeit, sein alter Herr, der den Bund der Ehe einging.
Seit der vermaledeite Umschlag eingetroffen war, drängte ihn seine Schwester Ricki, die Einladung anzunehmen, doch auch wenn er seine Schwestern liebend gern wiedersehen wollte, würde er auf gar keinen Fall einen Fuß in denselben Raum setzen wie die Braut, Pilar Larson, die nur auf Ira Dillingers Geld aus war.
Colton warf die Einladung ins Feuer und verlagerte das Gewicht auf die Fersen, um zuzuschauen, wie sich das Papier in den gierigen Flammen zusammenrollte, bevor es verbrannte. Er hatte keine Lust, seinen Vater wiederzusehen, keine Lust, wieder auf der Rocking-D-Ranch zu sein, keine Lust, Pilar zu begegnen. Am allerwenigsten aber hatte er Lust, plötzlich Sabrina gegenüberzustehen, da sie damals nicht unbedingt im Guten auseinandergegangen waren.
Was auch immer in Prairie Creek passierte – er wollte nicht Teil davon sein.
Auf einer Lichtung in einem Waldstück der Rocking-D-Ranch, auch als »Copper Woods« bekannt, nahm Davis Featherstone eine Schaufel von der Ladefläche seines Pick-ups. In der Ferne sah er den Dodge Ram seines Bosses über den Hügelkamm schnurren. Der nasse Schnee gab unter seinen Stiefeln nach, als er zu den Männern ging, die zu Pferde auf ihn warteten, bereit, mit ihm zusammen die fast erwachsenen Kälber zurück in den Unterstand zu treiben. Die jungen Black-Angus-Rinder und die weißgesichtigen Herefords waren darüber zunächst gar nicht begeistert gewesen, doch dann hatten sie sich gefügt.
Wahrscheinlich waren sie hungrig und durstig, dachte Davis. Trotz des ganzen Schnees um sie herum hatten die Rinder keine Ahnung, woher sie etwas zu trinken bekommen sollten. Er hatte schon gehört, dass Tiere im Schnee verdurstet waren.
Aber das würde den Dillinger-Rindern natürlich nicht passieren. Featherstone, noch keine dreißig, mochte für einen Ranch-Vorarbeiter jung sein, aber er hatte sich den Tieren mit Leib und Seele verschrieben und hätte diese Ranch im Schlaf führen können.
Wäre da nicht der tote Kojote gewesen.
Das grausam abgeschlachtete Tier hatte sie alle schockiert. Dabei ging es nicht allein um das Ansehen, das der Kojote in den Schöpfungsmythen der Schoschonen genoss; es war die Art und Weise, auf die man die bedauernswerte Kreatur verstümmelt hatte: mit dem Messer abgetrennte Gliedmaßen und stellenweise gehäutet.
»Könnt ihr ein Loch graben?«, fragte Davis die Männer.
Die beiden Schoschonen tauschten einen Blick. »Okay«, sagte Mick Ramhorn schließlich. »Es macht mir nichts aus, an einem anständigen Begräbnis teilzunehmen. Aber anfassen werde ich den Kojoten nicht.«
Davis hielt die Schaufel in die Höhe. »Dann lasst uns anfangen. Den Rest des Jobs muss der Boss allerdings selbst erledigen. Er müsste übrigens gleich da sein.«
Die Männer stiegen von ihren Pferden und sahen sich nach einem passenden Begräbnisort um, eine große Herausforderung in dem immer tiefer werdenden Schnee. Dann fing Lou an zu graben, während Mick in Davis’ Fußspuren zu dessen Pick-up ging, um eine Spitzhacke zu holen.
Davis drehte sich um und sah einmal mehr zu dem Baum hinüber, unter dem der Kojote lag. Innerhalb weniger Minuten hatte sich eine Schneeschicht auf dem Kadaver gebildet. Wenn er es nicht besser wüsste, hätte er gedacht, es wäre bloß ein Felsbrocken.
Er wusste es aber besser.
Der Wind schnitt ihm ins Gesicht. Er schloss die Augen, aber sie war immer noch da, die Vision von letzter Nacht – ein schmächtiger, geschmeidiger Geist, der im Schnee tanzte, ein dunkler Schatten, der Kiefernzweige durch die Luft wirbelte, als wären sie Federn, während er um den dunklen Haufen am Fuß des Baums herumwirbelte.
Ein Schneegeist bei seinem nächtlichen Tanz.
Er, Davis, hatte am Ende des Pfads am Waldrand gestanden und zunächst gedacht, der Schnee und die Kälte würden seinen Augen einen Streich spielen. Doch nachdem er eine ganze Weile angestrengt in die Dunkelheit gestarrt hatte, glaubte er, den Schneegeist zu erkennen: Kit Dillinger.
Er hatte sie ihrem Schneeritual überlassen, da er davon ausging, es handele sich um den harmlosen Tanz einer Frau, deren einziges Zuhause dieses Tal war, fernab von den Häusern und Menschen und den Problemen, die sie verursachten. Aber er hatte sich getäuscht. Als er heute Morgen zurückgekehrt war, um nach den Rindern zu sehen, hatte er den Schnee von dem Haufen gestrichen und die Zweige entfernt, die darunter zum Vorschein kamen. Der Anblick, der sich ihm bot, hatte sämtliche Alarmglocken schrillen lassen.
»Ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich hierherzubestellen.« Ira Dillinger knallte die Tür seines Dodge zu und stapfte auf die Männer zu. Er war ein großer Mann, eine echte Naturgewalt. »Ein paar von diesen Schneewehen sind größer als ein verfluchter Elefant!« Plötzlich blieb er abrupt stehen und starrte auf den verstümmelten Kadaver vor Davis’ Füßen. »Was zum Teufel ist das?«
»Ein toter Kojote.«
»Das sehe ich. Was ist mit ihm passiert?« Ira fasste den Kadaver ins Auge, ohne näher heranzutreten.
Davis wandte den Blick ab. Er hatte ohnehin alles deutlich vor Augen. Ganze Stücke von Fell und Fleisch waren fort, alles war voller Blut, der Kopf des Kojoten so gut wie vom Rumpf abgeschnitten. Die Beine waren auf Höhe des Hüftgelenks abgetrennt, ein Zahn fehlte. Es war ausgeschlossen, dass sich ein anderes Wildtier an dem toten Kojoten gütlich getan hatte, da Davis keinerlei Bisswunden erkennen konnte. Nein, hier hatte jemand auf abscheuliche Art und Weise mit einem Messer hantiert. So etwas hatte Davis noch nie gesehen.
Sein Boss runzelte die Stirn. »Sieht aus, als wäre ein irrer Schlachter über das Tier hergefallen.«
Davis nickte. »Ein Puma oder ein Wolf war das auf keinen Fall. Jemand hat den Kojoten mit einem Messer verstümmelt und gehäutet.«
Ira blickte zum Horizont, als könne er dort den Übeltäter entdecken, doch soweit sein Blick reichte, verbarg sich niemand zwischen den schneebedeckten Espen, die dieses Tal bis zu den weißen Bergen hin säumten. »Das gefällt mir gar nicht«, knurrte er nach einer Weile.
Davis nickte erneut. »Ich dachte, Sie wollten sich das ansehen. Deshalb habe ich Sie angefunkt.« Die Rancharbeiter benutzten Walkie-Talkies, weil der Empfang für Mobiltelefone in dieser Gegend bestenfalls als sporadisch zu bezeichnen war.
»Ihr wisst, dass ich für Kojoten nichts übrig habe«, gab Ira zu. »Nur ein toter Kojote ist ein guter Kojote.«
Der Spruch war typisch für Rinderzüchter. Die meisten Rancher schossen auf Kojoten, um sie davon abzuhalten, die Kälber zu reißen. Aber das hier war etwas anderes. Ein schneller, sauberer Schuss war die Sprache der Rancher, keiner von ihnen quälte ein Tier.
»Seltsame Sache. Vielleicht steckt ein Spinner dahinter, der ein Überlebenstraining in der Wildnis macht?« Er spuckte einen Strahl Kautabaksaft in den Schnee.
»Die Männer haben Angst bekommen«, ließ sich Davis vernehmen.
»Nun, sie werden sich besser fühlen, wenn sie die Sauerei beseitigt haben. Bringen wir’s hinter uns.«
Davis Featherstone schüttelte den Kopf. »Keiner von beiden wird den Kojoten anfassen. Deshalb habe ich Sie hergeholt.«
Iras Gesicht rötete sich. »Das ist doch bloß ein totes Tier! Ihr könnt ihn hier liegen lassen, bis es aufhört zu schneien, aber danach muss ihn irgendwer beerdigen.«
»Kojoten spielen in den Legenden der Schoschonen eine wichtige Rolle. Der Kojote ist zwar ein Trickster, aber verantwortlich für die Schöpfung des Schoschonen-Volks. Wer einem Kojoten übel mitspielt, muss sich auf das gefasst machen, was andere ›schlechtes Karma‹ nennen.« Davis nickte in Richtung der Männer, die in sicherem Abstand hinter ihren Pferden mit Schaufel und Spitzhacke ein Loch in den gefrorenen Boden gruben. »Sie werden ihn nicht selbst unter die Erde bringen. Der Kontakt mit dem Bösen verärgert unsere Toten.«
»Schlappschwänze«, murmelte Ira, nahm den Stetson ab und enthüllte sein dünner werdendes graues Haar. Gereizt klopfte er mit dem Hut gegen seinen Oberschenkel. Schnee stob auf. »Führen sich auf, als sei das tote Mistvieh das Werk irgendeiner höheren Macht.«
»Es ist nicht Gottes Werk, das wir fürchten. Es ist das Werk des Teufels.« Davis verschränkte die Arme vor der breiten, muskulösen Brust.
»Und die einzigen Helfer, die du hast, sind Schoschonen?«
»Das nicht, aber kein anderer wollte bei dem Blizzard hier rauskommen.«
»Na großartig. Bring mir eine Plane. Auch wenn hier alles gefroren ist, will ich nicht, dass der Kadaver Pumas oder Wölfe anlockt.« Pumas und Wölfe waren die erklärten Feinde eines jeden Rinderzüchters, und er würde kaum so verrückt sein, den Kojoten auf seinem Land liegen zu lassen wie einen Köder.
In der Zwischenzeit hatten die Männer ein ordentliches Loch ausgehoben, das tief genug war, um den Kadaver darin zu versenken. Ira schleppte den toten Kojoten dorthin und warf ihn hinein. Davis schickte die beiden Schoschonen fort und griff nach der Schaufel, um die bedauernswerte Kreatur mit Erde zu bedecken.
Ira starrte über die Felder. »Glaubst du, einer der Kincaids steckt dahinter?«, fragte er misstrauisch. Die Kincaids waren die großen Rivalen der Dillingers, deren Ranch nicht weit vom Rocking D entfernt lag. Immer, wenn etwas Schlimmes passierte, glaubte Ira, dass die Kincaids damit zu tun hatten.
Davis verkniff sich zu sagen, was er dachte: In seinen Augen war der tote Kojote ein schlechtes Omen. Noch dazu hatte er eine Dillinger am Grab des Tiers tanzen sehen. Aber das konnte sein Boss ja nicht ahnen.
»Bewahr einfach einen kühlen Kopf wegen dieser Sache«, sagte Ira, als sie fertig waren. »Und bitte sprich nicht drüber.«
»Ich bespreche geschäftliche Angelegenheiten grundsätzlich nicht mit Sam, falls Sie das meinen.« Davis’ Bruder, Sam Featherstone, war der Sheriff von Prairie Creek.
»Gut. Du kannst den anderen Männern ausrichten, dass sie besser die Klappe halten, wenn sie ihren Job behalten wollen. Wir brauchen keine Schnüffler auf der Rocking-D-Ranch, die ihre Nasen in die Angelegenheiten meiner Familie stecken.«
»Okay, Boss.«
Obwohl der so übel zugerichtete Kojote nun unter der Erde war und durch dieses Begräbnis zumindest einen kleinen Teil seiner Würde zurückerlangt hatte, wollte der Kloß in Davis’ Kehle nicht weichen. Eigentlich durfte er keine Angst haben vor einem siebzehn Jahre alten Mädchen, das auf der Ranch Tiere häutete. Mit Kit Dillinger würde er schon zurechtkommen!
Seine eigentliche Furcht galt dem, was sie zu einer solchen Tat getrieben hatte – die Lust am Töten und daran, das Opfer zu entstellen. Wenn Kit von einem bösen Geist besessen war, musste er dafür sorgen, dass sie Hilfe bekam, und wenn er sie persönlich in eine Klinik schleifte.
Und wenn nicht Kit dahintersteckte, was er inständig hoffte – nun, dann mochte Gott ihnen beistehen. Denn dann war das Böse mitten unter ihnen, unter den Menschen von Prairie Creek.
Hau ruhig ab, alter Mann, hau ab, dachte der Killer, ließ sein Fernglas sinken und schaute den sich entfernenden Fahrzeugen von Ira Dillinger und seinem Vorarbeiter nach. Die anderen Männer waren schon vor einer Weile davongeritten, aber die zwei waren geblieben, um das Tier unter die Erde zu bringen.
Ein amüsanter Anblick, erwachsene Männer im Schnee buddeln zu sehen. Die armen Schweine. Sie wussten nicht, dass das hier bloß der Anfang war. Nun, er würde sie ordentlich auf Trab halten.
Die Schlusslichter von Ira Dillingers Dodge Ram leuchteten auf, als er vor einer Abzweigung bremste, um die Strecke über den Kamm einzuschlagen. Der Killer grinste und versenkte eine Hand in der Tasche seiner Cargohose. Seine Finger stießen auf den scharfen Reißzahn, den er aus dem Kiefer des Kojoten herausgebrochen hatte. Wenn er sich bewegte, stieß er leise klappernd gegen den Schneidezahn des kalifornischen Mädchens. Nur ein kleines Andenken, das ihm half, die Erinnerung an den Akt des Tötens zu bewahren.
Den Rausch noch einmal zu erleben.
Er leckte sich die plötzlich trockenen Lippen.
Der Wind schlug ihm ins Gesicht, als er aus seinem Versteck zwischen Buscheichen und Kiefern hervortrat und langsam zu seiner Höhle zurückkehrte. Er würde bald weiterziehen, sich ein neues Versteck suchen müssen, zumal jetzt, da er wusste, dass seine Nachricht angekommen war.
Er würde sich zurückziehen, unter dem Radar bleiben. Leider konnte er sich nicht ständig aus dieser wunderbaren Vogelperspektive an ihren Qualen ergötzen, doch zum Glück gab es noch jede Menge andere Orte in den Bergen rund um dieses Tal, von denen er einen guten Ausblick hätte.
Es tat so verdammt gut, den Alten leiden zu sehen.
Kapitel drei
Colton streckte sich in seinem Lehnsessel vor dem Feuer aus, das jetzt eher glühte als brannte, und trank ein Glas Scotch. Der Schneesturm fegte ums Haus. Die Augen auf die glühenden Kohlen geheftet, ließ er seine Gedanken schweifen. Er dachte an ein anderes Feuer, das Feuer, das sein Leben verändert hatte, an den Rauch und die knisternden Flammen, die einen grauen Schleier über das warfen, was einst eine strahlende Zukunft gewesen war. Colt hatte seinen Onkel verloren und seine Freundin, vor allem aber war er von der Spur abgekommen, die er einst so klar vor sich gesehen hatte.
Jene Nacht war der blanke Horror gewesen, und Colton hatte erkennen müssen, dass auch ein geborener Dillinger nicht unfehlbar war. Ja, inzwischen wusste er das aus eigener Erfahrung.
Er setzte sich auf, stellte fest, dass er das vorgedruckte R.s.v.p.-Kärtchen mit den verschlungenen Initialen von Ira Dillinger und Pilar Larson übersehen hatte, eine Frau, die gut und gern Iras Tochter hätte sein können.
Pilar …
Er hatte früher selbst etwas mit ihr gehabt, eine kurze Affäre, nach Sabrina, nachdem er seinen Vater und die Rocking-D-Ranch verlassen hatte. Er hatte den Großteil seiner Zeit beim Rodeo verbracht, und genau dort hatte er Pilar kennengelernt. Zu jener Zeit gab es für ihn nur Pferde und Frauen. Und Alkohol. Als Rodeoreiter bekam man diese drei Dinge im Überfluss.
Pilar war eine Zeit lang an seiner Seite gewesen, ein Rausch, der nach ein paar Wochen verflog, als er zur Besinnung kam und sich von seinen Dämonen und von ihr befreite. So tief er damals auch gesunken war, hatte er doch genügend Verstand, um zu begreifen, dass eine Frau wie Pilar ihn aussaugen würde, wenn er sie ganz nahe an sich heranließ.
Kurze Zeit später war er nach Montana gezogen und hatte die Ranch gekauft. Bei einem Rodeo in Nebraska hatte er Margo kennengelernt und sich Stück für Stück aus dem emporgearbeitet, was ihm vorkam wie ein sehr tiefes, sehr finsteres Loch. Margo hatte ihm eine Tochter geboren, Darcy, und Colton hatte dem Rodeo den Rücken gekehrt, um für seine Familie da zu sein, die er von Herzen liebte. Doch all das war mit einem Schlag vorbei gewesen, als er die zwei bei einem Autounfall verlor.
Colton war in eine tiefe Depression gefallen. Erst vor Kurzem hatte er gespürt, dass sich der Nebel lichtete, und damit war der Wunsch gekommen, sich ein neues Leben aufzubauen. Er war froh, dass Cub und die Arbeiter die Ranch am Laufen gehalten hatten, während er sich mit seiner Trauer auseinandersetzen musste. Vor etwa zehn Monaten war er Pilar bei der Beerdigung seiner Mutter wiederbegegnet, wo sie Ira »ihr Beileid aussprechen« wollte. Obwohl er sein Bestes gab, ihr aus dem Weg zu gehen – er mochte weder an seine Rodeotage erinnert werden noch über den Verlust reden, den er erlitten hatte –, setzte Pilar alles daran, ihn von den Trauergästen loszueisen und allein zu erwischen.
»Rourke ist dein Sohn«, hatte sie ihm ohne große Vorrede mitgeteilt und auf den Elfjährigen in ihrem Schlepptau gedeutet. »Das dürfte dich nicht überraschen, Colt. Sieh dir den Jungen an. Er hat das Dillinger-Rot im Haar, und er ist genauso stur wie du.«
»Du lügst«, blaffte Colton aufgebracht. »Rourke ist Larsons Sohn.« Chad Larson war Pilars verstorbener Ehemann.
Pilar maß ihn mit einem beinahe mitleidigen Blick, als fände sie seine Reaktion einfach nur jämmerlich. »Rourke ist nicht Chads Sohn«, stellte sie klar, »er ist ein Dillinger.«
»Was für ein Spiel spielst du, Pilar?«, fragte er wütend.
»Mach einen Vaterschaftstest«, entgegnete sie gelassen. »Dann weißt du Bescheid.«
Am liebsten hätte er sie erwürgt. Was für eine freche Lügnerin! Andererseits … Er betrachtete Rourke und spürte, wie Zweifel in ihm aufstiegen. Ein Sohn? Auch wenn er ihr nicht glaubte, der Rotstich in den Haaren des Jungen war nicht zu übersehen. Colton war dunkelhaarig, genau wie seine Mutter und sein Bruder Tyler. Auch ihre jüngste Schwester Nell hatte die Haarfarbe ihrer Mutter geerbt. Ricki dagegen war ein Rotschopf, und Delilah, die mittlere Schwester, hatte rotgoldenes Haar. Ricki und Delilah kamen nach Ira, und Rourke vielleicht ebenfalls? Konnte das wirklich sein? Während der gesamten Bestattungszeremonie genau wie beim anschließenden Empfang im Ranchhaus hatte Colton die Augen nicht von seinem angeblichen Sohn wenden können, hatte nach Ähnlichkeiten gesucht. Es war nicht zu leugnen: Trotz der unterschiedlichen Haarfarbe war Rourke ein Ebenbild von Colton, als der im entsprechenden Alter gewesen war.
Um letzte Zweifel auszuräumen, hatte Pilar ihm Rourkes DNA geschickt, und Colton hatte einen Vaterschaftstest machen lassen, damit er sicher sein konnte, dass die Gene eine Übereinstimmung ergaben. Das taten sie. Er war Rourkes Vater. Was das anging, so hatte sie nicht gelogen. Während er noch darüber nachdachte, was er mit dieser Neuigkeit anfangen sollte, tat sich Ira mit Pilar zusammen, um »seine Einsamkeit zu mindern«. Colton konnte es nicht fassen, dass sie die Unverfrorenheit besaß, eine Liebschaft mit seinem Vater zu beginnen, aber natürlich – als geborene Opportunistin hatte sie die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Er fragte sich noch immer, warum er das nicht hatte kommen sehen.
Nachdem er wegen Rourke Gewissheit hatte, hielt er sich einfach von Ira und Pilar fern. Er war sich nicht sicher, wie er sich seinem Sohn gegenüber verhalten sollte, doch eines stand fest: Bis diese verfluchte Hochzeit vorüber wäre, würde er in Montana bleiben.
Das Eis in seinem Drink war inzwischen geschmolzen. Colton stand auf, ging in die Küche und schüttete den verwässerten Scotch in die Spüle, dann schenkte er sich einen neuen ein, diesmal ohne Eis. »Was für ein Witz«, sagte er zu seinem Hund, und als hätte der verstanden, was sein Herrchen meinte, wedelte Montana mit dem Schwanz. Teils Deutscher Schäferhund, teils Labrador mit einem ordentlichen Schuss Promenadenmischung, hatte Colt Montana sozusagen mit der Ranch gekauft. Ursprünglich hatte der Hund Breezy geheißen, was Colt ausgesprochen albern fand. Er hatte ihm einen neuen Namen gegeben, und von Stund an waren die zwei unzertrennlich gewesen.
Das frisch eingeschenkte Glas in der Hand, kehrte Colton zu seinem Sessel zurück. Nach der Hochzeit wäre sein alter Herr nicht nur Rourkes Stiefvater, sondern gleichzeitig sein Großvater, was verwirrend war und irgendwie traurig. Anscheinend wusste Ira nicht, in was er sich da hineinmanövrierte. Pilar hatte sich bereiterklärt, die Wahrheit über Rourkes Erzeuger so lange für sich zu behalten, wie Colton Unterhalt für den Jungen zahlte. Nicht mehr lange, und die Frau würde den Dillingers von beiden Seiten das Geld abgraben.
»Du kennst das Sprichwort?«, setzte er das Gespräch mit seinem Hund fort. »›Alter schützt vor Torheit nicht.‹« Aber bezog er sich auf seinen Vater oder auf ihn selbst? Er war sich nicht sicher. Mit knapp sechsundsechzig war Ira nicht wirklich alt, aber mit Sicherheit alt genug, als dass man dieses Sprichwort auf seine Ehe mit Pilar beziehen konnte.
Bei der Erinnerung an Pilars üppigen Kurven, ihre unbändige Energie und die perfekt geschwungenen Augenbrauen geriet sein Magen in Aufruhr. Ihr Lächeln war ansteckend, das Glitzern in ihren Augen geheimnisvoll. Eine echte Schönheit, dazu ausgesprochen sexy, aber, wie Colton wusste, mit einem kalten Herz aus Stein, das nur das Geld, auf das sie so verbissen aus war, höher schlagen ließ. Warum kapierte sein alter Herr nicht, dass er ausgenommen wurde wie eine Weihnachtsgans?
Aber welcher Mann wollte schon die Wahrheit erkennen, wenn sein Schwanz und sein Ego nach allen Maßstäben der Kunst gestreichelt wurden?
Du konntest ihr schließlich auch nicht wiederstehen …
Nein. Und er hatte einen Sohn, der ihn stets daran erinnern würde.
Und jetzt heiratete sie seinen Vater.
Also: Wer war am Ende der größere Tor?
Der Anblick des gehäuteten, verstümmelten Kojoten steckte Ira noch in den Knochen, als er zum Ranchhaus zurückfuhr. Sosehr er sich auch bemühte, die Warnung seines Vorarbeiters, ein wütendes Totem oder schlechtes Karma betreffend, zu verdrängen, so blieb doch ein ungutes Gefühl zurück, das ihn zwickte wie die berühmte Laus im Pelz.
Trotz des dichten Schneevorhangs lenkte er den Wagen in Richtung Süden, wo die Gebäude der ursprünglichen Ranch standen. Umgeben von einem weißen Dickicht aus Pappeln und Kiefern kam das ausgebrannte Gerippe des einst so prachtvollen alten Farmhauses in Sicht. Er war in dem Haus geboren worden, in einem der Schlafzimmer im Dachgeschoss, das es nicht mehr gab. Nichts als ein paar rußgeschwärzte Balken ragten vom ersten Stock in die Höhe. Einer von zwei hohen, gemauerten Kaminen war in sich zusammengebrochen, der zweite stand noch da, die Steine schwarz wie Ebenholz.
Ira ging vom Gas und ließ den Motor des Dodge im Leerlauf, während er die Überbleibsel des Hauses betrachtete, in dem er seine Kindheit verbracht hatte. Schon lange vor dem Feuer hatte man es gegen ein neueres, modernes Ranchhaus eingetauscht – sein jetziges Zuhause.
Schneekristalle sammelten sich auf der Windschutzscheibe. Iras Blick fiel auf sein Konterfei im Rückspiegel. Ja, die Zeit hatte ihre Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. Einst verglichen mit »dem jungen Clint Eastwood«, sah ihm nun ein alter Mann entgegen. Seit Rachels Tod schien er um Jahre gealtert zu sein. Schon lange hatte niemand mehr den Eastwood-Vergleich bemüht. Sein ehedem rotes Haar war inzwischen grau, und woher zum Teufel kamen all die Krähenfüße in seinen Augenwinkeln? Er hatte noch immer das markante Dilliger-Kinn, ein Geschenk seiner Vorfahren, und seine Augen über der römischen Nase waren so grün und scharf wie eh und je.
Er stellte den Motor aus, stieß die Fahrertür auf und wappnete sich gegen Wind und Kälte, dann verließ er den Wagen, stellte den Kragen auf und stapfte durch den Schnee zur Rückseite des ausgebrannten Gebäudes. Schnee bedeckte das verrostete Gartentor, das nur noch in einer Angel hing.
Als er im ehemaligen Garten stand, schaute er zu der Seite, an der seine Mutter unermüdlich versucht hatte, ein Gemüsebeet anzulegen. Schnee bedeckte die knorrigen Zweige der alten Obstbäume, die schon seit fast einem Vierteljahrhundert keine Früchte mehr getragen hatten.
Schneebedeckt bot das alte Farmhaus trotz der Brandschäden einen malerischen Anblick, doch die verkohlten Überreste schmerzten Ira. Auch nach all den Jahren war er noch stinksauer auf Judd. Sauer und enttäuscht und einsam. Judd war für Ira so etwas gewesen wie ein Freund, der einzige, den er je hatte.
Mit finsterem Blick betrachtete er sein ehemaliges Zuhause, als wolle er das alte Gemäuer für den Verlust seines jüngeren Bruders verantwortlich machen. Gesegnet mit wesentlich mehr Mut als Verstand, hatte sich Judd hierhergestohlen und mit Mia Collins getroffen, als das Feuer ausbrach. Ira hatte natürlich gewusst, dass sein Bruder bis über beide Ohren in die Frau verknallt war, und um die Wahrheit zu sagen: Sie war damals einfach atemberaubend gewesen, genauso sinnlich wie Pilar Larson. Ira hatte bestimmt nicht das Recht, seinem Bruder eine Moralpredigt zu halten, wenn es um Ehebruch ging, dennoch hätte er Judd, was Mia anging, zur Vernunft bringen, ihn daran erinnern müssen, dass er eine Frau und Kinder hatte, einen Sohn und eine Tochter. Aber das hatte er nicht getan. Hatte die Affäre aus taktischen Gründen gedeckt, bis sie so heiß geworden war, dass sie einen wahren Flächenbrand ausgelöst hatte.
Er schauderte, als er an das Sirenengeheul und die lodernden Flammen dachte. An den beißenden schwarzen Rauch, der in seiner Kehle brannte und die Sterne am Himmel verdeckte. Judd und Mia waren im Haus eingeschlossen, und nur Mia konnte den Flammen mithilfe von Iras Sohn Colt entkommen. Ira war fast verrückt geworden, als er seinen Sohn inmitten der Feuerhölle entdeckte.
Judd hatte keinen Retter gehabt. Er war in dem Inferno gestorben, und Ira hoffte nur, dass er am Rauch erstickt war, bevor die Flammen ihn erwischt hatten.
Es war nie herausgekommen, wer das Feuer gelegt hatte. Rick Arson, damals Chef der Feuerwehr von Prairie Creek, bis Jack Raintree sein Amt übernahm, behauptete, es habe sich um Brandstiftung gehandelt, aber wer steckte dahinter?
Es hatte Gerüchte über einen Landstreicher gegeben, einen Feuerteufel, der in den Great-Plains-Staaten sein Unwesen trieb und von Montana, Wyoming über Colorado und Oklahoma weiter nach Texas gezogen war. Das würde die Reihe von Feuern in Prairie Creek vor achtzehn Jahren erklären – Brände, die niemandem Schaden zugefügt hatten außer den Versicherungsgesellschaften, die jede Menge Dollars berappen mussten.
Ira hatte nicht an das Gerücht mit dem Landstreicher geglaubt. Für ihn hatte von jeher festgestanden, dass die Kincaids die Brandstifter waren. Ihnen gehörte das Land, das an die Rocking-D-Ranch grenzte, gutes Land, auf dem sie eine Schafzucht betrieben. Die Kincaids lagen seit Ewigkeiten mit den Dillingers im Clinch, doch in den vergangenen Jahren war die offen brodelnde Feindschaft zu einem schwelenden Flämmchen des Misstrauens heruntergekocht. Und dennoch: Weiderechte, Wasserrechte, Weidegitter und Viehroste, ob man die Straßen befestigen sollte oder nicht – jedes Thema führte unausweichlich zu neuerlichem Streit zwischen den beiden Familien. Vor Kurzem hatten die Kincaids mehrere Hütten am Fuß der Berge gleich neben dem Dillinger-Land errichtet, um die stille Landschaft in ein gottverdammtes Urlaubsgebiet oder ähnlichen Unsinn zu verwandeln. Als die Hütten fertig waren, hatten sie verlangt, dass die Dillingers ihre Rinder von den Touristen fernhielten. Ira war nicht auf diese alberne Vorstellung eingegangen. Mit der Gesundheit des Majors ging es steil bergab, und es lohnte sich nicht, sich auf ein unfaires Scharmützel einzulassen. Dennoch lebte die Feindschaft fort.
»Dämlicher alter Knacker«, murmelte Ira daher. Der Wind frischte auf, ein Sprühnebel winziger Eiskristalle nahm ihm die Sicht. Blinzelnd starrte er in den fallenden Schnee und dachte an den Pfosten ganz oben an der Treppe, der Lack abgegriffen bis aufs blanke Holz, weil Generationen von Dillinger-Kindern mit den Fingern darübergestrichen hatten. Angeblich brachte das Glück. Vor seinem inneren Auge sah er den verblichenen Läufer im Flur, der die Schlafzimmer auf der Nordseite von denen auf der Südseite trennte. Am Ende des Flurs hatte sich ein quadratisches Badezimmer befunden, nachträglich angebaut, als Innentoiletten ein Muss wurden.
All das gab es nicht mehr.
Zerstört vom Feuer.
Ira hätte die Ruine schon vor Jahren plattmachen sollen, doch er hatte es nicht übers Herz gebracht – aus Nostalgie und aus Respekt vor seinem Bruder. Rachel hatte ihn dazu gedrängt, doch als Ira sich sträubte und seiner Frau gegenüber ruppig wurde, hatte sie schnell klein beigegeben.
Jetzt wollte Pilar, dass er das Ganze abreißen ließ, weil sie an der Stelle ein Gästehaus mit einem Swimmingpool errichten lassen wollte. Einem Innenpool,





























