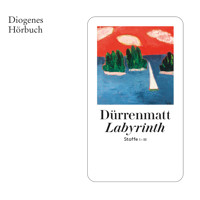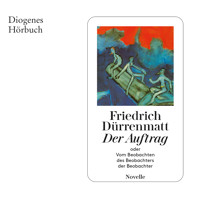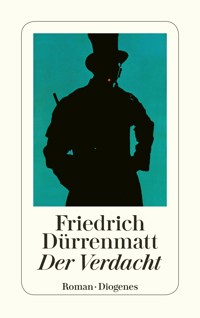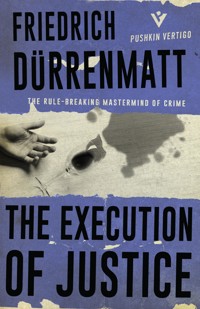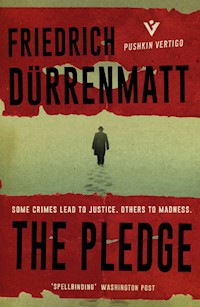Grieche sucht Griechin / Mr. X macht Ferien / Nachrichten über den Stand des Ze E-Book
Friedrich Dürrenmatt
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Arnolph Archilochos ist Unterbuchhalter eines Unterbuchhalters in der Geburtszangenabteilung einer großen Firma. Des Alleinseins müde geworden, gibt Arnolph Archilochos eines Tages ein Heiratsinserat auf, dessen Text kurz und vielsagend lautet: Grieche sucht Griechin. Und das Wunder geschieht: der dickliche Junggeselle lernt das reizendste Mädchen kennen, das man sich erträumen kann. Nur einen Fehler hat sie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Friedrich Dürrenmatt
Grieche sucht Griechin | Mister X macht Ferien | Nachrichten über den Stand des Zeitungswesens in der Steinzeit
Grotesken
Diogenes
Grieche sucht Griechin
Eine Prosakomödie 1955 [1954–55/1980]
1
Es regnete stundenlang, nächtelang, tagelang, wochenlang. Die Straßen, die Avenuen, die Boulevards glänzten vor Nässe, den Gehsteigen entlang flössen Rinnsale, Bäche, kleinere Flüsse, die Automobile schwammen herum, die Menschen gingen unter Schirmen, waren in Mäntel gehüllt, liefen mit nassen Schuhen und immer feuchten Strümpfen, die Riesen, Putten und Aphroditen, die teils die Balkone der Palais und Hotels trugen, teils sonst an den Fassaden klebten, troffen, tropften, waren übergossen von Wasserfäden, von Vogelmist, der sich auflöste, und unter dem griechischen Giebel des Parlaments suchten zwischen den Beinen und Brüsten der patriotischen Reliefs die Tauben Schutz. Es war ein peinlicher Januar. Dann kam der Nebel, auch er tagelang, wochenlang, eine Grippeepidemie, nicht gerade gefährlich für anständige, sozial gesicherte Leute, zwar einige alte Erbonkel und Erbtanten dahinraffend, einige ehrwürdige Staatsmänner, doch sonst nur massenhaft die Vagabunden unter den Brücken am Strom. Dazwischen wieder Regen. Immer wieder.
Er hieß Arnolph Archilochos, und Madame Bieler meinte hinter ihrer Theke: »Der arme Junge. So kann man doch nicht heißen. Auguste, bring ihm noch ein Glas Milch.«
Und sonntags sagte sie: »Bring ihm noch ein Perrier.«
Auguste dagegen, ihr Mann, schmächtig, der Sieger einer legendären Tour de Suisse und der Zweite einer noch legendäreren Tour de France, der im Radfahrerkostüm bediente, in seinem Maillot jaune (sammelte sich doch so ein kleines Publikum von Radsportfreunden), war damit nicht einverstanden. »Deine Liebe, Georgette«, meinte er etwa am Morgen, wenn er aufstand, oder im Bett, oder hinter dem Ofen, wenn sich alles verzogen hatte und er seine dünnen haarigen Beine wärmen konnte, »deine Liebe zu Herrn Archilochos kapiere ich nicht. Ist doch kein Kerl, ist doch ein verklemmter Mensch. Man kann doch nicht sein Leben lang nichts als Milch und Mineralwasser trinken!«
»Auch du hast einmal nichts anderes getrunken«, antwortete dann Georgette mit ihrer tiefen Stimme, indem sie die Arme in die Hüften stemmte, oder, lag sie im Bett, auf dem Busengebirge verschränkte.
»Geb ich zu«, meinte nach langem Nachdenken Auguste Bieler, immer wieder seine Beine massierend. »Doch um die Tour de Suisse zu gewinnen, und ich habe sie gewonnen, bei so hohen Pässen, und beinahe die Tour de France. Da hat der Abstinentismus noch einen Sinn. Aber der Herr Archilochos? Nicht einmal bei einer Frau schlief er je. Dabei ist er fünfundvierzig.«
Das letzte ärgerte Madame Bieler auch, und sie wurde stets verlegen, wenn Auguste in seinem Radfahrerkostüm oder im Bett darauf zu sprechen kam. Überhaupt war nicht zu leugnen, daß Monsieur Arnolph, wie sie Archilochos nannte, gewisse Prinzipien hatte. Rauchen zum Beispiel tat er auch nicht. Fluchen kam noch weniger in Frage. Georgette konnte sich ihn ferner nicht im Nachthemd vorstellen, oder gar nackt, so korrekt, so immer angezogen, wenn auch ärmlich, wirkte er.
Seine Welt war gefestigt, pünktlich, sittlich, hierarchisch. Zu oberst, an der Spitze dieser Ordnung, dieses sittlichen Weltgebäudes, thronte der Staatspräsident.
»Glauben Sie mir, Madame Bieler«, konnte Archilochos etwa sagen, indem er ehrfürchtig nach dem Bild des Staatspräsidenten im Edelweißrahmen starrte, das über den aufgestapelten Schnaps- und Likörflaschen hinter der Theke hing, »glauben Sie mir, unser Staatspräsident ist ein nüchterner Mann, ein Philosoph, ein Heiliger beinah. Raucht nicht, trinkt nicht, ist schon seit dreißig Jahren Witwer, hat keine Kinder. Sie können es in den Zeitungen lesen.«
Madame Bieler wagte nicht so ohne weiteres zu widersprechen. Vor dem Staatspräsidenten hatte auch sie, wie alle in diesem Lande, ein wenig Respekt, war er doch der einzige ruhende Pol im politischen Hin und Her, in der vorüberziehenden Folge der Regierungen, wenn ihr auch ein solcher Ausbund an Tugend unheimlich vorkam. Lieber wollte sie es nicht glauben.
»In den Zeitungen steht’s«, meinte Georgette daher zögernd. »Gewiß. Doch wie es in Wirklichkeit ist, weiß kein Mensch. Die Zeitungen lügen, sagt jeder.«
Das sei ein Irrtum, antwortete Archilochos, die Welt sei im Grunde sittlich, und trank feierlich und gemessen Perrier, als wäre es Champagner.
»Auch Auguste glaubt an die Zeitungen.«
»Nein«, sagte Georgette. »Das weiß ich besser. Auguste glaubt den Zeitungen kein Wort.«
»Nun, glaubt er etwa nicht an die Sportresultate, die in den Zeitungen stehen?«
Dagegen wußte Madame Bieler nichts einzuwenden.
»Tugend ist sichtbar«, fuhr Archilochos fort und reinigte seine randlose, verbogene Brille. »Sie leuchtet auf diesem Gesicht und leuchtet auf dem Gesicht meines Bischofs.«
Damit wandte er sich dem Bildnis zu, das über der Türe hing.
Der Bischof sei etwas sehr dick, protestierte Madame Bieler, der könne doch einfach nicht so tugendhaft sein.
Archilochos war in seinem Glauben nicht zu erschüttern.
»Seine Natur«, entgegnete er. »Wenn er nicht tugendhaft, philosophisch leben würde, wäre er noch dicker. Sehen Sie dagegen Fahrcks an. Wie unbeherrscht, wie unmäßig, wie hochmütig. Sündig in jeder Beziehung. Und eitel.«
Er wies mit dem Daumen über seine rechte Schulter nach dem Bild des berüchtigten Revolutionärs.
Madame Bieler blieb hartnäckig. »Eitel kann man doch nicht sagen«, stellte sie fest, »bei diesem Schnauz und bei diesen wilden Haaren. Und mit seinem sozialen Mitgefühl.«
Das sei nur eine besondere Art der Eitelkeit, behauptete Arnolph.
»Mir unverständlich, daß dieser Verführer hier hängt. Kam doch eben aus dem Gefängnis.«
»Oh, man kann nie wissen«, sagte dann jedesmal Madame Bieler und trank in einem Zug ein Glas Campari aus. »Man kann nie wissen. Auch in der Politik muß man vorsichtig sein.«
Der Bischof, um uns wieder seinem Bildnis zuzuwenden – jenes von Fahrcks hing an der gegenüberliegenden Wand –, dieser Bischof war Nummer zwei in der abgestuften Welt des Herrn Archilochos. Es war kein katholischer Bischof, obgleich Madame Bieler in ihrer Art eine gute Katholikin war, die in die Kirche ging – wenn sie einmal ging –, inbrünstig zu weinen (doch ebenso inbrünstig weinte sie im Kino); es war aber auch kein protestantischer, Auguste Bieler (Gödu Bielers Gusti), aus der deutschen Schweiz eingewandert (Großaffoltern), der erste Gigant der Landstraße, den die Eidgenossenschaft hervorbrachte (›Sport‹ vom 9. 9. 29), konnte ja keinen Bischof kennen als Zwinglianer (auch dies zwar nur auf seine Art: er hatte keine Ahnung, daß er Zwinglianer war), sondern der Bischof war das Haupt der Altneupresbyteraner der vorletzten Christen, einer vielleicht etwas ausgefallenen und unklaren Sekte, aus Amerika importiert, und er hing nur über der Türe, weil sich Archilochos, das Porträt unter dem Arm, bei Georgette vorgestellt hatte.
Vor neun Monaten. Draußen ein Maientag, große Sonnenflecke auf der Straße, schräge Strahlenbündel in der kleinen Wirtschaft, das goldene Radfahrertrikot Augustes noch einmal vergoldet, ebenso seine traurigen Rennfahrerbeine, die Haare flimmerndes Gewölk.
»Madame«, hatte Archilochos damals zaghaft gesagt, »ich bin gekommen, weil ich das Bild unseres Staatspräsidenten in Ihrem Lokal bemerke. Über der Theke, an einer dominierenden Stelle. Ich bin Patriot und beruhigt. Ich suche einen Platz für meine Mahlzeiten. Ein Heim. Aber es muß immer derselbe Platz sein, am besten in einer Ecke. Ich bin einsam, Buchhalter, lebe rechtschaffen und bin strenger Abstinenzler. Rauchen tue ich auch nicht. Fluchen kommt nicht in Frage.«
Dann hatten sie einen Preis ausgemacht.
»Madame«, hatte er darauf wieder gesagt, ihr das Bild überreicht und sie durch seine staubige kleine Brille wehmütig betrachtet, »Madame, dürfte ich bitten, diesen Bischof der Altneupresbyteraner der vorletzten Christen aufzuhängen. Am besten neben den Staatspräsidenten. Ich kann nicht mehr in einem Raume essen, wo er nicht hängt, und eben deshalb habe ich das Lokal der Heilsarmee verlassen, wo ich vorher aß. Ich verehre meinen Bischof. Er ist ein Vorbild, ein durchaus nüchterner, christlicher Mensch.«
So hing Georgette den Bischof der vorletzten Christen eben auf, zwar nur über die Türe, wo er stumm und zufrieden hing, ein Ehrenmann, nur manchmal von Auguste verleugnet, der jenen wenigen, die sich erkundigten, kurz und bündig antwortete:
»Ein Radsportfreund.«
Drei Wochen später kam Archilochos mit einem zweiten Bild. Eine Photographie. Eigenhändige Unterschrift. Sie stellte Petit-Paysan dar, den Besitzer der Maschinenfabrik Petit-Paysan. Es würde ihn freuen, sagte Archilochos, wenn ebenfalls Petit-Paysan hängen würde. Vielleicht an Stelle Fahrcksens. Es zeigte sich, daß im sittlichen Weltgebäude der Besitzer der Maschinenfabrik den dritten Platz einnahm.
Frau Georgette war dagegen.
»Petit-Paysan fabriziert Maschinengewehre«, sagte sie.
»Na und?«
»Tanks.«
»Na und?«
»Atomkanonen.«
»Sie vergessen den Petit-Paysan-Rasierapparat und die Petit-Paysan-Geburtszange, Madame Bieler, lauter menschenfreundliche Gegenstände.«
»Monsieur Archilochos«, sagte Georgette feierlich, »ich warne Sie, sich weiter mit Petit-Paysan zu befassen.«
»Ich bin bei ihm angestellt«, antwortete Arnolph.
Georgette lachte. »Dann nützt es gar nichts«, sagte sie, »wenn Sie Milch und Mineralwasser trinken, kein Fleisch essen (Archilochos war Vegetarier) und mit keiner Frau schlafen. Petit-Paysan beliefert die Armee, und wenn die Armee beliefert ist, gibt es Krieg. Das ist immer so.«
Archilochos war damit nicht einverstanden.
»Nicht bei uns«, rief er aus. »Bei unserem Staatspräsidenten!«
»Ach der!«
Sie kenne eben das Erholungsheim für werdende Arbeitermütter nicht, fuhr Archilochos unbeirrt fort, und die Heimstätte für invalide Arbeiterväter, die Petit-Paysan errichtet habe. Petit-Paysan sei überhaupt ein sittlicher, ja geradezu ein christlicher Mensch.
Doch war Madame Bieler nicht zu bewegen, und so kam es, daß außer den zwei ersten Vorbildern des Herrn Archilochos (bleich, schüchtern und etwas dicklich saß er in seiner Ecke zwischen den Radsportfreunden) nur noch der letzte in seiner Weltordnung an der Wand hing, das negative Prinzip, Fahrcks eben, der Kommunist, der den Staatsstreich in San Salvador und die Revolution in Borneo angezettelt hatte. Denn auch mit Nummer Vier vermochte Arnolph bei Georgette nichts zu erreichen.
Sie könnte das Bild vielleicht unter Fahrcks hängen, meinte er und überreichte Madame Bieler eine Reproduktion, eine billige übrigens.
Wer denn dies gemalt habe, fragte Georgette und starrte verwundert auf die dreieckigen Vierecke und die verbogenen Kreise, die darauf zu sehen waren.
»Passap.«
Es stellte sich heraus, daß Monsieur Arnolph den weltberühmten Maler verehrte, doch war es Georgette immer noch ein Rätsel, was denn das Bild darstellen sollte.
»Das richtige Leben«, behauptete Archilochos.
»Da unten steht aber ›Chaos‹«, rief Georgette und wies in die rechte untere Ecke des Bildes.
Archilochos schüttelte den Kopf. »Große Künstler schaffen unbewußt«, meinte er. »Ich weiß einfach, daß dieses Bild das richtige Leben darstellt.«
Doch nützte es nichts, was Archilochos dermaßen kränkte, daß er drei Tage nicht mehr erschien. Dann kam er wieder, und Madame Bieler lernte mit der Zeit das Leben des Monsieur Arnolph kennen, soweit man überhaupt von einem Leben reden konnte, so pünktlich, wohlgeordnet und schief war alles. So gab es beispielsweise in der Weltordnung des Archilochos noch die Nummern fünf bis acht.
Nummer fünf war Bob Forster-Monroe, der Ambassador der Vereinigten Staaten, zwar nicht ein Altneupresbyteraner der vorletzten Christen, sondern ein Altpresbyteraner der vorletzten Christen, ein schmerzlicher, doch nicht hoffnungsloser Unterschied, über den der in religiösen Dingen gar nicht untolerante Archilochos stundenlang reden konnte. (Er lehnte außer den anderen Kirchen nur noch die Neupresbyteraner der vorletzten Christen entschieden ab.)
Nummer sechs der Weltordnung war Maître Dutour.
Nummer sieben Hercule Wagner, der Rector magnificus der Universität.
Dutour hatte einen längst geköpften Lustmörder verteidigt, einen Hilfsprediger der Altneupresbyteraner (nur das Fleisch vergewaltigte den Geist des Hilfspredigers, die Seele blieb außerhalb, unbesudelt, gerettet); der Rector magnificus dagegen hatte das Studentenheim der vorletzten Christen besucht und sich fünf Minuten mit Nummer zwei der Weltordnung (Bischof) unterhalten.
Nummer acht war Bibi Archilochos, sein Bruder, ein guter Mensch, wie Arnolph betonte, arbeitslos, was Georgette verwunderte, war doch dank Petit-Paysan das Land beschäftigt.
Archilochos wohnte in einer Mansarde nicht weit von ›Chez Auguste‹, wie die kleine Wirtschaft des Champions hieß, und brauchte über eine Stunde, bis er seinen Arbeitsplatz im weißen, zwanzigstöckigen, von Corbusier konstruierten Verwaltungsbau der Petit-Paysan-Maschinenfabrik AG erreichte. Was die Mansarde betrifft: Fünf Stockwerke hoch, übelriechender Korridor, klein, schräg, unbestimmte Tapete, ein Stuhl, ein Tisch, ein Bett, eine Bibel, hinter einem Vorhang sein Sonntagskleid. An der Wand: erstens Staatspräsident, zweitens Bischof, drittens Petit-Paysan, viertens Reproduktion eines Bildes von Passap (viereckige Dreiecke) und so weiter bis zu Bibi hinunter (Familienbild mit Kinderchen). Aussicht: Blick auf eine schmutzige Fassade, zwei Meter vom Fenster entfernt, Abortwand, abenteuerliche Flecke, weiß, gelb und grün, in regelmäßigen Reihen offene stinkende Fensterchen, die Wand nur manchmal im Hochsommer gegen Mittag von oben verklärt, dazu der Lärm der Wasserspülungen. Was den Arbeitsplatz betrifft: mit fünfzig anderen Buchhaltern in einem großen, mit Glas unterteilten Raum, labyrinthartig, nur Zickzackgänge ermöglichend, im siebenten Stock, Abteilung Geburtszangen, Ärmelschoner, Bleistift hinter dem Ohr, grauer Arbeitskittel; Mittagessen in der Kantine, wo er unglücklich war, weil weder der Staatspräsident noch der Bischof dort hingen, nur Petit-Paysan (Nummer drei). Archilochos war nicht ein eigentlicher Buchhalter, nur ein Unterbuchhalter. Vielleicht noch genauer: Der Unterbuchhalter eines Unterbuchhalters. Kurz, einer der untersten Unterbuchhalter, soweit man von einem untersten sprechen konnte: die Zahl der Buch- und Unterbuchhalter in der Petit-Paysan AG war praktisch unendlich; doch wurde er auch in dieser bescheidenen, beinahe letzten Stellung weit besser bezahlt, als dies wiederum die Mansarde zu verkünden schien. Der Grund, der ihn in die dunkle, von Aborten umstellte Höhle bannte, war Bibi.
2
Nummer acht (Bruder) lernte Madame Bieler ebenfalls kennen.
An einem Sonntag. Arnolph hatte Bibi Archilochos zum Mittagessen eingeladen. ›Chez Auguste‹.
Bibi kam mit Weib, zwei Mätressen und den sieben Kinderchen, von denen die ältesten, Theophil und Gottlieb, beinahe erwachsen waren. Magda-Maria, dreizehn Jahre, brachte einen Verehrer mit. Bibi erwies sich als ein gottvergessener Säufer, die Frau war vom ›Onkel‹ begleitet, wie man ihn nannte, einem ausgedienten Kapitän, nicht umzubringen. Es war ein Mordsspektakel, der selbst den Radsportfreunden zuviel wurde. Theophil prahlte von seinem Zuchthausaufenthalt, Gottlieb von einem Bankeinbruch, Matthäus und Sebastian, zwölf und neun Jahre, stachen mit Messern, und die beiden Jüngsten, Zwillinge, sechsjährig, Jean-Christoph und Jean-Daniel, rauften sich um eine Absinthflasche.
»Welche Menschen!« rief Georgette entsetzt, als sich das Teufelspack verzogen hatte.
»Es sind eben Kinder«, begütigte sie Archilochos und beglich die Rechnung (einen halben Monatslohn).
»Hören Sie«, entrüstete sich Madame Bieler. »Ihr Bruder scheint eine Räuberbande zu unterhalten. Und dem geben Sie noch Geld? Fast alles, was Sie verdienen?«
Archilochos’ Glaube war jedoch nicht zu erschüttern. »Man muß den Kern sehen, Madame Bieler«, sagte er, »und der Kern ist gut. Bei jedem Menschen. Der Schein trügt. Mein Bruder, seine Frau und seine Kinderchen sind vornehme Wesen, nur diesem Leben vielleicht nicht so ohne weiteres gewachsen.«
Jetzt aber, wieder an einem Sonntag, doch schon um halb zehn, betrat er aus einem anderen Grunde die kleine Wirtschaft, eine rote Rose im Knopfloch und von Georgette mit Ungeduld erwartet. An allem waren eigentlich nur der endlose Regen, der Nebel, die Kälte, die stets feuchten Socken schuld und die Grippeepidemie, die sich mit der Zeit in eine Darmgrippe verwandelte, bewirkend, daß Archilochos, wir kennen ja sein Zimmer, infolge des nun ständigen Getöses nicht schlafen konnte. Dies alles hatte Arnolph umgestimmt, allmählich, mit den steigenden Fluten in den Straßengräben, und so hatte er nachgegeben, als Madame Bieler wieder an jenem besonderen Punkt ansetzte, der sie ärgerte.
»Sie sollten heiraten, Monsieur Arnolph«, hatte sie gesagt. »Das ist doch kein Leben in Ihrer Mansarde, und immer unter Radsportfreunden zu sitzen, geht doch auch nicht für einen Menschen mit höheren Interessen. Eine Frau sollten Sie haben, die für Sie sorgt.«
»Sie sorgen für mich, Madame Bieler.«
»Ach was, wenn Sie sich eine Frau nehmen, ist das noch ganz anders. So eine mollige Wärme, Sie werden sehen.«
Endlich hatte sie seine Zustimmung erlangt, eine Annonce in ›Le Soir‹ aufzugeben, und gleich Papier, Feder und Tinte geholt.
»Junggeselle, Buchhalter, fünfundvierzig, Altneupresbyteraner, feinfühlend, sucht Altneupresbyteranerin …«, schlug sie vor.
»Das ist nicht nötig«, sagte Archilochos. »Ich bekehre meine Frau dann schon zum richtigen Glauben.«
Georgette sah dies ein. »Sucht eine liebe, frohe Frau seines Alters, Witwe nicht ausgeschlossen …«
Ein Mädchen müsse es sein, behauptete Archilochos.
Georgette blieb fest. »Schlagen Sie sich ein Mädchen aus dem Kopf«, meinte sie energisch. »Sie waren noch nie mit einer Frau, und jemand muß wissen, wie man das macht.«
Er stelle sich die Annonce ganz anders vor, wagte Monsieur Arnolph einzuwenden.
»Wie denn?«
»Grieche sucht Griechin!«
»Mein Gott«, staunte Madame Bieler, »sind Sie ein Grieche?« und starrte die eher dicke, ungefüge und nördliche Gestalt des Herrn Archilochos an.
»Wissen Sie, Madame Bieler«, sagte er schüchtern, »ich weiß, daß man sich unter einem Griechen etwas anderes vorstellt, als ich nun einmal bin, und es ist ja auch lange her, seit mein Urahne in dieses Land wanderte, um an der Seite Karls des Kühnen bei Nancy zu sterben. Und so sehe ich denn auch nicht mehr so recht wie ein Grieche aus. Das gebe ich zu. Aber nun, Madame Bieler, in diesem Nebel, in dieser Kälte und in diesem Regen sehne ich mich zurück, wie meistens im Winter, in meine Heimat, die ich nie gesehen habe, nach dem Peloponnes mit seinen rötlichen Felsen und seinem blauen Himmel (ich las einmal im ›Match‹ darüber), und so will ich denn nur eine Griechin heiraten, denn sie wird in diesem Lande ebenso verlassen sein wie ich.«
»Sie sind der reinste Dichter«, hatte darauf Georgette geantwortet und sich die Augen getrocknet.
Und wirklich hatte Archilochos eine Antwort bekommen, schon am übernächsten Tag. Ein kleiner duftender Briefumschlag, ein blaues Kärtchen wie der Himmel des Peloponnes. Chloé Saloniki schrieb ihm, sie sei einsam, und wann sie ihn denn sehen könne.
Auf Anraten Georgettes hatte er darauf mit Chloé schriftlich ausgemacht: ›Chez Auguste‹, Sonntag, den soundsovielten Januar. Kennzeichen: Eine rote Rose.
Archilochos zog sein dunkelblaues Konfirmandenkleid an und vergaß den Mantel. Er war unruhig. Er wußte nicht, ob er doch lieber umkehren solle, sich in seine Mansarde zu verkriechen, und zum ersten Male war es ihm nicht recht, als vor ›Chez Auguste‹ Bibi wartete, kaum zu erkennen im Nebel.
»Gib mir zwei Lappen und einen Heuer«, sagte Bibi und hielt seine hohle Bruderhand hin: »Magda-Maria hat Englischstunden nötig.«
Archilochos wunderte sich.
»Sie hat einen neuen Freier, hochanständig«, erklärte Bibi, »aber er spricht nur Englisch.«
Archilochos mit seiner roten Rose zahlte.
Auch Georgette war aufgeregt, nur Auguste saß wie immer, wenn keine Gäste da waren, in seinem Radfahrerkostüm beim Ofen, die nackten Beine reibend.
Madame Bieler räumte die Theke auf. »Nimmt mich wunder, was da kommt«, sagte sie. »Schätze was Dickes, Liebes. Hoffentlich nicht zu alt, weil sie nichts davon schreibt. Aber wer tut dies schon gern.«
Archilochos, frierend, bestellte eine Tasse heiße Milch.
Und während er sich die Brille wieder einmal reinigte, die vom Milchdampf angelaufen war, betrat Chloé Saloniki das Lokal.
Archilochos, kurzsichtig, sah Chloé zuerst nur schemenhaft, mit einem großen roten Punkt irgendwo rechts unterhalb der Eiform des Gesichts, die Rose, wie er ahnte, doch das Schweigen, das in der Kneipe mit einem Male herrschte, diese gespenstische Stille, in der nicht ein Glas klirrte, in der kein Atemzug zu hören war, beunruhigte ihn so, daß er seine Brille nicht gleich aufsetzen konnte. Kaum hatte er dies jedoch getan, setzte er sie noch einmal ab, um aufgeregt aufs neue an ihr herumzureinigen. Es war nicht zu glauben. Ein Wunder war geschehen, in einer kleinen Pinte, bei Nebel und Regen. Zu diesem dicklichen Junggesellen und scheuen Menschenfreund, eingesperrt in eine stinkende Mansarde, verschanzt hinter seiner Milch und seinem Mineralwasser, zu diesem mit Prinzipien beladenen und mit Hemmungen befrachteten Unterbuchhalter eines Unterbuchhalters mit seinen ewig feuchten und zerrissenen Socken und seinem ungebügelten Hemd, mit den viel zu kurzen Kleidern, den ausgetretenen Schuhen und verkehrten Meinungen, kam ein so zauberhaftes Wesen, ein so reines Märchen an Schönheit und Grazie, eine so echte kleine Dame, daß sich Georgette nicht zu rühren wagte und Auguste die Radrennfahrerbeine geniert hinter dem Ofen versteckte.
»Herr Archilochos?« fragte eine leise, zögernde Stimme. Archilochos erhob sich, kam mit dem Ärmel an die Tasse, wobei die Milch über seine Brille lief. Endlich hatte er sie wieder auf, und durch die Milchstriemen hindurch blinzelte er nach Chloé Saloniki, ohne sich zu rühren.
»Noch eine Tasse Milch«, sagte er endlich.
»O«, lachte Chloé, »mir auch.«
Archilochos setzte sich, ohne den Blick von ihr wenden zu können und ohne sie einzuladen, was er doch gerne getan hätte. Er fürchtete sich, die unwirkliche Situation bedrückte ihn, und er wagte nicht, an seine Annonce zu denken; verlegen nahm er die Rose von seinem Kittel. In jedem Augenblick erwartete er ihr enttäuschtes Sich-umwenden und Fortgehen. Vielleicht dachte er auch, daß er nur träume. Wehrlos war er der Schönheit dieses Mädchens ausgeliefert, dem Wunder dieses Augenblicks, das nicht zu begreifen war, und von dem er nicht hoffen durfte, daß es mehr denn eine kurze Zeitspanne daure. Er fühlte sich lächerlich und häßlich, riesengroß tauchte mit einem Male die Umgebung seiner Mansarde auf, die Trostlosigkeit des Arbeiterviertels, in welchem er wohnte, die Eintönigkeit seiner Buchhalterei; aber sie setzte sich einfach an seinen Tisch, ihm gegenüber, und sah ihn mit großen, schwarzen Augen an.
»O«, sagte sie glücklich, »so nett habe ich dich mir nicht vorgestellt. Ich bin froh, daß wir Griechen uns gefunden haben. Aber komm, deine Brille ist voll Milch.«
Sie nahm sie ihm vom Gesicht und reinigte sie, offenbar mit ihrem Halstuch, wie es dem kurzsichtigen Archilochos schien, hauchte an die Gläser.
»Fräulein Saloniki«, würgte er endlich hervor, als spreche er sein eigenes Todesurteil aus: »Ich bin vielleicht nicht so ganz ein richtiger Grieche mehr. Meine Familie ist zur Zeit Karls des Kühnen eingewandert.«
Chloé lachte: »Grieche bleibt Grieche.«
Dann setzte sie ihm die Brille auf, und Auguste brachte die Milch.
»Fräulein Saloniki …«
»Sag doch Chloé zu mir«, sagte sie, »und ›du‹, jetzt da wir heiraten, und ich will dich heiraten, weil du ein Grieche bist. Ich will dich einfach glücklich machen.«
Archilochos wurde rot. »Es ist das erste Mal, Chloé«, sagte er endlich, »daß ich mit einem Mädchen rede, sonst nur mit Madame Bieler.«
Chloé schwieg, schien über etwas nachzudenken, und beide tranken die heiße, dampfende Milch.
Nachdem Chloé und Archilochos das Lokal verlassen hatten, fand Madame Bieler die Sprache wieder.
»So was Piekfeines«, sagte sie. »Nicht zu glauben. Und ein Armband hatte sie, und eine Kette um den Hals, Hunderttausende von Franken. Muß tüchtig gearbeitet haben. Und hast du den Mantel gesehen? Was dies nur für ein Pelz ist! Eine bessere Frau kann man sich gar nicht wünschen.«
»Blutjung«, staunte Auguste noch immer.
»Ach was«, antwortete Georgette und füllte sich ein Glas mit Campari und Siphon, »die ist schon über dreißig. Aber hergerichtet. Die läßt sich jeden Tag massieren.«
»Tat ich auch«, meinte Auguste, »als ich die Tour de Suisse gewann«, und schaute wehmütig auf seine dünnen Beine:
»Und ein Parfüm!«
3
Chloé und Archilochos standen auf der Straße. Es regnete immer noch. Auch der Nebel war noch da, finster, und die Kälte, die durch die Kleider drang.
Am Quai gebe es ein alkoholfreies Restaurant gegenüber dem Weltgesundheitsamt, sagte er endlich: »Ganz billig.«
Er fror in seinem zerschlissenen, feuchten Konfirmandenanzug.
»Gib mir den Arm«, forderte ihn Chloé auf.