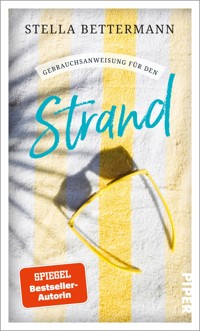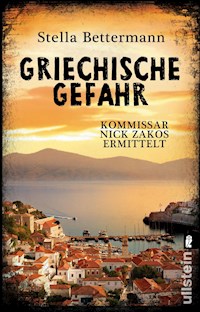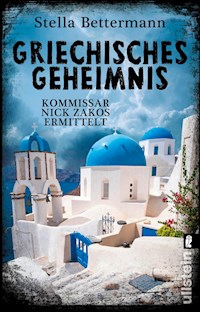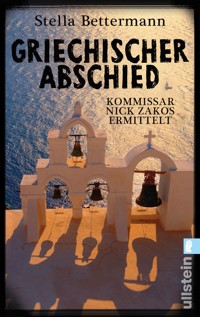11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nick Zakos ist genervt vom Münchner Winter — der Frühling will in diesem Jahr einfach nicht kommen. Außerdem hat er mal wieder Beziehungsprobleme - und dass er versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, verbessert seine Laune nicht gerade. Da kommt ein verzwickter Fall auf seinen Tisch: Eine Grafikerin wird ermordet, und bald gerät ein afrikanischer Flüchtling ins Visier der Ermittlungen. Der allerdings wurde aus Deutschland abgeschoben und befindet sich nun in Griechenland. Prompt bekommt Zakos seinen Frühling: Der Kommissar reist dem Verdächtigen ins strahlende Athen hinterher und trifft auf seine Kollegin Fan sowie auf eine Menge hochkomplizierter Verwicklungen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Nick Zakos trotzt dem langen Münchner Winter und sehnt sich den griechischen Frühling herbei. Viel lieber als im grantigen Bayern würde er im mediterranen Süden ermitteln. Dass ihn schon der nächste Fall wieder dorthin bringen würde, hätte er nicht gedacht: Eine Graphikerin wird ermordet, und ein afrikanischer Flüchtling gerät unter Verdacht. Dieser ist allerdings längst nicht mehr in Deutschland, er befindet sich in Athen. Zakos reist dem Flüchtling hinterher und prompt bekommt er seinen Frühling: In Griechenland blüht schon alles, und die Menschen tümmeln sich in Straßencafés. Zakos trifft seine Kollegin Fani wieder, die ihn bei dem Fall – und darüber hinaus – ordentlich unterstützt, und auch Zakos’ Vater hilft seinem Sohn bei einigen Konfliktlösungen – privater Natur ...
Die Autorin
Stella Bettermann, Tochter einer Griechin und eines Deutschen, lebt mit ihrer Familie in München, wo sie als Journalistin und Autorin arbeitet. Ihre Griechenlandbücher Ich trink Ouzo, was trinkst du so? und Ich mach Party mit Sirtaki waren Spiegel-Bestseller. Griechische Begegnung ist ihr zweiter Kriminalroman in der Reihe um den Kommissar Nick Zakos.
Von der Autorin ist in unserem Hause bereits erschienen:
Griechischer Abschied
Stella Bettermann
Griechische Begegnung
Kriminalroman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Mai 2016
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: © FinePic®, München
ISBN 978-3-8437-1266-8
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Prolog
Sophia starrte ihn an, als wäre er ein Gespenst. Sie stand da und starrte, und er konnte sehen, wie ein Schweißtropfen von ihrer Stirn über die runde Wange und das Doppelkinn lief, um schließlich in ihren weichen Ausschnitt über der bunten Kittelschürze zu versickern.
»Kalimera«, murmelte er verlegen, »ich bin zurück.« Seine Stimme klang belegt und wurde von Geschirrklappern und allgemeinem Stimmengewirr übertönt, in das sich allmählich ungehaltene Rufe mischten.
»Mama Sophia! Was ist los?! Wann geht’s weiter? Wir haben Hunger!« Sogar ein paar ungehaltene Pfiffe wurden laut. Sophia aber hatte den Schöpflöffel sinken lassen, und ihr erschrockener Blick war einem tief bekümmerten Ausdruck gewichen, während die Leute in der Schlange hinter ihm langsam ungeduldig wurden und drängelten, so dass sein Unterkörper an den Tresen gedrückt wurde.
Draußen im Hof prasselte Regen auf die in Reihen aufgestellten Tische. Irgendjemand, vielleicht der knorrige alte Pope mit dem langen Bart, der ihm immer wie eine Gestalt aus den griechischen Sagen vorgekommen war, hatte die Plastikstühle schräg mit der Lehne daran angelehnt, damit das Wasser abfließen konnte. Wegen des Wolkenbruchs sammelten sich die Hilfesuchenden heute im Gemeinderaum. Die Luft war zum Schneiden dick, und er spürte, wie auch ihm der Schweiß ausbrach. Irgendwo hinten bei den Bänken an der Wand weinte ein Kind, und zwei alte Trinker, deren gerötete Gesichter er wiedererkannte, stritten lautstark an einem Tisch bei der Tür. Eine angespannte Stimmung lag in der Luft, wie immer, wenn sich zu viele Menschen in einen zu kleinen Raum drängten.
Er hatte nicht herkommen wollen. Ausgerechnet hierher. Wo doch alle glaubten, ihm sei endlich der Absprung in ein besseres Leben geglückt. Seine Anwesenheit hier war die reinste Schmach, der Beweis, dass er es doch nicht geschafft hatte. Aber er musste etwas essen, er hatte Hunger, und sein Geld war fast aufgebraucht. Stolz konnte er sich nicht leisten, hatte er sich gesagt. Als aber nun Sophia wie aus einer Trance erwachte, mit einer heißen Hand über den Tresen langte und tröstend die seine drückte, überwältigte ihn trotz allem die Scham.
Abrupt entwand er sich ihrem Griff, ließ sein Tablett mit den zwei Scheiben Weißbrot, die in eine dünne Papierserviette gewickelt waren, einfach vor sich stehen und lief hinaus ins Nass, lief und lief, bis seine Sachen triefend an ihm hingen, und auch noch, als sie allmählich wieder trockneten und einen Gestank von Regen und Abgasen ausdünsteten, während seine Schuhe, die neuen kobaltblauen Sneakers aus Deutschland, quietschende Geräusche von sich gaben. Es klang für ihn, als würden sie ihn verhöhnen.
Erst in der Ödnis, dort wo die Häuser oben am Berg einer Steinwüste aus gelbweißen Felsbrocken wichen, hockte er sich auf den aufgeplatzten Asphalt der Straße und vergrub den Kopf in die Arme. Schluchzer schüttelten ihn, als er an Mama Sophias mitleidsvolles Gesicht dachte. In ihren Augen hatte er seine Hoffnungslosigkeit wie in einem Spiegel erkannt.
Ja, er war zurück. Wohin hätte er auch sonst gehen sollen? Immerhin war ihm hier alles vertraut, auch wenn er wusste, dass er schon viel zu viele Jahre hier verbracht hatte. Es waren Jahre der Not gewesen, in denen er von seltenen Gelegenheitsjobs gelebt hatte, von der Hand in den Mund. Eine Existenz wie in einem Vakuum, wie durch eine unsichtbare Grenze getrennt vom echten Leben, an dem er nicht teilhaben konnte.
Sieben Jahre war es her, dieses echte Leben, so wie er es bei sich bezeichnete. Damals hatte er ein gutes Auskommen gehabt. Die Arbeit war hart gewesen, doch er hatte sich nach einer Weile daran gewöhnt, obwohl er körperliche Arbeit zuvor nicht gekannt hatte. Sogar eine eigene kleine Wohnung hatte er gemietet, unter der Hand, und eine Zeitlang hatte er geglaubt, er könne hier eine Familie gründen. Rückblickend kam es ihm vor, als wäre der hoffnungsfrohe junge Mann aus jenem Leben gar nicht er gewesen, sondern ein ganz anderer Mensch. Ein Idiot, der nichts wusste. Denn diese Periode voller Zuversicht und Glück sollte vergehen und schließlich in eine Phase münden, in der es immer weiter abwärtsging.
Mit der Zeit verlor er die Hoffung und stumpfte ab. Er nahm alles hin. Sogar das Unbehagen, sein Leben mit fremden Männern zu teilen und ihre Stimmen, ihre Gerüche ertragen zu müssen, ebenso wie ihre Gewohnheiten und Bräuche, ihre Kleidung, die Toilettengegenstände. Fast hautnah klebten die Fremden in ihrer engen Behausung an ihm, und doch waren sie nur eine zufällige Gemeinschaft der Zukunftslosen, allesamt vom Schicksal verraten. Einsamkeit, dicht gedrängt unter anderen Menschen. Das war das Schlimmste.
Die aber, die zu ihm gehörten und nach denen er sich Jahr für Jahr mehr sehnte, sie waren nicht hier bei ihm: Samuel, der große bedächtige Bruder, und Miles, der jüngere, der damals, als er ihn das letzte Mal gesehen hatte, ein unruhiger spindeldürrer Kerl mit zu großen Füßen gewesen war und der ihm mittlerweile so sehr ähnelte: ebenso hochgewachsen und muskulös. Doch das wusste er nur von den Fotos, die die beiden ihm sandten. Sie lebten am anderen Ende Europas, viele tausend Kilometer entfernt, und es gab derzeit keine Chance, dorthin zu gelangen. Und so war er wieder hierhergekommen, an den einzigen Ort, der ihm offen stand. Die anderen Männer hatten keine großen Fragen gestellt, sie waren einfach wieder zusammengerückt, hatten ihm einen Schlafplatz und einen Platz für seine Tasche gegeben – und damit das Gefühl eines Zuhauses, das er so nötig hatte. Auch wenn sein alter Schlafplatz bereits an einen anderen Mann vergeben war und er sich nun mit einer zugigeren Stelle bescheiden musste. Sein alter Schlafsack war ebenfalls weg, er hatte ihn in Deutschland weggeworfen, denn er glaubte, er bräuchte ihn nie mehr. Nun zog er nachts alle seine Sachen an, die zwei schönen Hemden, auf die er lange gespart hatte, ein Sweatshirt mit wärmender Kapuze und über die Jeans eine große Jogginghose aus einer Kleiderkammer in München. Und er deckte sich mit einer fadenscheinigen alten Decke zu, die einst Mori gehört hatte.
Mori, sein alter Freund. Noch jemand, den er schmerzlich vermisste. Wie es ihm wohl ging?
Mit Mori hatte sich alles noch mal verändert, plötzlich hatte es Hoffnung gegeben. Mori hatte ihn auserwählt, sein Begleiter zu sein. Der Alte besaß Geld, keiner wusste, woher. Jahrelang musste er es heimlich an seinem Körper verwahrt haben. Doch allein traute Mori sich die Reise nicht mehr zu, dazu war er bereits zu schwach. Moris Geld war dann auf einen Schlag an den Mann mit dem Wagen gegangen. In zwei Tagen und zwei Nächten waren sie im Norden gewesen – nach all den Jahren. Er hatte gestaunt, wie schnell alles ging, wenn Geld da war.
Sie kamen in ein Auffanglager, eine Turnhalle mit Stockbetten. Dann wurden sie getrennt, Mori kam in den Norden Deutschlands. Von dort sei es nicht mehr weit nach Schweden, hatte er am Telefon gesagt, aber seine Stimme hatte verwaschen und schwach geklungen. Schweden war Moris eigentliches Ziel gewesen, er hatte Freunde und Verwandte dort. Doch Mori war krank. Er würde Schweden nicht mehr erreichen. Bei ihrem letzten Gespräch hatte er ein Krankenhaus erwähnt, in dem er sich befinde, und berichtet, wie freundlich und gepflegt dort alles sei. Aber es war trotzdem klargeworden: Es war ein Ort zum Sterben.
In diesem Moment wünschte er, er wäre an Moris Stelle und läge wie dieser in einem weichen, weißen Bett in einem ruhigen Raum, vollgepumpt mit Schmerzmitteln, und dämmere dem Ende entgegen. Wozu leben, wenn das Leben nur aus Trauer und Schmerz bestand? Doch er war nicht alt und krank wie Mori, sondern gesund und noch viel zu jung, um aufzugeben. Er musste weiterleben.
Er wusste nur nicht, wie.
Kapitel 1
Zwei Wochen davor
Schon der Anblick seines Kollegen Albrecht Zickler ging Hauptkommissar Nick Zakos an diesem Tag auf die Nerven, wie er mit hängenden Schultern dastand in seinen ausgebeulten Kordhosen und mit einem Strickschal in Weiß-Blau um den Hals.
»Wie schaust du denn aus?!«, knurrte er statt einer Begrüßung. »Was ist das überhaupt für ein bescheuerter Schal?«
Zickler nieste dreimal, fummelte dann eine Packung Papiertaschentücher aus seiner Anoraktasche und schnäuzte sich ausgiebig. Seine sonst rosigen Wangen wirkten wächsern, dafür war die Nase ziemlich rot.
»Sieht man doch«, krächzte er schließlich. »Mein 60er-Schal.«
Zickler war fanatischer Fan des Zweitligisten TSV München 1860, von dem er annähernd jedes Spiel besuchte.
»Mei oh mei, Ali! Wir sind doch nicht im Stadion!«, entfuhr es Zakos. »Wir sind an einem Tatort. Findest du das nicht irgendwie unpassend, hier in Fanmontur aufzuschlagen?«
»Wieso Fanmontur? Des ist doch keine Montur, sondern lediglich ein Schal!«, empörte sich Zickler.
»Ich find’s geschmacklos«, erwiderte Zakos.
Der andere zuckte die Achseln. »Seit wann hast du denn damit ein Problem?«, fragte er. »Weiß-Blau, des sind doch nicht nur die bayrischen, sondern auch eure griechischen Farben! Da müssten bei dir doch Heimatgefühle aufkommen, als Grieche!«
»Halber Grieche. Außerdem: Bloß weil die griechischen Nationalfarben Weiß und Blau sind, laufen doch nicht alle Münchner Griechen in der 60ger-Kluft rum«, giftete Zakos. »Wäre auch bescheuert!«
»Also – ich fänd’s lustig«, meinte Zickler.
»Wenn das dein Sinn für Humor ist …«, kam die Replik.
»He, he, he! Was ist denn mit euch los?! Ihr seid ja schlimmer als ein altes Ehepaar!«
Die besänftigende Stimme gehörte einer schmalen Gestalt im weißen Overall. Sie hatte die angelehnte Tür des Reihenhauses, vor dem sie standen, leise mit ihrem Ellenbogen aufgedrückt und lauschte offenbar schon eine Weile. Auf dem Kopf trug sie ein Haarnetz, und die Hände steckten in Gummihandschuhen, die Blutspuren aufwiesen. Im gleichen Moment brachte eine Windböe das weiß-rote Absperrband, mit dem der Eingangsbereich bis zum Gehweg gesperrt war, zum Rascheln und rüttelte an den Fähnchen der zwei bunten Kinderfahrräder, die neben der Eingangstür an der Wand lehnten. Die junge Frau zog fröstelnd die Schultern hoch.
Zakos blieb die Antwort schuldig und nickte der Spurentechnikerin Laura Westphal nur knapp zu, bevor er sich an ihr vorbei durch die Tür schob. Sie sah den zurückbleibenden Zickler erstaunt an.
»So kenn ich ihn gar nicht«, sagte sie. »Sonst ist er doch immer so ein Sonnyboy …«
»Hi, Laura«, krächzte Zickler. »Die Sonnyboyzeiten sind vorbei. Der Nick ist heute mit dem linken Fuß aufgestanden. Wie andauernd derzeit«, fügte er erklärend hinzu.
»Na, dann wird ihm das da drinnen erst recht die Laune verhageln«, sagte sie. »Komm rein, aber mach die Tür nicht ganz zu. Sonst hält man es im Haus nämlich nicht aus.«
Es gab keinen Flur oder Hausgang in dem Reihenhaus, sie standen unmittelbar in einem großen Wohnraum mit integrierter Küche. Transparente Plastikfolie war im Eingangsbereich ausgelegt. Sie war mit roten Fußspuren übersät.
»Der Nicki und der Ali, unser Dreamteam!«, empfing sie eine dröhnende Stimme. Das war ironisch gemeint. Chef-Forensiker Kornelius Wagner schien heute ebenfalls nicht gerade gut gelaunt zu sein.
»Ihr seid, gelinde gesagt, spät dran«, fuhr er fort. »Wart ihr noch schnell auf ein Bier, während wir hier schon seit geschlagenen zwanzig Minuten knietief im Blut waten?«
»Ha, ha, Konny, superwitzig!«, knurrte Zakos. Normalerweise konnte er den ruppigen kleinen Mann mit der roten Halbglatze und den zusammengekniffenen Augen hinter der randlosen Brille gut leiden, trotz dessen schnippischer Art. Doch diesmal regte der Kollege ihn einfach nur auf.
»Schon mal was von Stau gehört?«, fragte Zakos grantig, während seine rechte Hand unbewusst unter dem Daunenanorak zur Hemdenbrusttasche seines weißen Hemdes tastete, als befände sich dort etwas, das ihm Halt geben könnte. Etwas ganz Bestimmtes.
Doch da war nichts. Die Hemdentasche war leer.
Jetzt erst nahm Zakos diesen ihm wohlbekannten Geruch wahr, wegen dem es Laura Westphal wichtig gewesen war, dass Frischluft hereinkam. Den Geruch von Blut – dickem, stinkendem, gerinnendem Blut.
Zakos musste einen Würgereiz unterdrücken. Wegen des Ärgers über Kornelius hatte er den Raum mit dem offenen Wohn- und Küchenbereich zunächst gar nicht richtig wahrgenommen. Nun sah er, dass der Erdgeschossbereich in der Mitte von einem stattlichen, frei stehenden Küchenblock aus Chrom dominiert wurde. Schon von seiner Position am Eingang aus konnte er erkennen, wie das Blut in breiten Schlieren die metallglänzenden Wände herabgelaufen war und sich auf dem Eichenboden in regelrechten Pfützen gesammelt hatte.
Die Leiche lag mitten auf dem Küchenblock, wie auf einem Opferaltar. Sie wurde illuminiert vom grellen Licht, das die Forensiker aufgebaut hatten. Die Szenerie hatte etwas Unwirkliches. Der reinste Horrorfilm, dachte Zakos. Doch leider war das kein Kinostück, sondern traurige Realität: eine tote Frau, offenbar ermordet in ihren eigenen vier Wänden.
Die Lichter hatten aber noch einen Nebeneffekt: Sie heizten den Bereich mit der Toten auf. Der Geruch des Blutes war dadurch noch intensiver wahrnehmbar.
»Wollt ihr Tigerbalm für unter die Nase?«, fragte Laura, die Zakos’ angeekelten Gesichtsausdruck richtig gedeutet hatte. »In meiner Handtasche im Seitenfach habe ich welches, da drüben.« Laura wies mit dem Kopf auf eine Ecke rechts von ihm, auf der sie und ihre Kollegen ein paar persönliche Gegenstände in eine von Schutzfolie umgebene Kiste gelegt hatten.
»Geht schon, danke«, sagte Zakos. Er hasste diese Paste mit ätherischen Ölen, weil sie bei ihm den Ekel noch verstärkte, denn sie benutzten sie auch an Einsatzorten, bei denen noch Abstoßenderes als der Geruch von Blut zu überdecken war. Deswegen reagierte sein Magen schon bei der Erwähnung des Wortes »Tigerbalm« mit Abwehr.
»Schuhschoner, Kreuzkruzifix!«, erklang nun noch lauter als zuvor die Stimme von Kornelius, der gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen direkt an dem Küchenblock stand.
»Schuh-scho-ner! Ja, seid’s ihr denn heute den ersten Tag dabei, oder was?!« Mit jeder Silbe schien sich die Glatze des Spurensicherungsexperten noch intensiver rot zu färben.
»Als ob’s hier noch groß auf Schuhschoner ankäme«, murmelte Zickler, während er sich aus einem Karton, der neben dem Eingang deponiert war, bediente und umständlich die blauen Tütchen über seine angestoßenen alten Haferlschuhe zog, bevor er die Packung an Zakos weitergab.
»Was hat er g’sagt?«, bellte Wagner. »Der soll sich mal zurückhalten, sonst werd ich ungemütlich, aber ganz ungemütlich!«
Die Beschwerde war an Zakos adressiert, nicht an Zickler selbst. Zakos konnte sich nicht erinnern, dass Kornelius jemals mit Zickler direkt kommuniziert hätte. Während er und Kornelius sich grundsätzlich mochten – jedenfalls an normalen Tagen –, konnten Kornelius und Zickler sich nicht ausstehen. Und das schon so lange, dass sich alle daran gewöhnt hatten.
Heute allerdings fühlte sich Zakos davon total genervt, und weil Kornelius sich wieder der Leiche auf dem Küchenblock zugewandt hatte, warf er zumindest Zickler einen ärgerlichen Blick zu – der jenen allerdings kaltzulassen schien.
»Weil’s doch wahr ist«, maulte Zickler. »Hier sind sowieso schon so viele Spuren wie in einer Disko.«
Das allerdings war unbestreitbar: Im Haus musste gerade erst eine Party stattgefunden haben. Überall auf den Tischen und auch auf dem Boden standen leere Bierflaschen und Gläser mit eingetrockneten Rotweinresten. Der Boden war zudem regelrecht übersät von Scherben. Auf der Anrichte und dem großen hölzernen Küchentisch gab es außerdem noch umgekippte Schüsseln mit angetrockneten Essensresten daran, und auch hier: jede Menge zerbrochenes Geschirr.
»Der reinste Saustall«, sagte Zickler und zeigte auf einen zerborstenen Aschenbecher, dessen Inhalt auf dem Boden lag. Allerdings fiel ihm dabei ein bereits benutztes Taschentuch aus dem Ärmel auf den Holzboden.
»Kreuzkruzifix!«, schimpfte Kornelius erneut, der sich genau in diesem Moment zu ihnen umgedreht hatte, und einen Augenblick lang sah er aus, als wollte er auf den Erkälteten an der Eingangstür losstürmen.
»He, he, he«, machte Laura Westphal erneut. »Was ist denn heute mit euch allen los?«
Der Chef-Forensiker blickte sie an wie aus weiter Ferne. Dann zuckte er die Achseln und seufzte.
»Nick, ich weiß wirklich oft nicht, wie du den erträgst!«, wandte er sich an Zakos. Er meinte natürlich Zickler. »Aber mit einem hat dein Kollege schon recht: Hier war ganz schön was los. Für uns heißt das: Ich kann den Rest der Belegschaft auch noch aus dem Wochenende rufen, sonst kommen wir mit den ganzen Spuren hier nicht durch. Feierabend kann man sich dieses Wochenende abschminken. Schöne Scheiße!«
Zakos nickte.
»Was meinst du, wie viele Leute waren hier – so um die dreißig, vierzig?«, fragte er schließlich.
»Eher fünfzig, schätze ich – so wie’s hier aussieht! Und wir müssen jetzt all diese Spuren aufnehmen. Das dauert ewig. Dabei war der Mörder vielleicht gar nicht dabei.«
»Wie jetzt?« Zakos stutzte.
»Ja, ja, du verstehst mich schon ganz richtig: Hab auch im allerersten Moment gedacht: Partyopfer. Also, letzter Gast macht der Frau Avancen, beide sind betrunken, aber sie will nicht, wehrt sich – und dann geht’s mit ihm durch. Aber nix da!«
»Und wieso nicht?«, fragte Zakos. »Ich meine – was spricht dagegen?«
»Alles«, sagte Kornelius, während er einen Glassplitter fixierte, den er zuvor mit der Pinzette vom Küchenblock aufgehoben hatte. »Sie wurde nämlich vorhin erst ermordet. Also, quasi. Die ist ja noch fast warm.«
Er war an die Tote herangetreten und hatte ihren blutigen Unterarm angehoben. Nun machte er Zakos ein Zeichen, ebenfalls näher zu kommen – was dieser tat, wobei er die Füße in den knisternden blauen Plastiküberschuhen vorsichtig setzte, um nicht in die Blutlache unterhalb des Küchenblocks treten zu müssen.
»Die Leichenstarre hat noch gar nicht eingesetzt«, fuhr Kornelius fort. »Todeszeitpunkt: vor höchstens zwei Stunden. Wahrscheinlich, als sie beim Aufräumen war, würde ich meinen.« Kornelius zeigte auf eine Ecke im Raum, in der eine Kehrschaufel mit Besen sowie eine Mülltüte lagen. Sie war allerdings umgefallen und hatte ihren Inhalt von sich gegeben – gebrauchte Plastikteller, Salatreste, aufgeweichte Papierwischtücher lagen davor. Und auch hier gab es jede Menge Scherben – ob von der Party oder von dem Kampf, der für die Frau auf dem Küchenblock geendet hatte, war schwer zu unterscheiden.
»Außerdem sieht man’s ja auch an ihrer Kleidung. Das ist definitiv kein Party-Outfit«, sagte der Forensiker. »Das ist mir nur im ersten Moment gar nicht aufgefallen, wegen des ganzen Bluts!«
Die Tote trug einen Jogginganzug aus hellgrauer Baumwolle. Der Stoff hatte das Blut aufgesogen wie ein dicker Lappen.
»Und sonst?«, wollte Zakos wissen. »Mordwaffe, Anzahl der Täter? Kannst schon was sagen?«
»Puh!«, machte Kornelius und nahm erneut mit der Pinzette eine Fluse oder einen Krümel auf, der zu fein war, als dass Zakos ihn aus eineinhalb Metern Entfernung erkennen konnte.
»Wir haben ja grad erst angefangen. Klar ist bloß: Tatwaffe war ein spitzer Gegenstand – ein langes Messer halt, schätz ich. Ist aber nichts davon hier zu sehen, soweit ich das überblicke. Jedenfalls: Der Täter – ich gehe von einem aus – muss ein echter Bär von einem Mann gewesen sein, der hat sie regelrecht durch die Luft geschleudert, erkennbar an den Hämatomen überall am Körper – besonders am Rücken, da, schau her …« Er zog den Bund der Sweatshirtjacke nach oben und wies mit dem Zeigefinger auf die entsprechenden Stellen, bevor er weiter erläuterte: »Da war viel Wut im Spiel. Darauf weist auch hin, dass er so oft zugestochen hat. Eindeutiger Fall von Übertötung.«
Nun war Zickler wieder zu vernehmen, diesmal mit einem hartnäckigen, verschleimt klingenden Husten. Kornelius seufzte.
»Kann denn niemand diese Bazillenschleuder in Quarantäne sperren? Der steckt uns doch alle an! Also ehrlich …«
Der Hustenanfall wurde nur noch heftiger und dauerte eine gefühlte Ewigkeit. Am Ende war Zickler so geschwächt, dass er offenbar nicht mal mehr Lust hatte, Kornelius Kontra zu geben.
»Ich geh schon mal raus«, krächzte er in Zakos’ Richtung. »Kommst du auch?«
Zakos verneinte. Er war noch lange nicht so weit. Er musste den Tatort auf sich wirken lassen, sich alles einprägen. Fotos waren kein adäquater Ersatz für das Gefühl, das dieser Ort auslöste, für den Instinkt. Das wusste er. Oft waren es die Details, die wichtig waren. Kleinigkeiten. Welchen Schmuck trug die Frau? Was umgab sie, und, wichtiger noch: Was fehlte? Manchmal waren die Dinge, die nicht oder nicht mehr da waren, entscheidender für die Aufklärung eines Mordes als die am Tatort vorhandenen Gegenstände. Jetzt galt es, ganz genau hinzusehen und die Sinne zu schärfen. Das Problem war nur: Es gelang ihm irgendwie nicht. Er fühlte sich müde und abgespannt, konnte sich einfach nicht konzentrieren.
Vielleicht half es, wenn er den Raum mit der Toten aus einem anderen Blickwinkel betrachtete. Er ging zur Fensterfront am anderen Ende des Zimmers, wobei seine Füße schmatzende Geräusche auf dem Boden verursachten. Irgendwo hier drinnen war er wohl in eine der klebrigen Pfützen getreten, die von den Inhalten der geborstenen Flaschen und Gläser stammten – oder vom Blut. So genau wollte er es gar nicht wissen.
Am anderen Ende, neben der Glastür, die in den Garten führte, stand ein gemütlich wirkendes beiges Samtsofa, das mit Chipskrümeln übersät war. Zakos blickte nach draußen in den etwas verwilderten kleinen Garten, der von einem riesigen Trampolin dominiert wurde. Der Wind zerrte an der dunkelgrünen Plastikplane, die darüber befestigt war, und peitschte Nieselregen an die Glasscheibe. Ein Wetter wie im Winter, dachte Zakos. Ekelhaft. Nur am Morgen war kurz die Sonne rausgekommen, weshalb er mit dem Rad zum Einkaufen gefahren war. Doch der Wind, der dann einsetzte, war derart eisig gewesen, dass er sich eigentlich seither durchgefroren fühlte. Plötzlich musste er an die beiden bunten Kinderfahrräder mit den Fähnchen, draußen vor dem Eingang, denken. Er blickte sich suchend im Wohnraum um. Nichts als Chaos. Doch dann sah er etwas Interessantes, halb unter dem Sofa. Zakos streckte seinen rechten Fuß aus, der in dem blauen Schoner steckte, und schob den Gegenstand hervor. Es war ein grün-gelber, mit Stollen besetzter Kinderfußballschuh, nur halb so groß wie Zakos’ Fuß.
Er wandte sich um und bahnte sich rasch den Weg durch das Chaos aus Scherben, Müll und Blut. Er musste sich beeilen.
Die blonde Frau saß graugesichtig an einem der runden Kaffeehaustische und klammerte sich an ihrer Tasse fest. Neben ihr saß eine kräftige uniformierte Beamtin mittleren Alters, die beruhigend auf sie einredete. Zakos, dicht gefolgt von Zickler, stürmte durch das Lokal zu den beiden hin.
»Frau Zimmermann? Sie sind doch Christine Zimmermann, oder?«, sprach er die Blonde an.
Die Frau blickte überrascht auf und sah ihn mit großen wasserblauen Augen an.
»Sie ist noch ziemlich geschockt«, ergriff die Beamtin mit gedämpfter Stimme das Wort. »Aber das Kriseninterventionsteam ist schon unterwegs.« Zakos beachtete sie kaum.
»Frau Zimmermann, das hier ist jetzt extrem wichtig: Wo sind die Kinder der Toten?«, fragte er laut. Am Nebentisch blickte sich ein Pärchen nach ihnen um. Es war ihm egal.
»Frau Zimmermann, die Kinder! Denken Sie nach. Wissen Sie was darüber?«
Sie blickte verwundert zu ihm auf.
»Was … ähm … keine Ahnung«, stammelte sie. »Oder doch, jetzt fällt’s mir ein: Die sind bei der Oma. Das hatte Anne erwähnt.«
Zakos hörte, wie Zickler neben ihm erleichtert ausatmete, wobei er ein wenig röchelte. Auch er selbst spürte, wie seine Anspannung nachließ.
»Und ihr Mann?«, fragte Zickler. »Bei der Adresse ist auch der Ehemann der Toten gemeldet, Markus Hofreiter?
Sie schüttelte den Kopf.
»Der Markus, nein, der wohnt nicht mehr da. Die haben sich getrennt.«
Erst jetzt zog Zakos einen Stuhl heran und setzte sich, genau gegenüber von Christine Zimmermann. Nun hatte er auch die Zeit, sie richtig wahrzunehmen: Sie war hübsch, das konnte man trotz des schockierten, etwas leidenden Gesichtsausdrucks erkennen – sehr hellhäutig und mit zarten Sommersprossen.
»Entschuldigung, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt«, sagte er. »Das ist mein Kollege Albrecht Zickler, und ich heiße Nick Zakos. Wir sind die ermittelnden Kommissare. Sie haben sie also gefunden und die Polizei informiert?«
Sie nickte und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Ja«, antwortete sie kurz. »Warum kann ich eigentlich nicht nach Hause und wenigstens meinen Mantel holen? Ich bin ja einfach ohne Mantel zu Anne rübergelaufen, wie immer, und dann …«, sie hielt inne, und Zakos hatte Angst, sie würde gleich in Tränen ausbrechen.
»Ist Ihnen kalt?«, fragte er, hauptsächlich, um sie abzulenken. Es war gar nicht frisch in dem kleinen Café, eher etwas stickig, und ihr grauer Pulli, dessen Ärmel sie nun über ihre Hände zog, besaß die feine Textur von Kaschmir. Zakos hatte einen Blick für solche Dinge.
»Draußen gibt es Decken«, sagte er. Vor der Tür standen ein paar Stühle, auf denen zusammengefaltete weinrote Fleecedecken lagen. »Soll ich Ihnen eine holen?« Aber sie ging gar nicht darauf ein.
»Warum kann ich nicht nach Hause?«, wiederholte sie mit leiser, etwas nöliger Stimme.
Statt Zakos antwortete die Beamtin. Sie klang schon ein wenig ungeduldig: »Ich hab’s Ihnen ja bereits mehrfach erklärt: Erst mal hat das Spurenteam noch zu tun.« Kornelius hatte fast die ganze Straße absperren lassen, auch die Eingänge der Reihenhäuser nebenan. »Aber die können Sie bald wieder zu sich ins Haus lassen, und das psychologische Kriseninterventionsteam ist auch schon unterwegs.«
»Vielleicht können Sie uns in der Zwischenzeit ein paar Fragen beantworten?«, tastete sich Zakos vor.
»Für uns ist es nämlich immens wichtig, dass Sie uns ganz genau erzählen, was Ihnen aufgefallen ist. Besonders jetzt, wo die Eindrücke noch frisch sind. Jedes kleine Detail, das Ihnen vielleicht zu dem Zeitpunkt ganz unwichtig vorgekommen ist.«
»Und ich hol uns allen erst mal Kaffee«, schlug Zickler vor, doch die Beamtin schüttelte den Kopf und erhob sich.
»Ich geh dann wieder zurück zu den Kollegen, wenn’s recht ist«, sagte sie. Zakos nickte ihr zu.
»Also, Frau Zimmermann: Was hat Sie heute zu Frau Hofreiter geführt?«, begann er, als die Kollegin das kleine Lokal verlassen hatte. »Waren Sie verabredet?«
»Verabredet – nein. Wir mussten uns nicht verabreden. Wir waren ja Nachbarinnen«, erwiderte Christine Zimmermann. »Wir haben öfter einfach so vorbeigeschaut. Sie bei mir oder ich bei ihr.«
»Und so war das auch heute?«, fragte Zakos nach. »Sie wollten einfach nur mal vorbeischauen?«
Sie nickte.
»Ich dachte, ich kuck mal, ob ich beim Aufräumen helfen kann. Wegen der Party. Gestern war doch ihre Geburtstagsparty, Annes achtunddreißigster.«
»Schönes Fest?«, wollte Zakos wissen.
»Mhm«, machte sie. »Viele nette Leute. Ich kannte aber nur ein paar, deswegen bin ich auch nicht so lange geblieben. Aber es dauerte wohl ziemlich lange, ich konnte die Musik bis zu uns rüber hören. Ehrlich gesagt, hab ich deswegen ziemlich schlecht geschlafen …«
Zakos horchte auf: »Sie können also hören, was nebenan vorgeht?«
»Nicht wirklich, nein. Normalerweise jedenfalls nicht. Ich bin ja nicht genau daneben. Dazwischen gibt’s noch eine Partei, aber die Leute neben Anne sind verreist. Deswegen hat sie das Fest ja bei sich zu Hause gemacht, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Bremers, diese Leute neben Anne, beschweren sich nämlich ständig über irgendwas. Mein Mann und ich hatten auch schon Ärger mit denen.«
»Aha. War Ihr Mann auch mit auf dem Fest gestern?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Der ist auf unserer Hütte, mit den Kindern, übers Wochenende. Wir haben eine Berghütte, an der Benediktenwand, die teilen wir uns mit einer anderen Familie. Gleich nach Ostern treffen wir uns immer gemeinsam dort und eröffnen sozusagen die Saison. Aber ich hatte eine Knieoperation und traue mich noch nicht auf einen Berg, deswegen bin ich zu Hause geblieben und abends auf die Party. Heute Nachmittag, da dachte ich: Schau mal, ob du was helfen kannst drüben …«
Mittlerweile war Zickler mit einem kleinen Metalltablett mit dampfenden Cappuccinos an den Tisch herangetreten.
»Wie sind Sie überhaupt reingekommen? Hatten Sie einen Schlüssel?«, fragte er, verteilte zwei der dickwandigen Tassen an Zakos und sich selbst und stellte dann eine neben Christine Zimmermanns benutzte, bereits leere. Sofort legte sie wieder die Hände um das Gefäß.
»Anne sperrt nie ab«, sagte sie. »Man kann einfach jederzeit herein. Aber ich hab schon im Gang gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Es war nämlich kein Licht an. Das war komisch.«
»Inwiefern?«, horchte Zakos auf.
»Es ist so ein grauer Tag. Da brennt bei ihr immer schon früh Licht. Im Erdgeschoss ist es bei uns allen ja auch tagsüber ziemlich finster, wegen dieser Büsche vor den Eingängen. Außerdem liegt die Haustür an der Nordseite.«
Mittlerweile schien Christine Zimmermann gefasster. Sie rührte Zucker aus einem dunkelroten Papiertütchen in ihren Cappuccino und löffelte dann ein wenig von dem Milchschaum in ihren Mund.
»Solange Markus noch im Haus wohnte, Annes Mann, da blieb das Licht tagsüber aus. Markus wollte immer Energie sparen. Ist ja nachvollziehbar, machen wir auch. Aber Anne sagte immer: Hell macht fröhlich …«
»Das ist jetzt interessant«, unterbrach Zakos. »Ab wann machte sie normalerweise das Licht an?«
Sie zögerte einen Moment.
»Vielleicht so gegen 16 Uhr. Schätze ich mal. Das ist jedenfalls die Zeit, wo es hier bei uns allen derzeit auf der Eingangseite ziemlich schattig wird, weil da die Sonne rüberwandert und …«
»Ja, schon klar«, unterbrach er, »und um wie viel Uhr waren Sie heute bei Frau Hofreiter?«
»Ungefähr halb fünf«, erwiderte sie.
Wahrscheinlich war der Täter da noch nicht lange aus dem Haus gewesen. Zakos fragte sich, ob sie sich im Klaren darüber war, dass sie ihm beinah begegnet wäre.
»Jedenfalls brannte kein Licht. Und das fanden Sie komisch«, fuhr er fort.
Christine Zimmermann nickte.
»Ich glaubte zunächst, sie wäre gar nicht da. Dann erst hab ich das ganze Chaos gesehen, alles kaputt … Da dachte ich, mein Gott, die Party ist ja noch ganz schön ausgeufert. Aber dann habe ich sie gesehen …«
»Verstehe!«, nickte Zakos.
»Überall war Blut! Es war …«, sie schüttelte den Kopf, »ich werde das nie mehr … nie werde ich das vergessen, ich …«, stammelte sie.
Jetzt bloß nicht zulassen, dass sie sich reinsteigert, sonst kann man das Gespräch vergessen, dachte Zakos.
»Sie sind nicht nur eine Nachbarin, Sie waren auch befreundet?«, fragte er schnell. »Wie haben Sie sich kennengelernt?«
Doch sie war noch nicht so weit. Sie nahm eine der weinroten Papierservietten mit dem Aufdruck des Cafés aus einem Chromkörbchen auf dem Tisch und wischte sich über die Augen. Dann putzte sie sich noch die Nase und atmete tief durch.
»Ja, wir waren Freundinnen«, sagte sie schließlich mit einer so leisen Stimme, dass sie vom Dampfablassen der Kaffeemaschine an der Theke beinahe übertönt wurde.
»Wir sind ungefähr gleichzeitig hier eingezogen, kurz nach der Fertigstellung der Häuser. Unsere Kinder waren zusammen im Kindergarten, und jetzt sind sie in derselben Schule. Da lernt man sich halt kennen. Es gibt ja in unserem Reihenhauszug noch zwei Parteien, aber die haben eben keine Kinder in dem Alter. Und die sind auch nicht so offen und unkompliziert wie Anne. Die ist – ich meine, die war …«
Zakos nickte und fuhr eilig fort: »Warum waren Hofreiters eigentlich getrennt?«
Christine Zimmermann legte den Kopf schief und zwirbelte an einer blonden Haarsträhne.
»Ja, warum?«, sinnierte sie. Das Thema lenkte sie offenbar ab von der Erinnerung an den Anblick ihrer toten Freundin, und sie beruhigte sich wieder ein wenig.
»Warum trennen sich so viele Leute? Vielleicht weil ihnen der Stress mit den Kindern über den Kopf wächst? Weil man sich das alles anders vorgestellt hat? Weil man sich verliert inmitten des ganzen Familienchaos?« Ihr Blick umwölkte sich, und einen Moment lang rätselte Zakos, wen sie damit überhaupt meinte – die Tote und deren Ehe oder vielleicht auch ihre eigene?
In dem Moment hörte er, wie Zickler hörbar an seinem Kaffee schlürfte.
»Spitzen Kaffee!«, sagte er dann und wirkte dabei so hochzufrieden, wie den ganzen Tag noch nicht.
»So einen guten hab ich schon lange nicht mehr getrunken …«
Als er Zakos’ scharfen Blick sah, besann er sich aber und blickte wieder geschäftsmäßiger in die Runde: »Gab’s eigentlich schon neue Partner?«, fragte er.
»Ich glaub nicht«, antwortete Christine Zimmermann. »Nicht dass ich wüsste. Ich denke, Anne hat sich von Markus getrennt, weil sie einfach keine Lust mehr auf seine pedantische Art hatte und so. Sie sagte, sie müsse jetzt ihre innere Spiritualität wiederentdecken …«
»Innere Spiritualität«, wiederholte Zickler, »alles klar!«, und Zakos wusste genau, wie er seinen Ton zu deuten hatte: Für Albrecht war jetzt tatsächlich alles klar. Er hatte die Ermordete soeben in der Schublade »Spinnerin« abgelegt, und das würde sich auch nicht so leicht ändern.
»Kommen wir zurück auf den heutigen Tag«, fuhr Zakos fort. »Ist Ihnen auf dem Weg zu Frau Hofreiter irgendwas aufgefallen? Ein Passant vielleicht? Irgendwelche Geräusche aus dem Haus?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Oder bestimmte Autos, die sonst nie dort parken?«, fragte Zickler.
»Puh – Autos?«, seufzte sie. »Ich glaube nicht. Aber so was fällt mir nie auf. Finn wüsste das, Annes jüngerer Sohn, der Sechsjährige. Der kennt jede Marke und weiß genau, welche Autos hier regelmäßig parken. Wir haben oft Witze darüber gemacht.« Plötzlich vergrub sie das Gesicht in den Händen und schluchzte. Die schmalen Schultern bebten.
In dem Moment kehrte die Polizeibeamtin zurück ins Café und brachte einen jungen Sanitäter und einen älteren grauhaarigen Herrn zu ihnen an den Tisch: das Kriseninterventionsteam. Kurz darauf geleitete das Trio Christine Zimmermann hinaus. Zakos blickte ihnen nach und sah zu, wie der Sanitäter draußen seine Tasche öffnete, eine silberne Wärmedecke entfaltete und versuchte, sie ihr umzulegen. Es dauerte eine Weile, weil der Wind immer wieder an dem dünnen Material riss. Schließlich entfernten sie sich, die Frau im flatternden silbernen Umhang in ihrer Mitte.
Schon wieder so ein unwirkliches Bild wie aus einem Film, dachte Zakos. Der ganze Tag kam ihm heute so surreal vor. Ein Mord und alles, was damit zu tun hatte, war ja nie normal oder gewöhnlich, doch heute empfand er das noch intensiver als sonst. Vielleicht weil das Umfeld so nach heiler Welt aussah. Und doch war hier ein Mord geschehen. Aus dem Fenster blickte er auf die kleine moderne Reihenhaussiedlung mit den eleganten Granitfassaden und den honigfarbenen Holzlamellen. Alles wirkte so freundlich und geschmackvoll, genauso wie das Café, in dem sie saßen, mit seiner stattlichen, irgendwie industriell wirkenden Chromanrichte und dem rauen, dennoch teuer aussehenden Holzboden.
Eine Weile trat Schweigen ein, nur unterbrochen von den Geräuschen, die Zickler machte, als er sich schnäuzte. Schließlich fiel ihm dann mal wieder das Taschentuch auf den Boden, und als er es aufheben wollte, fegte er ein paar Servietten mit dem Ellenbogen vom Tisch und bückte sich umständlich danach, wobei ihm sein nicht unerheblicher Bauch im Weg war.
»Du hast übrigens noch die Schuhschoner an«, sagte er schließlich, als er wieder auftauchte, und fuhr dann fort: »Mei oh mei, war des ein Gemetzel in dem Haus. Da hat einer aber einen echten Hass geschoben. So was kann eigentlich fast nur ein Exmann machen.«
Zakos blieb die Antwort schuldig und tauchte seinerseits unter den Tisch ab, um sich die blauen Plastiküberschuhe von den Füßen zu ziehen.
»Zum Glück waren die Kids in Sicherheit«, hörte er Zickler weiterplappern, als er wieder hochkam. »Das Letzte, worauf ich heute Lust hab, ist ein erweiterter Selbstmord mit Kindern!«
»Soll das heißen, es gibt Tage, an denen du sehr wohl Lust auf erweiterte Selbstmorde mit Kindern hast?«, giftete Zakos. Es klang unfreundlicher, als er es beabsichtigt hatte, aber es war nun mal raus.
Zickler blickte ihn düster an, verkniff sich allerdings eine Antwort und winkte rüber zu dem Mann hinter dem Tresen. Das Café hatte sich mittlerweile geleert. Es war bereits nach 18 Uhr.
»Gibt’s noch Kaffee?«
Der Barista verneinte. »Hab die Maschine grad geputzt, wir haben eigentlich schon zu. Aber wenn ihr Tee wollt – den mach ich euch sofortamente. Aber vorher wüsste ich gern, was hier überhaupt passiert ist. Die Gäste sagen, ein Mord!«
Zakos nickte.
»Anne Hofreiter. Schärenweg 12. Kannten Sie sie?«
»Der Name sagt mir nichts. Die Leute stellen sich ja nicht vor, wenn sie sich Kaffee holen. Wie sah sie denn aus?«
Zakos dachte an das zerschmetterte Gesicht. Er antwortete lieber nicht.
»Tee wär super«, krächzte Zickler schließlich. »Ist wahrscheinlich im Moment eh besser für mich als Kaffee.«
»Verstehe. Erkältungswelle. Da empfehle ich einen griechischen Bergtee. Perfetto gegen Heiserkeit. Und bio!«
»Der Preis ist auch bio«, erwiderte Zickler, der gerade in die Karte geschaut hatte. »Fünf Euro für einen Tee …«
»Qualität hat ihren Preis«, kam die ungerührte Replik. »Und außerdem kurbelt das bei denen unten in Griechenland die Wirtschaft an!«
»Na dann – für Griechenland ist mir nix zu teuer«, sagte Zickler. »Mein Kollege hier übrigens stammt aus Griechenland. Der kennt sich aus mit Bergtee, gell, Nick?«
Zakos blieb die Antwort schuldig. Er war kein großer Teetrinker, und außerdem hatte er keine Lust auf Konversation.
»Gibt’s auch noch was gegen den kleinen Hunger, Wurschtsemmel oder so?«, fuhr Zickler fort, und Zakos wunderte sich nicht zum ersten Mal, dass der Job seinem Kollegen nie auf den Magen schlug. Im Gegenteil, je grausiger der Tatort, umso heftiger Zicklers Appetit.
»Semmeln sind alle, auch das Ciabatta. Back ich erst morgen wieder. Aber Tramezzini alla Tonno kann ich schnell machen! De-li-zioso!«, sagte der Cafébesitzer und trat zu ihnen an den Tisch, um die Cappuccinotassen abzuräumen. Er hatte graumeliertes Haar, einen modernen dunklen Vollbart und trug eine bodenlange schwarze Schürze um die Hüften. Überall in der Gastronomie trugen Kellner jetzt diese langen schwarzen Schürzen, fiel Zakos auf, doch hier war sie so eng gewickelt, dass der Träger darin nur noch kleine Schritte machen konnte, so kam es ihm vor. Affig, fand er, ebenso wie die aufgesetzte Art, wie der Mann italienische Begriffe intonierte. Besonders sonderbar klang es, weil er vom schleppenden Tonfall her anscheinend eigentlich Niederbayer war. Tschabatta! Bei der Aussicht, noch länger in dem Café ausharren zu müssen, bekam Zakos Zustände.
»Cooler Schal übrigens«, sagte der Barista jetzt anerkennend zu Zickler. »Ich bin auch 60er-Fan. Am liebsten geh ich zu den Amateurspielen im alten 60er-Stadion. Schon mal da gewesen?«
»Logisch!«, schwärmte Zickler mit glühendem Blick. Zakos verdrehte die Augen. Was jetzt kommen würde, kannte er bereits zur Genüge: Wenn im sogenannten 60er-Stadion, dem alten Grünwalder Stadion in Giesing, die Amateure von 1860 München gegen die vom FC Bayern antraten, blieb im wahrsten Sinne des Wortes kein Auge trocken. Dazu mussten im Vorfeld die Anliegerstraßen polizeilich gesperrt werden, es gab Schlägereien zuhauf, und der Lärm durch Pyrotechnik und Fangebrüll war so laut, dass man ihn kilometerweit hörte. Am Tag darauf war Albrecht meist noch heiserer als heute mit Erkältung, aber glänzend gelaunt. Nun strahlte er, weil er einen Gleichgesinnten getroffen hatte. Das konnte jetzt dauern, das wusste Zakos aus Erfahrung.
Tatsächlich entspann sich sofort ein reger Austausch zwischen Zickler und dem Bärtigen. Als gäbe es jetzt nichts Wichtigeres auf der Welt, dachte Zakos genervt. Er räusperte sich laut, um Zicklers Aufmerksamkeit zu erhalten. Der Kollege nahm ihn aber gar nicht wahr.
»Ali!«, sagte er schließlich laut. »Wir müssen los!«
»Warum denn? Der Kornelius und seine Leute brauchen sicher noch ewig!«, maulte Zickler. »Und außerdem hab ich Hunger – ein regelrechtes Loch im Bauch vor Hunger!«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.