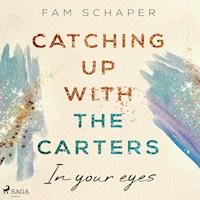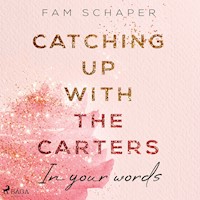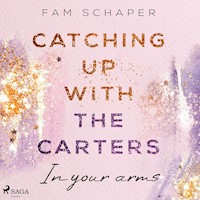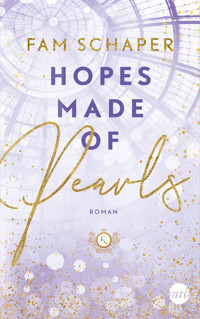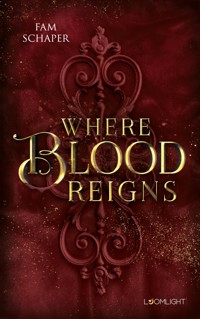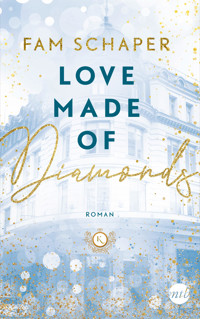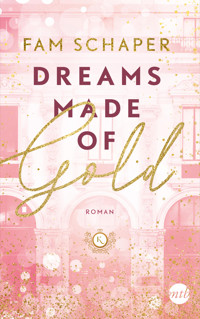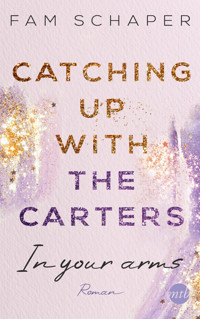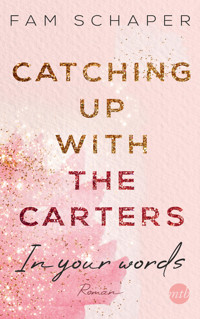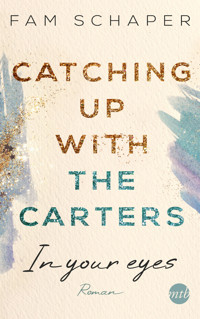3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
**Vom Verlieren und Finden der Liebe** Das Leben der zwanzigjährigen Lotta liegt in Scherben. Seit ihre Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen, gibt es nur noch sie und ihre kleine Schwester Rosa, für die Lotta die alleinige Verantwortung trägt. Schon bald droht ihr alles über den Kopf zu wachsen. Verzweifelt flieht sie eines Abends in ihren verwilderten Schrebergarten und stolpert dabei über den gut aussehenden Jasper. Dieser hat sich dort unerlaubterweise eingerichtet und ist wenig begeistert davon, aufgeflogen zu sein. Als er jedoch von Lottas Lage erfährt, schließen sie einen Deal: Jasper hilft ihr mit der zunehmend schwierigen Rosa und darf dafür weiterhin im alten Gartenhäuschen schlafen. Womit Lotta allerdings nicht rechnet, sind die überwältigenden Gefühle, die ihr neuer Verbündeter plötzlich in ihr auslöst … Urban-Gardening-Romance par excellence! Über das Leben, den Tod und das Zu-sich-selbst-Finden. Diese Liebesgeschichte über zwei verlorene Seelen und die Macht der Natur ist herzzerreißend schön und lässt einen nur so durch die Seiten fliegen! //Der Liebesroman »Growing Love« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Fam Schaper
Growing Love. Als wir uns fanden
**Vom Verlieren und Finden der Liebe**Das Leben der zwanzigjährigen Lotta liegt in Scherben. Seit ihre Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen, gibt es nur noch sie und ihre kleine Schwester Rosa, für die Lotta die alleinige Verantwortung trägt. Schon bald droht ihr alles über den Kopf zu wachsen. Verzweifelt flieht sie eines Abends in ihren verwilderten Schrebergarten und stolpert dabei über den gut aussehenden Jasper. Dieser hat sich dort unerlaubterweise eingerichtet und ist wenig begeistert davon, aufgeflogen zu sein. Als er jedoch von Lottas Lage erfährt, schließen sie einen Deal: Jasper hilft ihr mit der zunehmend schwierigen Rosa und darf dafür weiterhin im alten Gartenhäuschen schlafen. Womit Lotta allerdings nicht rechnet, sind die überwältigenden Gefühle, die ihr neuer Verbündeter plötzlich in ihr auslöst …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
© Schaper Kommunikation
Fam Schaper wurde 1997 in der Nähe von Frankfurt am Main geboren. Seit der Grundschule schreibt sie eigene Geschichten und auch während ihres Studiums in Passau hat ihre Begeisterung für Bücher sie nicht losgelassen. Egal, wohin sie geht, mindestens ein Notizbuch hat sie immer dabei, um keine Idee zu vergessen. Wenn sie nicht gerade schreibt, liest sie, bloggt oder schaut stundenlang Analysevideos über Filme und Serien auf YouTube.
Für Valentin
1. Kapitel
»Wag es ja nicht, jetzt wegzugehen! Ich rede mit dir! Mach noch einen Schritt und du hast die restliche Woche Hausarrest!«
Habe ich das gerade tatsächlich gesagt? Ich fühle mich, als wäre ich mit jeder Silbe um ein Jahrzehnt gealtert. Was habe ich in meinem Leben nur falsch gemacht, dass ich als Zwanzigjährige schon die Mutter für einen Teenager spielen muss?
Die Antwort darauf will ich lieber nicht wissen.
Meine Schwester bleibt stehen. Die Hand, die sie bereits nach ihrer Türklinke ausgestreckt hat, lässt sie in Zeitlupe sinken. Ich kann sehen, dass ihre Finger beben. Sie ist wütend. Natürlich ist sie das. Das ist die einzige Emotion, zu der sie noch fähig ist.
Noch dreht sie sich nicht um. Unwillkürlich spanne ich mich an. Es ist absurd, aber ich habe Angst vor dem, was als Nächstes passiert. Wird meine Schwester explodieren wie eine Bombe und unsere kleine Dachgeschosswohnung in Schutt und Asche legen? Auszuschließen ist es nicht. Früher habe ich mich immer vorsorglich aus der Schusslinie zurückgezogen, sobald sie sich mit unseren Eltern angelegt hat. Doch das ist keine Option mehr. Denn ich bin nicht mehr nur ihre Schwester, ich bin auch ihre Erziehungsberechtigte.
Langsam dreht sich Rosa zu mir um. Inzwischen beben nicht mehr nur ihre Hände, sondern ihr ganzer Körper. Durch die Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit unterm Dach kringeln sich ihre roten Locken noch stärker als sonst. So haben ihre Haare große Ähnlichkeit mit der Schlangenfrisur von Medusa. Und der Blick, mit dem sie mich durchbohrt, legt nahe, dass sie ebenfalls Menschen in Stein verwandeln kann. Ich kann vermutlich froh sein, dass ich noch nicht als antike Statue im Flur stehe.
»Hausarrest?«, ruft sie fassungslos. »Willst du mich verarschen, Lotta?«
»Nein, aber ich glaube, du willst mich verarschen!« Solche Worte sollte man als Erziehungsberechtigte vermutlich nicht benutzen. Aber meine eigene Wut pocht mir schon wie ein sich ankündigender Kopfschmerz von innen gegen die Schädeldecke. »Du hast schon wieder die Schule geschwänzt. Ich dachte, wir hätten darüber gesprochen.«
Meine Schwester schnaubt.
»Wir haben nicht darüber gesprochen. Du hast gesprochen!«
So habe ich früher auch mit unseren Eltern geredet. Nun wünschte ich, ich könnte jedes unfaire und zickige Wort zurücknehmen. Doch das kann ich nicht.
Der Gedanke an meine Eltern lässt meine Wut einfach verschwinden. Und macht anderen Emotionen Platz: Trauer, Verzweiflung … Schuld. Unwillkürlich muss ich schlucken.
Ich habe keine Energie mehr. Nicht für diesen Streit und schon gar nicht für die kommenden.
»Du hast noch eine Woche Schule. Dann sind sowieso Sommerferien. Kannst du dich wenigstens diese paar Tage noch zusammenreißen?«, frage ich mit müder Stimme. Fast wage ich zu hoffen, dass sie dieser Tonfall erweichen wird. Doch ich habe das Temperament einer Rosalie Schulz offensichtlich unterschätzt.
»Charlotta, Königin der Spaßbremsen«, giftet sie, stürmt in ihr Zimmer und knallt dann mit beeindruckender Akustik ihre Tür zu. Das Geräusch habe ich in den letzten Monaten so oft gehört, dass ich eigentlich immun sein sollte. Doch ich zucke genauso stark zusammen wie beim ersten Mal.
Sie hat sich entschlossen, mir diese Zeit so schwer wie möglich zu machen, und ein kleines bisschen hasse ich sie dafür. Sie ist nicht die Einzige, die ihre Eltern verloren hat. Aber das zählt nicht länger. Und das muss okay für mich sein.
Ich stehe noch ewig im Flur herum und starre die Tür meiner Schwester an, in deren Zimmer ich nicht mehr willkommen bin. Normalerweise würde ich in so einer Situation etwas kochen. Das beruhigt mich immer. Doch gerade ist es einfach zu heiß, um sich vor den Herd zu stellen. Ich spüre jede einzelne Schweißperle, die meinen Körper herunterrinnt. Strähnen meiner roten Locken, die sich aus meinem Zopf gelöst haben, kleben mir feucht im Nacken. Ich würde gerne tief durchatmen. Doch das ist im Hochsommer in dieser Wohnung keine Option. Die Luft steht völlig still. Genauso wie ich.
Ich kann hier keine Sekunde länger bleiben. Dieser Gedanke setzt mich in Bewegung. Es ist, als hätte er mir einen Schubs gegeben. Mit wenigen Schritten bin ich bei meiner Handtasche, schnappe sie mir vom Boden, schlüpfe in meine Sandalen und verlasse die Wohnung. Obwohl ich schon im Stehen schwitze, sprinte ich die sechs Stockwerke herunter. Der Krach, den meine Schuhe auf den alten Holztreppen erzeugen, ist ohrenbetäubend. Wieder drückt sich etwas von innen gegen meine Schädeldecke. Ich frage mich, ob es meine negativen Gedanken sind, die ihr Gefängnis verlassen wollen.
Als ich auf die Straße trete, muss ich einsehen, dass auch hier Durchatmen nicht möglich ist. Die Hitze des von der Sonne erwärmten Betons dringt durch meine Schuhe. Auch zwischen den engen Straßen ist die Luft bewegungslos. Sie scheint sich nur unter den Sonnenstrahlen, die erbarmungslos auf Frankfurt herunterdonnern, zu biegen. Wie ein Stück Metall, das ein Schmied bearbeitet. Abgase setzen sich in meiner Nase fest. Meine Haut beginnt schon jetzt zu prickeln, als reiche eine Minute im Freien für einen Sonnenbrand.
Noch immer fühle ich keine Ruhe. Dafür fühle ich alles andere.
Mir bleibt also nur eine Möglichkeit. Ich muss vergessen. Und in dieser Stadt gibt es viele Orte, an denen man das kann. Also laufe ich los.
***
Dass ich die Musik in diesem Laden nicht leiden kann, hat schon vor fünf Shots an Bedeutung verloren. Dass ich nicht gerne tanze, vor drei. Doch einen Gedanken kann ich nicht mal in Tequila ertränken: Ich schaffe das nicht.
Dieser Satz durchfließt mich immer noch. Der einzige Unterschied zu vorher ist, dass er sich an den Beat angepasst hat und nun in einem beständigen Rhythmus in mir erklingt, als wolle er mitsingen. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht.
Als mich dann auch noch ein Kerl von hinten antanzen will und seine Hände nach mir ausstreckt, halte ich es nicht länger aus. Erneut ergreife ich die Flucht. Weil das mit dem Vergessen leider nicht so funktioniert, wie ich gehofft hatte.
Der Boden unter meinen Füßen schwankt. Das ist keine neue Erfahrung. Er steht schon seit Monaten nicht mehr still. Die tanzenden Farben und Menschen machen auf einmal alles nur noch schlimmer. Ich kann nicht mehr atmen. Warum kann ich nirgendwo mehr atmen?
Draußen ist es ein bisschen besser. Die laue Sommernacht umfängt mich. Es ist dunkel, es ist kühler und es ist ruhiger. Doch diese Stimmung will nicht auf mich übergehen. Erst als ich beim zweiten Schritt stolpere, wird mir klar, wie fürchterlich betrunken ich bin. Ich halte mich am nächsten Laternenpfahl fest, um nicht umzukippen. Mir ist nur ein bisschen übel, aber ich befürchte, dass sich dieses leichte Unwohlsein in meiner Magengrube noch auswachsen wird.
So kann ich unmöglich nach Hause gehen. Es ist erst zwölf Uhr. Rosa ist auf jeden Fall noch wach. Wenn sie mich so sieht, wird sie niemals wieder auf mich hören. Doch wo soll ich hin?
Ich lehne mich mit der Stirn gegen das kalte Metall der Laterne. Das hilft. Obwohl es auch ein bisschen eklig ist.
Es gibt nur einen Ort, an den ich gehen kann. Aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich ihn finden werde. So lange war ich nicht mehr dort.
Egal.
Ich steige ins nächste Taxi, weil ich weiß, dass ich im Main ertrinken werde, sollte ich versuchen zu laufen. Während der Fahrt lehne ich meine Wange gegen die Fensterscheibe. Kühle Oberflächen an einem überhitzten Kopf sind gar nicht so schlecht. Sollte ich mir merken.
Irgendwie schaffe ich es, zu bezahlen und auszusteigen. Es ist stockdunkel. Nicht wie vorhin vorm Club. Da war es so dunkel, wie eine Großstadt es eben zulässt. Hier ist es wirklich dunkel: keine Autoscheinwerfer, keine Straßenlaternen, kein Licht in den Fenstern. Hier ist es dunkel und ich bin allein. Wenn ich nicht so betrunken wäre, würde mich das vermutlich beunruhigen. Ein Hoch auf den Alkohol.
Die Schrebergartenanlage öffnet sich vor mir wie ein Labyrinth, das mich einlädt, in ihm verloren zu gehen. Ich bin mitten zwischen den perfekt geschnittenen Hecken und hellgestrichenen Häuschen. Willkommen in der Festung des deutschen Spießertums.
Als kleines Kind war ich oft hier im Schrebergarten meiner Oma. Doch sie ist gestorben wie jedes andere Mitglied unserer Familie. Und ich bin ohne sie nie zurückgekehrt. Bis heute Nacht.
Nur das Knirschen meiner Schuhe auf dem Kiesweg ist zu hören. Nur der Mondschein spendet Licht. Er reicht geradeso aus, dass ich nicht über meine eigenen Füße stolpere.
Ich zwinge mich, nicht zu hinterfragen, was ich hier gerade treibe.
Verstecke ich mich vor meiner dreizehnjährigen Schwester? Ja. Macht mich das erbärmlich? Vermutlich. Wird das etwas an meinem Verhalten ändern? Ganz sicher nicht.
Eigentlich müsste ich die Vernünftigere von uns beiden sein, die Reifere. Aber wie soll ich das hinkriegen, wenn ich mich die meiste Zeit fühle wie ein sechsjähriges Kind, das mitten in der Nacht zu seinen Eltern ins Bett klettern will, weil es einen Albtraum hatte?
Ich habe befürchtet, dass ich Omas Schrebergarten niemals finden würde. Doch es ist erstaunlich leicht. Alle anderen Gärten sind hübsch gepflegt. Nur ihrer nicht. Man sieht ihm sofort an, dass sein Besitzer gestorben ist. Er erinnert mich an einen zerzausten Streuner, der sich ewig auf die Suche nach seinem toten Herrchen macht.
Neben der Schlüsselschale in unserer Wohnung liegt ein hoher Stapel Beschwerdebriefe des Kleingartenvereins, die mich daran erinnern sollen, meine Pflichten als die neue Besitzerin dieses Schrebergartens endlich ernst zu nehmen. Die ersten zwei Briefe habe ich noch geöffnet. Die folgenden nicht mehr. Nun verstehe ich, warum sie sich so aufregen, dass sie Porto für Briefe ausgeben, die sowieso niemand lesen wird.
Die Hecken sind zu einer richtigen Festungsmauer geworden. Sie wuchern wild und biegen sich in die Nachbargärten und den Gehweg. Das Gartenhäuschen sieht aus, als würde ein Windhauch ausreichen, um ihm den Todesstoß zu verpassen. Hoffen wir mal, dass das nicht der Fall ist. Es wäre so ein furchtbar sinnloser Tod, wenn es mich unter sich begraben würde.
Das Gartentor quietscht so laut, als wolle es mich anschreien. Der Weg zum Häuschen ist voller Stolpersteine. Ich bleibe an Gewächsen hängen und schaffe es nur knapp, nicht hinzufallen.
Endlich erreiche ich die Tür. Sie gibt keinen Ton von sich, als ich sie öffne. Im Haus ist es noch dunkler als draußen. Aber ich weiß noch, wo alles ist. Ich laufe hinein.
Ich schaffe genau drei Schritte. Bevor ich auf etwas trete, das dort nicht hingehört. Ich stolpere. Ich kann mich nicht festhalten. Mit einem lauten dumpfen Ton lande ich auf dem Fußboden. Mir entfährt ein überraschter Schrei, als ich falle. Aber nicht nur mir. An meinen überraschten Schrei hängt sich sogleich ein panischer dran. Denn ich bin nicht allein.
2. Kapitel
»Fuck!«
Ich würde ihm ja mitteilen, dass er mir aus der Seele spricht, wenn meine Stimmbänder nicht so belegt wären. Mein Herz scheint erst in meinen Magen gestürzt zu sein und nun in meinem Rachen zu schlagen. Ein unsichtbarer Faden schnürt mir den Hals zu. Ganz automatisch bewege ich mich weg von dem Eindringling, den ich mit meinem Auftreten geweckt habe. Ich rutsche mit meinem Hintern über den staubigen Boden und schiebe mich ungelenk mit meinen Beinen an. Bis es nicht mehr weitergeht und mein Rücken mit einem lauten Knall gegen die Wand prallt. Das hätte vermutlich wehgetan, wenn der Tequila nicht immer noch meinen Körper betäuben würde.
Meinen Geist betäubt der Alkohol aber nicht länger. Ich bin zwar noch viele Stunden Schlaf davon entfernt, wieder nüchtern zu sein, doch meine Sinne sind klarer.
Inzwischen haben sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Doch auch jetzt erkenne ich nur Umrisse. Und der Umriss vor mir bewegt sich. Er steht auf, streckt sich und reibt sich die Stelle an seinem Rücken, gegen die ich getreten bin. Ich weiß nicht, ob er wirklich so groß ist, wie er mir gerade vorkommt. Mindestens zehn Zentimeter seiner Körpergröße sind auf die Dunkelheit, meine Angst und meine Perspektive zurückzuführen. Trotzdem ist mir bewusst, dass es ein Mann ist, der mich überragt.
Hektisch taste ich die Wand neben mir ab. Tatsächlich finden meine Finger den Lichtschalter. Doch abgesehen von einem nervigen Klicken bewirkt er gar nichts. Es bleibt stockdunkel. Damit hätte ich rechnen sollen. Trotzdem verstärkt das wirkungslose Klicken das Zittern meiner Hände. Und ich hatte schon gedacht, unter dem Haus begraben zu werden, wäre ein sinnloser Tod. Über einen Serienmörder zu stolpern, ist definitiv hundertmal schlimmer.
Plötzlich wird es hell. Der Umriss hält eine Campinglampe in der Hand und verwandelt sich von einem Schatten in einen richtigen Menschen.
Das Zittern meiner Hände lässt bei seinem Anblick ein bisschen nach. Sein Gesicht ist weder blutverschmiert noch hält er eine Axt in den Händen.
Er kann nicht viel älter sein als ich. Er ist groß und schlank, mehr drahtig als muskulös. Seine Züge sind kantig, seine Nase leicht schief, was durch die harten Schatten, die der Schein der Campinglampe auf sein Gesicht wirft, noch deutlicher hervortritt. Er hat lockige, braune Haare, die mal wieder einen Schnitt vertragen könnten. Seine Kleidung ist so staubig, als hätte er sich über den Boden der Hütte gewälzt wie ich als kleines Kind über Blumenwiesen. Erst jetzt fällt mir das Jucken meiner Augen auf. Verdammte Stauballergie. Doch ich ignoriere es und lasse den Kerl nicht aus den Augen. Denn er betrachtet mich mindestens genauso aufmerksam wie ich ihn.
»Was zur Hölle machst du hier?«, entfährt es mir etwas verspätet. Diese Frage hätte ich schon vor mindestens zwei Minuten stellen sollen. Doch mit Tequila in den Blutbahnen verlangsamt sich nun mal die Reaktionszeit.
»Das wollte ich dich auch gerade fragen«, gibt er ungerührt zurück und stellt die Lampe auf einem kleinen Holztisch ab. Erst jetzt lasse ich ihn lange genug aus den Augen, um mir das Gartenhäuschen genauer anzusehen. Die Küchenzeile, der Kühlschrank, das kleine Waschbecken, die Klappstühle, die an der Wand lehnen und der Holztisch sind noch genau da, wo sie auch in meiner Erinnerung hingehören. Doch sonst hat sich die Inneneinrichtung verändert. Auf dem Boden liegt eine Luftmatratze mit einer zerwühlten Decke, aus der sich mein Gegenüber gerade schlaftrunken befreit haben muss. Ein großer Rucksack lehnt in einer Ecke und mehrere Kleidungsstücke hängen über einer Wäscheleine, die quer durch den Raum gespannt ist. Auf der Küchenanrichte neben den Herdplatten steht ein beeindruckend hoher Stapel leerer Konservendosen.
»Wie lange schläfst du denn schon hier?«, frage ich und ziehe mich an der Wand hoch.
Er ist nicht einfach ein Betrunkener, der wie ich seinen Rausch in dieser Hütte ausschlafen wollte. Der Kerl wohnt hier.
Ich mustere ihn noch mal genauer. Er sieht vielleicht ein bisschen heruntergekommen aus. Seine Haare haben keine richtige Frisur mehr. Seine Kleidung ist zerknittert und staubig, aber an sich von guter Qualität. Neben der Campinglampe liegt sein iPhone. Der Rucksack ist hochwertiges Wanderequipment.
Ich sehe ihm wieder ins Gesicht. Ich war so sehr in meine eigenen Gedanken vertieft, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass er mir noch nicht auf meine Frage geantwortet hat. Doch dass er meinem bohrenden Blick ausweicht, ist Antwort genug.
»Du kannst doch nicht einfach im Schrebergarten anderer Leute schlafen.«
Das bringt ihn dazu, den Kopf zu heben.
»Bis heute Nacht scheinst du ihn nicht vermisst zu haben«, sagt er nur. Er weicht meinem Blick nicht mehr aus, sondern verschränkt wie ich die Arme vor der Brust und hebt leicht herausfordernd sein Kinn. Wir stehen einander gegenüber wie zwei trotzige Kinder, die sich um ein Spielzeug streiten.
»Das mag sein. Trotzdem gehört der Garten mir«, entgegne ich. Jetzt fällt mir auch noch seine schicke Armbanduhr auf. Jemand, der solche glänzenden Accessoires am Körper baumeln hat, müsste doch wenigstens genug Geld für ein Bett in einem Hostel haben. Was zur Hölle treibt er hier?
»Okay«, setze ich an und zwinge mich, meine Arme sinken zu lassen. Meine Mutter hat immer gesagt, dass vor der Brust verschränkte Arme andere Menschen abschrecken und eine gute Unterhaltung verhindern oder so was in der Art. Und gerade will ich eine ehrliche Antwort. Also halte ich mich an den Vorschlag meiner Mutter. Nun weiß ich nur leider nicht länger, wohin mit meinen Händen. Sind die sonst auch immer so im Weg? »Ich werde dich nicht sofort rausschmeißen, aber nur, wenn du mir erzählst, was du hier treibst.«
Ich hatte gehofft, ihn zum Reden zu bringen, doch seinem Mund entweichen keine Worte, sondern ein verächtliches Lachen, das mich mit den Zähnen knirschen lässt. Ich bin nicht von zuhause geflohen, um gleich von der nächsten Person angezickt zu werden. Aber dass meine Nerven heute ohnehin schon zum Zerreißen gespannt sind, scheint den Kerl nicht zu kümmern.
»Mich rausschmeißen? Ich würde gerne sehen, wie du es versuchst.« Er wirft mir einen vielsagenden Blick zu, der meine Körpergröße abschätzt. Meine ein Meter einundsechzig wirken leider nur wenig furchteinflößend. Eigentlich stört mich meine Größe nicht, aber wenn ich zwanzig Zentimeter größer wäre, wäre diese Unterhaltung definitiv eine andere.
»Natürlich schmeiße ich dich nicht selbst raus. Ich bin kein Türsteher. Aber du stehst auf meinem Grund und Boden. Ich könnte die Polizei rufen.«
Der Kerl zuckt zwar nicht mit der Wimper, aber er mustert mich so eingehend, als würde ihm mein Aussehen Ausschluss darüber geben, ob ich so weit gehen würde. Ich hoffe, er sieht mir an, dass ich an dem heutigen Tag zu allem fähig bin, wenn ich dann nur endlich meine Ruhe bekomme.
»Also«, setze ich an, weil ich den Kerl kurzzeitig sprachlos gemacht habe. »Machen wir es doch auf die einfache Tour. Du erzählst mir, was du hier treibst und ich warte noch, bis ich die Polizei rufe.« Ich nehme zwei Klappstühle von der Wand, stelle sie gegenüber voneinander auf und lasse mich auf einen fallen. Ich frage mich, warum ich meine Drohung nicht gleich wahrmache. Das wäre die logische Reaktion auf diese seltsame Situation. Stattdessen bilde ich einen Stuhlkreis. Der Tequila scheint mehr Kontrolle über mein Entscheidungsvermögen zu haben, als ich gehofft hatte. Ich würde mich nicht viel verrückter aufführen, wenn ich einem Einbrecher, dem ich in unserer Wohnung begegne, einen Kaffee anbieten und mir seine Lebensgeschichte anhören würde. Aber ich meine, was ist schon normal? Ich bin zwanzig Jahre alt und die »Mutter« einer Dreizehnjährigen. Das Leben hat schon vor Monaten aufgehört, Sinn zu ergeben. Und je früher ich das akzeptiere, desto besser wird es mir damit gehen.
Ich warte ab. Meine Arme habe ich wieder vor meiner Brust verschränkt, weil ich mich damit doch wohler fühle. Der Kerl hat es mit seinem bockigen Verhalten ohnehin nicht verdient, dass ich seinetwegen alte Gewohnheiten aufgebe.
Er zögert noch eine Sekunde, beäugt den Stuhl, als hätte ich ein Furzkissen oder Schlimmeres dort deponiert, doch dann lässt er sich mir gegenüber sinken. Er rutscht so tief in den Stuhl hinein, dass sich unsere Knie fast berühren.
»Wie heißt du?«, frage ich, weil ich müde werde, ihn in meinem Kopf als »den Kerl« zu bezeichnen. Er reagiert nicht sofort, also füge ich hinzu: »Mein Name ist Lotta.«
»Jasper«, gibt er sich geschlagen und setzt sich gerader hin.
»Jasper«, beginne ich, »warum schläft der Besitzer einer glitzernden Uhr und des neusten iPhones in einer schäbigen Gartenhütte wie dieser hier?«
Er grinst leicht. Die Lampe auf dem Holztisch wirft Schatten auf sein Gesicht, und sobald sich seine Züge verziehen, beginnen die Schatten zu tanzen, als hätte er sie mit seinen Bewegungen aufgescheucht. Seine Augenfarbe kann ich im Halbdunkel nicht erkennen.
»Erschien mir die einfachste Lösung für all meine Probleme zu sein«, sagt er leichthin, doch ich kann sehen, dass sich sein Kiefer anspannt. Ich kenne dieses Gefühl. Wenn man Worte, die sich gegen einen wehren, herauszwängen muss, weil andere Menschen erwarten, sie zu hören. Immer, wenn Leute mich fragen, wie es mir als Erziehungsberechtigte meiner Schwester ergeht, lächle ich und sage Phrasen wie: »Es läuft gut.« Oder »Ich komme klar.« Oder wenn ich mich an dem Tag mal besonders ehrlich fühle: »Manchmal ist es schwer, aber wir kriegen das hin.« Aber egal, wie man es auch dreht und wendet, alle diese Sätze sind Lügen. Und weil der Körper das weiß, versteift sich der Kiefer. Der Körper ist so viel ehrlicher, als der Kopf jemals sein könnte.
»Das bezweifle ich«, widerspreche ich ihm. »Allein wenn du die Uhr verkaufen würdest, könntest du dir eine wesentlich gemütlichere Bleibe leisten.«
»Warum sollte ich für eine Unterkunft bezahlen, wenn ich die hier umsonst bekomme?« Er weicht mir aus.
»Hast du in deinem Leben jemals eine gradlinige Antwort auf eine Frage gegeben?«, frage ich leicht genervt. Ich kann jetzt schon die Vorwehen der Kopfschmerzen spüren, die mir den morgigen Tag zur Hölle machen werden. Ein schaler Geschmack breitet sich in meinem Mund aus. Außerdem bringt der Staub meine Augen zum Brennen.
»Zumindest nicht auf deine«, sagt Jasper. Er beugt sich nach vorne, bis er seine Unterarme auf seinen Beinen abstützen kann, und fixiert mich. »Was genau treibst du mitten in der Nacht hier?« Er atmet ein und an seinem Gesichtsausdruck erkenne ich, dass mein Alkoholatem ihm bereits die Antwort auf seine Frage gegeben hat. Sag ich’s doch, der Körper ist ehrlicher als alles, was Menschen sagen könnten. »Verstehe«, sagt Jasper und lehnt sich wieder zurück. »Du willst dich deinen Eltern nicht betrunken stellen müssen.«
Allein die Erwähnung reicht, um mir einen schmerzhaften Stich zu verpassen.
»Falsch«, sage ich und versuche gelassen zu klingen. Doch so richtig kriege ich es nicht hin. Meine brennenden Augen sind dabei auch nicht gerade eine große Hilfe.
»Was ist dann der Grund?«
Er versucht, den Spieß herumzudrehen. Doch so einfach kommt er mir nicht davon.
»Ich muss dir nicht antworten. Du bist der Einbrecher in meinem Gartenhäuschen und nicht umgekehrt«, sage ich. »Und wenn du mir nicht antwortest, rufe ich doch die Polizei. Denn es gibt genau zwei Erklärungen dafür, dass du mir ausweichst. Entweder die Wahrheit ist dir peinlich oder die Wahrheit beinhaltet eine Straftat. Wenn es peinlich ist, werde ich noch mal darüber nachdenken, ob ich die Polizei rufe. Hast du aber was Illegales gemacht, will ich, dass du sofort von hier verschwindest.«
Der Schatten seines Grinsens verschwindet, und er seufzt tief. Ich habe einen wunden Punkt getroffen. Er tut vielleicht so, als wäre er ganz entspannt, aber er kann es auch nicht riskieren, dass ich ihn rausschmeiße. Er braucht diesen Ort. Und dass er so verzweifelt ist, macht mich nur noch neugieriger.
»Ich verrate dir, warum ich hier bin, wenn du mir verrätst, warum du hier bist«, sagt er.
Ich kneife die Augen zusammen. Ich weiß echt nicht, was ich von diesem Kerl halten soll. Er führt Gespräche, als würde er ein Schiff lenken und Eisbergen ausweichen müssen. Als wäre jede Information, die er preisgibt, am Ende der Grund, warum er untergeht.
»Deal«, sage ich. »Du zuerst.«
An Jaspers aufflammendem Grinsen erkenne ich, dass er genau das Gleiche sagen wollte. Doch er nickt und gibt sich das erste Mal in diesem Gespräch, das sich mehr wie ein Schwertkampf angefühlt hat, geschlagen.
»Ich bin kein Verbrecher auf der Flucht vor dem Gesetz«, sagt er in einem Tonfall, der sich wohl über mich lustig machen soll. Komischerweise wird er nach diesem Satz ein bisschen ernster. Noch nicht ernst genug, um als verantwortungsbewusster Erwachsener durchzugehen, aber gerade ernst genug, dass ich ihm noch keine reinhauen will. »Ich habe auch keine tragische Vergangenheit, die mich hierhergeführt hat. In meinem Leben ist eigentlich nie was wirklich Schlimmes passiert. Ich bin einfach ein zwanzigjähriger Typ, der seinen Scheiß nicht auf die Reihe kriegt.«
Zwar ist das immer noch keine gradlinige Antwort, aber ich beschwere mich nicht. Ich sehe ihn eine Weile einfach nur an, weil ich seine Aussage wesentlich besser verstehe, als ich zugeben will.
Ich kriege meinen Scheiß auch nicht auf die Reihe. Eigentlich müsste ich erwachsen sein, doch schon seit Monaten fühle ich mich, als hätte ich diesen letzten Schritt fort von meiner Kindheit nie geschafft, als hätte ich es mir zwei Meter vor der Zielgeraden anders überlegt und statt weiterzulaufen, mich im Schneidersitz hingesetzt, unfähig jemals wieder aufzustehen.
Ich überlege, was ich zu Jasper sagen soll. Doch bevor ich einen Satz herausbringen kann, stoße ich den stärksten Nieser meines Lebens aus. Es hätte mich nicht überrascht, wenn er genug Druckkraft gehabt hätte, um mich aus dem Stuhl zu heben und gegen die Wand hinter mir zu schleudern. Und danach hört es nicht auf. Der Staub kitzelt erbarmungslos in meiner Nase. Ich habe meine Allergie lange genug ausblenden können, jetzt lässt sie sich nicht mehr ignorieren.
»Alles gut bei dir?«, fragt Jasper und sieht mich besorgt an – wenn auch aus gewissem Sicherheitsabstand. Vermutlich fragt er sich gerade, ob ich eine ansteckende Krankheit habe.
»Stauballergie«, sage ich und kriege es hin, meine Nase kurz zur Ruhe zu bringen. Doch meine Augen brennen inzwischen so stark, dass ich sie nicht mehr ganz offen halten kann. »Ich muss hier raus.« Ich stehe auf und trete vor die Tür. Die Bank, die schon in ihren guten Tagen alt war, steht noch immer direkt vorm Häuschen, wenn sie auch von einigen Sträuchern überwuchert ist. Doch darum kümmere ich mich nicht. Ich lasse mich darauf nieder und atme einmal tief durch. Da haben wir es mal wieder. Egal, wo ich in dieser heißen Stadt auch bin. Nirgendwo kann ich richtig atmen.
Ich denke schon, dass Jasper die Tür von innen abschließen und sich einfach wieder schlafen legen wird, doch dann tritt er ebenfalls hinaus und lässt sich neben mir nieder. In der Hand eine Flasche, deren grünlicher Inhalt verheißungsvoll im Mondschein glitzert.
»Ich dachte, vielleicht brauchst du Nachschub«, sagt Jasper und schwenkt die Flasche.
»Ist das Pfeffi?«, frage ich und ziehe ganz automatisch die Nase kraus. Meine Reaktion entgeht Jasper keineswegs.
»Was soll denn diese Frage? Wenn du sie schon stellst, dann bitte mit mehr Elan und Begeisterung.«
Ich schüttle den Kopf auf diese leicht gönnerhafte Weise, die Erwachsene nur kleinen Kindern entgegenbringen können, zum Beispiel, wenn sie Kinder dabei beobachten, wie sie versuchen, sich ihre Hose über den Kopf zu ziehen. Das hat Rosa mal gemacht, als sie noch klein und süß war und ich noch nicht das Bedürfnis hatte, ihr täglich mindestens zweimal einen Eimer Eiswasser über den Kopf zu schütten.
»Wer ist schon begeistert beim Anblick von Pfeffi?«, frage ich und habe die Antwort auf meine Frage, sobald ich mich Jasper zuwende. Der Typ, der im Gartenhäuschen eines verwilderten Schrebergartens wohnt, ist ein Pfeffi-Enthusiast. Es sollte mich nicht überraschen.
»Auf diesen entmutigenden Ton werde ich erst gar nicht eingehen«, sagt Jasper und hält mir die Flasche weiterhin auffordernd unter die Nase. Ich seufze und nehme sie entgegen. Vielleicht hat der Tequila meine Geschmacksnerven genug außer Gefecht gesetzt, dass ich gar nicht merke, was ich da eigentlich trinke.
Ich nehme einen großen Schluck – und huste.
Ja, ich hatte recht. Es schmeckt immer noch nach abgestandener Mundspülung. Wenigstens habe ich jetzt nicht mehr diesen schalen Alkoholgeschmack auf der Zunge liegen. Ich gebe Jasper die Flasche zurück und er trinkt ebenfalls daraus. Da er einen beeindruckenden Zug vorlegt, könnte ich Glück haben, dass er die Flasche schon geleert hat, bevor ihm auffällt, dass er mich zu einem weiteren Schluck nötigen könnte.
Wir schweigen eine Weile. Ich sehe einfach in den Himmel, traurig darüber, dass selbst in so einer wolkenklaren Nacht kaum Sterne zu sehen sind. Meine Beine ziehe ich an den Körper und umschlinge sie mit den Armen. Das habe ich schon immer gemacht. Als wollte ich mich noch kleiner machen, als ich ohnehin schon bin.
Jasper hat mich nicht noch mal gefragt, was ich hier mache. Doch die Worte entkommen mir, bevor ich sie wieder gefangen nehmen kann.
»Ich verstecke mich nicht vor meinen Eltern, sondern vor meiner dreizehnjährigen Schwester. Unsere Eltern sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Seitdem bin ich ihre Erziehungsberechtigte. Und ich will nicht, dass sie mich betrunken erlebt. Dann wäre ich ein noch schlechteres Vorbild als ich es ohnehin schon bin.«
Es war schon vorher unglaublich still in diesem Schrebergarten, der nur an den Himmel und nicht an eine Großstadt zu grenzen scheint. Doch meine Worte vertiefen die Stille. Sie höhlen sie aus, wie ein Vakuum. In dem nichts zurückbleibt. Ich bilde mir ein, dass Jasper aufgehört hat zu atmen.
Ich warte auf all die Plattitüden, die ich inzwischen auswendig aufsagen kann. All die Dinge, von denen wir Menschen denken, dass wir sie in gewissen Situationen sagen müssen. Doch Jasper benutzt keine von ihnen. Als wäre auch er müde geworden, diese abgenutzten Sätze zu verwenden.
»Dreizehn Jahre alt? Was für ein beschissenes Alter.«
Ich bin so überrascht von dieser Aussage, dass ich ein kleines hysterisches Lachen ausstoße.
»Das kannst du laut sagen. Meine Schwester ist der absolute Albtraum.«
»Was macht sie?«
»Sie äfft mich mit irgendwelchen nervigen Stimmen nach, wenn ich versuche, ein ernstes Gespräch mit ihr zu führen.«
»Der Klassiker.«
»Sie schwänzt die Schule.«
»Natürlich tut sie das.«
»Sie macht nie das, was ich ihr sage.«
»Logisch.«
»Die knallt ihre Zimmertür.«
»Das finde ich jetzt ein bisschen unkreativ. Hätte mehr von ihr erwartet.«
Ich grinse. Jaspers Antworten, die hervorragend zu einem Schulterzucken gepasst hätten, haben mich tatsächlich ein bisschen aufgemuntert. Wer hätte das gedacht?
Ich mustere ihn kurz unauffällig von der Seite. Er hat das Gesicht verzogen, als würde er nachdenken. Noch immer erkenne ich nicht die Farbe seiner Augen.
»Weißt du, was sie braucht?«, fragt er schließlich und sieht mich direkt an.
»Was?«
»Eine Aufgabe.«
»Ist Schule nicht eine Aufgabe?«, frage ich trocken zurück und knirsche mit den Zähnen beim Gedanken an all die Zettel mit in rot geschriebenen schlechten Noten, die ich in den letzten Monaten unterschreiben musste.
»Eins muss ich dir lassen«, sagt Jasper und grinst mich dabei voller Schalk an. »Du klingst wenigstens schon wie eine Mutter.«
Ich ramme ihm ohne Rücksicht auf Verluste meinen spitzen Ellbogen in die Seite. Vor Schreck fällt ihm fast die Flasche aus der Hand. Aber leider nur fast.
»Deine Reaktion war nur so gewalttätig, weil du weißt, dass es wahr ist«, sagt er. »Du musst sie irgendwie beschäftigen. Vor allem jetzt in den Sommerferien. Damit sie nicht auf dumme Ideen kommt.«
Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich habe mich an meine eigene rebellische Teenager-Phase erinnert und bin fast in Angstschweiß ausgebrochen. Wenn meine Schwester nur halb so schlimm wird wie ich, habe ich ein riesiges Problem.
»Und was soll ich mit ihr machen?«
Jasper muss nicht überlegen. Er scheint nur auf diese Frage gewartet zu haben.
»Sieh dich doch um. Dieser Ort ist das perfekte Projekt«, sagt er und lässt seine Arme über unsere Umgebung schweifen wie ein Zirkusdirektor über seine Manege. Selbst im Schutz der Dunkelheit erkenne ich, wie sehr ich diesen Ort habe verkommen lassen. Nur eine meiner vielen neuen Verantwortungen, die ich so grandios in den Sand setze, als sei das Scheitern das Ziel.
Jaspers Idee ist nicht schlecht. Doch ich bin misstrauisch.
»Ich habe so das Gefühl, dass auch für dich etwas dabei rausspringen soll«, sage ich, und Jaspers Grinsen gibt mir recht.
»Dafür, dass ich dir dabei helfe, aus diesem Dschungel wieder einen Garten zu machen, darf ich weiterhin hier wohnen.«
Habe ich es mir doch gedacht. Mit dieser Aussage erinnert er mich an ein weiteres meiner tausend Probleme: Was mache ich mit dem Verrückten, der in meinem Schrebergarten schläft?
»Und was soll ich meiner Schwester über dich sagen? Es ist nicht gerade fürsorglich von mir, wenn ich sie in Kontakt mit einem durchgeknallten Fremden bringe.«
»So schlimm bin ich doch gar nicht!«, sagt Jasper, doch er klingt, als würde auch er gerade daran zweifeln.
»Du lebst in unserem Schrebergarten. Im 21. Jahrhundert gilt so was als seltsam.«
Jasper lacht auf. »Dagegen kann ich nichts sagen.«
Wir schweigen wieder. Ich atme tief durch und blicke auf die Uhr. Es ist zwei Uhr morgens und mein Kopf ist klar. Um diese Uhrzeit wird Rosa schon tief und fest schlafen. Und wenn sie erstmal schläft, kann sie niemand wecken. Ich erinnere mich an all die Nächte, in denen ich betrunken in die Wohnung getorkelt bin und mich schreiend mit unserer Mutter gestritten habe. Rosa ist nie aufgewacht. Also kann ich endlich nach Hause gehen.
Ich erhebe mich von der Bank und habe eigentlich vor, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, den Schrebergarten zu verlassen, weil ich nicht weiß, was ich zu dieser Situation sagen soll. Doch Jasper funkt mir dazwischen.
»Wirst du mich rausschmeißen?« Das erste Mal in dieser Nacht klingt er vollkommen ernst. Nicht ein Hauch von Sarkasmus ist in seiner Stimme zurückgeblieben. Also drehe ich mich noch einmal zu ihm um.
Ich sehe ihn lange an. Seine Haltung verrät, dass er mal genug Selbstvertrauen gehabt hat, um einen ganzen Raum einzunehmen. Doch dieses Selbstvertrauen ist genauso wie seine Kleidung von einer dicken Schicht Staub bedeckt. Wie er so da sitzt, auf der alten Bank, die Flasche in der Hand, die Haare zu lang, sieht er nur noch verloren aus.
Es ist lange her, dass ich mich in einer anderen Person so deutlich wiedererkannt habe.
»Das weiß ich noch nicht«, sage ich ehrlich und lasse den Schrebergarten und Jasper hinter mir.
3. Kapitel
Strenger Dutt, strenge Augen, strenge Haltung – sie sieht genauso aus, wie ich sie in Erinnerung hatte.
Vor zwei Jahren habe ich mir mein Zeugnis geschnappt, mit einer Note, auf die ich gerade lieber nicht so genau eingehen will, und habe diesen Gesichtsausdruck, diese Linoleum-Böden und das hässliche Gelb, in dem alle Wände hier gestrichen sind, hinter mir gelassen. Damals hatte ich gehofft, dass mein Abschied von dieser Schule für immer wäre. Doch das Universum wollte es natürlich anders.
Ich sitze auf einem der unbequemen Stühle, die meinem Hintern noch viel zu vertraut vorkommen, vor einem Pult, das noch genau an der gleichen Stelle steht, vor einer Frau, die mich mit dem gleichen missbilligenden Blick bedenkt, den sie auch früher nur für mich übrig hatte. Ich habe diese Frau abgrundtief gehasst. Und das Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit. Frau Müller hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie mir meine Lese-Rechtschreib-Schwäche nicht abgenommen hat und für eine meiner vielen kreativen Notlügen gehalten hat. Dass ich eine Bescheinigung hatte, hat daran nichts geändert.
Aber ich will nicht so tun, als wäre ich das unschuldige Opfer gewesen. Das war ich nun wirklich nicht. Meine einzige Beteiligung an ihrem Unterricht waren meine unpassenden Kommentare, die ihr Gesicht so rot haben anlaufen lassen, als bekäme sie auf einmal keine Luft mehr. Ich habe ihr jeden Streich gespielt, der mir eingefallen ist, und dafür gesorgt, dass die Klasse während ihres Unterrichts immer unruhig war.
Sie war genauso froh mich endlich loszuwerden wie ich sie. Deswegen hat sie mich in meinen letzten Schuljahren vermutlich auch nicht durchfallen lassen, sondern es bei gnädigen fünf Punkten für meine furchtbaren Analyse-Aufsätze zu Faust und expressionistischen Gedichten belassen, damit sie mich, meine aufmüpfige Klappe und meine Fehlstunden keinen Tag länger als nötig ertragen musste.
Ich sitze wie damals zusammengesunken auf meinem Stuhl. Mein Körper nimmt diese Haltung ganz von alleine ein. Als hätte er vergessen, dass ich nicht mehr ihre Schülerin bin. Das hier ist keine Rüge. Das hier ist ein Eltern-Lehrer-Gespräch. Zumindest habe ich das geglaubt, bis ich diesen Raum betreten habe. Nun weiß ich, dass mich irgendeine Zeitmaschine in meine Schulzeit zurückversetzt hat. Was für ein grausamer Streich das ist.
Das Zeugnis, das sie mir mit ihren perfekt manikürten Fingern über den Tisch entgegengeschoben hat, ist zwar nicht meins, aber es sieht meinen Zeugnissen verdammt ähnlich. Und es kann unmöglich ein Zeugnis meiner Schwester sein. Charlotta Schulz ist das Problemkind. Die nutzlose Studentin, die sich nicht länger als ein Semester auf einen Studiengang festlegen kann. Die alles beginnt und nichts fertig macht. Rosalie Schulz ist die gute Schwester. Das kleine Wunderkind mit dem riesigen Gehirn und den guten Noten, der perfekten Anwesenheitsliste und dem süßen Lächeln.
Doch wie es aussieht, hat sich das geändert.
»Sie sehen, Frau Schulz, die Noten ihrer Schwester lassen sehr zu wünschen übrig.« Sie siezt mich und nennt mich »Frau Schulz«, weil ich eben nicht mehr ihre Schülerin bin, aber ich sehe ihr an, dass ihr dieser höfliche Tonfall extrem schwerfällt. Ich kann es ihr nicht verübeln. Wenn man Jahre lang immer nur wütend »Charlotta« geschrien hat, ist es schwer, auf einmal Respekt zu heucheln. Ihren Respekt habe ich mir nie verdient.
Ich muss mich anstrengen, mich beim Klang ihrer Stimme nicht zu winden wie eine Schlange. Ich habe ihre Stimme nie vergessen. Sie hat mich bis in meine Albträume verfolgt, in denen ich meine Deutschabiturprüfung noch einmal durchleben musste. Ja, ich habe noch immer Albträume davon. Und nein, das ist überhaupt nicht lächerlich. Wäre das hier eine Fantasy-Geschichte, wäre sie die böse Hexe, gegen die ich kämpfen müsste und gegen die ich vermutlich verlieren würde. Sind wir mal ehrlich, ich bin kein Heldinnen-Material. Ich würde mich entweder verstecken oder es versuchen und alles nur noch schlimmer machen, genau wie in meinem echten Leben.
Die Noten auf dem Zettel vor mir schockieren mich. Das schlechteste, was meine Schwester jemals kassiert hat, war eine verfluchte Zwei minus in einer Mathematik-Klausur, und sie hat deswegen zwei Wochen heulend in ihrem Zimmer verbracht. Danach ist ihr das nie wieder passiert. Aus purer Willenskraft wurde Mathematik zu ihrem besten Fach. Einfach, weil sie es sich in den Kopf gesetzt hatte und weil ihr Gehirn zu allem in der Lage ist, was sie sich vornimmt. Diese Noten sind lächerlich. Meine Schwester ist zu schlau dafür. Selbst wenn sie auf einmal nichts mehr für die Schule machen würde, hätte sie bessere Noten als Vierer. Mich beschleicht die Ahnung, dass Rosa ihre Arbeiten absichtlich in den Sand setzt. Was sie damit erreichen will, erschließt sich mir jedoch nicht.
»Wir wissen beide, dass Ihre Schwester besser ist als das hier.« Frau Müller spricht genau das aus, was ich mir gerade gedacht habe. Trotzdem sträubt sich alles in mir dagegen, ihr auch nur einen Millimeter entgegen zu kommen. Schlechte Angewohnheiten sterben nur schwerlich. Und meine haben einen besonders starken Überlebenswillen. »Wir wissen, dass die Gründe für diese Noten nicht akademischer Natur sind.« Der Blick, den sie mir zuwirft, gibt mir deutlich zu verstehen, dass sie davon ausgeht, den Schuldigen für diese Noten direkt vor sich sitzen zu haben. Und leider kann ich ihr nicht widersprechen. Diese Noten sind genauso meine Schuld wie meine eigenen.
»Sie wissen, dass unsere Eltern erst vor Kurzem gestorben sind. Da wird es doch wohl möglich sein, Milde walten zu lassen«, setze ich an und zwinge mich, mich gerader hinzusetzen. Ich bin kein Schulkind mehr. Ich muss aufhören das ständig zu vergessen.
»Wir haben Milde walten lassen«, sagt Frau Müller erbarmungslos. »Ihre Klausuren waren alle sehr schlecht, aber die Lehrer haben sich entschieden, ihr gute mündliche Noten zu geben, um es damit auszugleichen. Obwohl sie sich nicht mehr am Unterricht beteiligt, sondern nur noch gestört hat.« Ich bin mir sicher, dass sie gern noch hinzugesetzt hätte, an wen sie dieses Verhalten erinnert. Aber vermutlich geht sie davon aus, dass ihr Gesichtsausdruck das auch alleine vermitteln kann. Frau Müller hat noch nie viele Worte gebraucht. Ihre dünngezupften Brauen und ihre Nase, die so schmal ist, als wäre sie lieber ein Messer geworden, sind sehr ausdrucksstark.
Ich schlucke. Noch immer starre ich das ernüchternde Zeugnis vor mir an, das mir vorkommt wie die Bewertung meiner elterlichen Fähigkeiten. Ich scheitere. Nun habe ich den Beweis dafür schwarz auf weiß vor mir liegen.
»Haben Sie schon einen Plan, wie Sie das beheben wollen?«, fragt Frau Müller, weil ich nicht auf ihre letzte Aussage reagiert habe. Mein Mund ist staubtrocken und die Sonne, die durch die Fenster auf meine nackten Schultern knallt, scheint meine Haut zum Knistern zu bringen. Druck baut sich in meinem Brustkorb auf, als hätte sich Frau Müller daraufgesetzt.
Habe ich einen Plan? Natürlich habe ich keinen. Sonst wäre dieser ganze Mist nicht so weit gekommen. Hätte ich einen Plan, würde meine Schwester länger als zwei Minuten mit mir in einem Zimmer verweilen, ohne mich anzuschreien. Hätte ich einen Plan, würden mir jetzt nicht Tränen in der Nase brennen. Verdammt, ich darf jetzt auf keinen Fall weinen. Diese Genugtuung habe ich dem alten Drachen nicht gegeben, als ich hier noch zur Schule gegangen bin. Also werde ich das jetzt nicht nachholen.
Ich blicke kurz nach oben an die Decke, die aus diesen kleinen Quadraten besteht, die man problemlos hochdrücken kann und hinter denen ich schon stinkende Fische deponiert habe, und blinzle. Die Tränen verschwinden. Alles andere bleibt.
Frau Müllers Blick ist immer noch erbarmungslos, doch ich zwinge mich ihm standzuhalten. Ich bin eine erwachsene Frau. Sie kann mir nicht mehr Strafarbeiten und Nachsitzen aufbrummen, auch wenn sie das vermutlich gerne würde. Und ich spiele keine dummen Streiche mehr, die solche Strafen rechtfertigen würden. Ich bin erwachsen und nicht nur für mich selbst verantwortlich. Es ist nicht länger nur meine Zukunft, die ich mit meinem Verhalten und meiner Ziellosigkeit versaue, sondern auch eine andere. Eine Zukunft, die so viel mehr Potential hat als meine.
Und auch das weiß Frau Müller. Mich hat sie wohl schon an meinem ersten Schultag als hoffnungslosen Fall abgestempelt, aber ich weiß, dass ihr meine Schwester am Herzen liegt. Ich weiß, dass sie mich genauso wenig wiedersehen wollte, wie ich sie. Und trotzdem hat sie mich hierhergebeten, weil die Zukunft meiner Schwester wichtiger ist als ihr Stolz. Und sie muss auch wichtiger als meiner sein.
»Noch nicht«, gebe ich also zu. »Aber ich werde mir was einfallen lassen.« Ich warte schon darauf, dass Frau Müller diese leeren Worte, die sie von mir gewohnt ist, mit einem schneidenden Kommentar quittiert. Doch zu meiner Überraschung tut sie das nicht.
»Gut«, sagt sie und nickt auf die gleiche hektische Weise wie damals auch schon. Als könne sie sich nicht einmal für eine kleine Geste Zeit nehmen. Ich erhebe mich steif. Meine nackten Beine kleben am Stuhl fest und beim Abziehen der Haut vom warmen Plastik gebe ich ein unvorteilhaftes Geräusch von mir. Umständlich ziehe ich mir meinen leichten Sommerrock, der mir viel zu weit hochgerutscht war, wieder bis zu den Knien runter. Allein diese Kleinigkeit lässt mich mich mal wieder wie eine Idiotin fühlen.
Frau Müller hat ihren Blick schon wieder auf ihre Unterlagen gerichtet. Ich nehme Rosas Zeugnis vom Pult, obwohl ich es lieber zurücklassen würde, und wende mich zum Gehen, weil ich nicht davon ausgehe, dass Frau Müller mich noch eines höflichen Wortes bedenken wird.
Als meine Hand die Klinke des Klassenzimmers berührt, vernehme ich ein vornehmes Räuspern, das mich innehalten lässt. Unwillig drehe ich meinen Kopf. Dieses Räuspern hat noch nie etwas Gutes bedeutet.
Doch der Ausdruck in Frau Müllers Gesicht überrascht mich. Die Härte hat sich bis zu ihrem Haaransatz zurückgezogen und lässt Platz für Mitgefühl. Ehrliches Mitgefühl.
»Lotta«, beginnt sie. Die gespielte Höflichkeit ist fort. Da steht für einige Sekunden nichts mehr zwischen uns. »Es tut mir leid, dass deine Eltern gestorben sind und du nun die Verantwortung für deine Schwester trägst. Mein Beileid.«
Ich muss so schwer schlucken, dass ich schon glaube, ich würde mir dabei einen Muskel im Hals zerren.
»Danke«, sage ich mit zittriger Stimme.
Wieder nickt sie hektisch und ich bin entlassen.
4. Kapitel
Der tennisballgroße Kloß in meinem Hals will sich einfach nicht auflösen. Egal, wie oft ich auch trocken schlucke. Er bleibt an Ort und Stelle. Mit Frau Müllers schneidenden Kommentaren wäre ich so viel besser klargekommen als mit ihrem Mitgefühl. Ich kann nicht erklären, warum ihre Worte so wehtun. Sie sollten ein Trost sein. Aber irgendwie haben sie alles nur noch schlimmer gemacht.
Das Blatt in meiner Hand scheint sich durch meine Haut zu fressen. Ich würde das Zeugnis am liebsten verbrennen. Vielleicht übernimmt das ja die erbarmungslose Hochsommer-Sonne für mich. Aber das wird die Noten auch nicht verschwinden lassen.
Draußen auf dem Schulhof atme ich mehrmals tief durch und blicke mich um. Ich habe Rosa gesagt, dass sie hier auf mich warten soll, damit wir gemeinsam nach Hause fahren können. Was für eine Überraschung. Sie hat nicht auf mich gewartet. Zumindest kann ich sie nirgendwo entdecken.