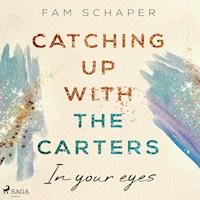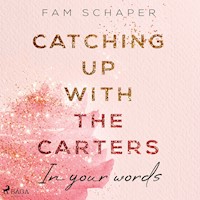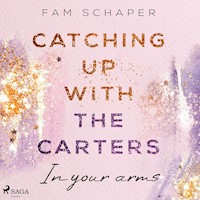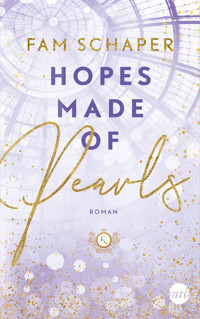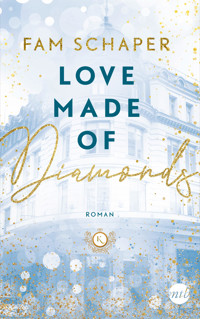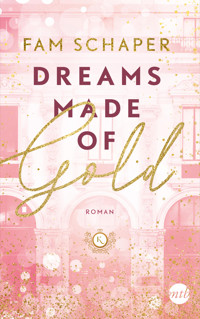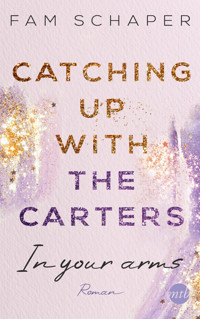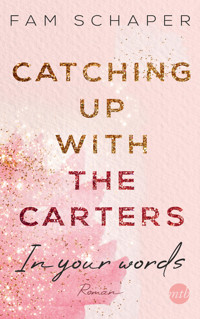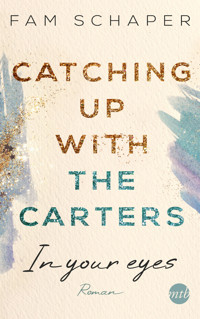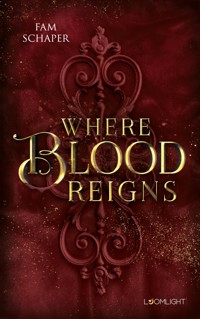
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Einst war ich eine Jägerin, nun bin ich eine Gejagte. Als Erbin des mächtigsten Vampirjäger-Clans soll Lana Delacroix eigentlich das Vermächtnis ihres Vaters antreten. Doch dann wird sie gebissen und verwandelt sich ausgerechnet in eines jener Monster, die zu töten ihre Bestimmung ist. Ihr Schöpfer, der attraktive Vampir Nic, ist nun für sie verantwortlich. So will es das Gesetz der Vampire. Dass Nic sie abgrundtief hasst, macht ihre Situation umso schwerer. Indes braut sich auf den Straßen von Paris ein Krieg zusammen, der Vampire und Jäger für immer vernichten könnte … Düster & spicy – Urban Fantasy im Herzen von Paris! //»Where Blood Reigns« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
„Einst war ich eine Jägerin, nun bin ich eine Gejagte.“
Als Erbin des mächtigsten Vampirjäger-Clans soll Lana Delacroix eigentlich das Vermächtnis ihres Vaters antreten. Doch dann wird sie gebissen und verwandelt sich ausgerechnet in eines jener Monster, die zu töten ihre Bestimmung ist. Ihr Schöpfer, der attraktive Vampir Nic, ist nun für sie verantwortlich. So will es das Gesetz der Vampire. Dass Nic sie abgrundtief hasst, macht ihre Situation umso schwerer. Indes braut sich auf den Straßen von Paris ein Krieg zusammen, der Vampire und Jäger für immer vernichten könnte ...
Die Autorin
© Schaper Kommunikation
Fam Schaper wurde 1997 in der Nähe von Frankfurt am Main geboren, lebt aber seit einigen Jahren in Berlin. Sie hat schon New Adult-Romane veröffentlicht, doch seit ihrer Kindheit schlägt ihr Herz für Fantasy-Geschichten. Ihre Zeit verbringt sie am liebsten mit Freunden im Park, in Secondhand- und natürlich Buchläden. Neben ihrer Arbeit als Autorin ist sie auch als Lektorin tätig – sie beschäftigt sich also den ganzen Tag mit Geschichten und möchte damit auf keinen Fall wieder aufhören.
Fam Schaper auf Instagram: www.instagram.com/famschaper/?hl=de
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Loomlight auch!
Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor:innen und Übersetzer:innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator:innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autoren auf: www.thienemann-esslinger.de
Loomlight auf Instagram: https://www.instagram.com/thienemannesslinger_booklove
Viel Spaß beim Lesen!
Fam Schaper
Where Blood Reigns
Liebe Leser:innen,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte.
Auf der vorletzten Seite findest du eine Themenübersicht, die Spoiler für die Geschichte enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest.
Wir wünschen dir das bestmögliche Leseerlebnis!
Fam Schaper und das Loomlight-Team
Für meine Mama,
die all meine Bücher gelesen hat, obwohl in ihnen niemand gestorben ist.
Keine Sorge, dein Warten auf ein blutrünstiges Buch von mir hat ein Ende.
Und für meinen Papa,
von dem ich meine Begeisterungsfähigkeit geerbt habe (sind wir immer dankbar, dass wir sie haben?) und mit dem ich immer über jede meiner neuen Buchideen reden kann.
Ich hab euch lieb!
Viel Spaß beim Lesen!
Playlist
Let’s go to Hell – Tai Verdes
Love and War – Fleurie
L’amour – Karim Ouellet
Blood Runs Red – Matt Maeson
You Can Run – Adam Jones
Work Song – Hozier
Tous les mêmes – Stromae
Blood // Water – grandson
bad guy – Billie Eilish
Human – Wrest
Elle ne t’aime pas – La Femme
Run With Me – Watt White, Loch
Dead Boys – Sam Fender
Angel Of Small Death & The Codeine Scene Hozier
Lost – Dermot Kennedy
Flesh & Blood – Ed Prosek
Shiver – Keir
Free Animal – Foreign Air
Glory – The Score
Colourblind – Feelds
Villain – Lucy Dye
Will We Talk? – Sam Fender
1. Kapitel
Bevor ich mir überlegen muss, wie ich Leon davon abhalte, jetzt vor mir auf die Knie zu gehen, erklingt der Alarm auf meinem Handy. Am liebsten hätte ich erleichtert geseufzt. Ein Heiratsantrag hätte mir wirklich gehörig den Abend versaut.
Ich ziehe mein Handy aus meiner Tasche und sehe das, worauf ich gehofft habe: Vampir beim Kaufhaus Lafayette gesichtet.
»Wir müssen los«, sage ich und erhebe mich von meinem Stuhl. Leon hat sich noch nicht bewegt, sondern starrt enttäuscht auf seine Sektflöte, als wäre sie an allem schuld. Bevor er sich trotz Ablenkung zu einem spontanen Antrag hinreißen lässt, werfe ich ein paar Geldscheine auf den Tisch und steuere auf den Ausgang des Restaurants zu.
Wenn mich jemand fragen würde, ob ich lieber bei Kerzenlicht irgendein überteuertes Gericht esse oder auf Vampirjagd gehe, wäre meine Antwort klar.
Ich trete auf die Straße, öffne meine Handtasche und hole einen Holzpfahl heraus.
»Du hast Waffen in deiner Tasche?«, fragt Leon, sobald er neben mir steht. Das sollte ihn doch eigentlich nicht mehr überraschen. Heute ist unser Jahrestag. Wir sind seit vier Jahren zusammen und kennen uns, seitdem wir Kinder waren. Ich habe Holzpfähle dabei, egal, wohin ich gehe.
»Du etwa nicht?«, frage ich augenzwinkernd zurück und gebe ihm einen Kuss auf den Mund, bevor ich mich auf den Fahrersitz meines Minis schiebe und den Holzpfahl griffbereit in den Getränkehalter lege. Leon grinst beschwichtigt und setzt sich auf den Beifahrersitz. Er schlägt die Autotür hinter sich zu, und ich gebe sofort Gas.
»So habe ich mir unseren Jahrestag nicht vorgestellt«, sagt er, während ich mein Auto so schnell ich kann, ohne von der Polizei angehalten zu werden, durch die Straßen von Paris lenke.
Ich weiß nicht, was ich darauf erwidern soll. Er hat meine beste Freundin Zoe um Hilfe bei der Auswahl des Rings gebeten. Und sie hat mir schon von seinem Antrag erzählt, bevor sie das Schmuckgeschäft überhaupt betreten hatten. Zoe hat sich die nächsten Tage nicht mehr eingekriegt. Sie ist ständig aufgeregt um mich herumgehüpft. Komischerweise konnte ich ihre Freude nicht teilen.
Zoe liebt Leon. Meine Eltern lieben Leon. Alle meine Freunde lieben Leon. Ich liebe Leon. Glaube ich.
Er ist der zweitbeste Jäger in unserem Alter. Wir teilen dieselben Werte und glauben an dieselbe Sache. Er hat sein Leben der gleichen Mission verschrieben. Wir sind Vampirjäger. Das wird für uns beide immer an erster Stelle stehen.
Ich sollte also enttäuscht sein, dass dieser Abend beendet wurde, bevor er fragen konnte, ob ich ihn heiraten will. Doch ich bin erleichtert. Denn ich hätte Nein gesagt. Ich bin zwanzig Jahre alt. Ich bin noch nicht bereit zu heiraten.
Erst jetzt fällt mir auf, dass ich nicht auf seine Aussage reagiert habe. Aber Leon scheint nicht beleidigt zu sein. Er glaubt vermutlich, dass ich in Gedanken bereits bei unserem bevorstehenden Einsatz bin. Das sollte ich sein. Aber ich kann die Anwesenheit des protzigen Verlobungsrings quasi körperlich spüren. Und das, obwohl ich ihn nicht mal sehen kann.
Wir erreichen das Kaufhaus Lafayette, und ich stelle den Motor ab. Leon und ich machen uns schweigend fertig. Sobald ich den Kofferraum öffne und meine hohen Schuhe hineinwerfe, verschwinden alle anderen Gedanken, die mich heute Abend beschäftigt haben, und ich werde vollkommen ruhig. So ist es vor jedem Einsatz. Leon nennt es die Ruhe vor dem Sturm.
Ich schlüpfe aus meinem Seidenkleid und hinein in meine Kampfmontur. Ich habe immer zwei im Auto. Leon nimmt sich die andere. Der schwarze Stoff ist fest und dick genug, dass Zähne sie nicht durchdringen können. Nicht einmal sehr spitze. Das Material schmiegt sich an meinen Körper wie eine zweite Haut. Leon zieht meinen Reißverschluss am Rücken hoch und ich tue das Gleiche bei ihm. Die Montur reicht bis zu den Fußknöcheln, zu den Handgelenken und ist auch am Hals hochgeschlossen, damit wenig Haut ungeschützt ist, sie liegt eng an und scheint mich ein bisschen zusammenzudrücken. Aber dieser Druck gibt mir Sicherheit.
Schnell steige ich in meine schwarzen Lederstiefel. Sie gehen mir fast bis zu den Knien, sind gleichzeitig robust und doch nicht zu schwer. Außerdem kann man in ihnen Waffen verstauen. Zwei Holzpfähle stecke ich mir in meine Stiefel, zwei weitere reiche ich Leon. Zusätzlich nehmen wir noch die Waffengürtel aus dem Kofferraum und schnallen sie uns um.
Wir sind ausgerüstet. Nur meine Armbrust vermisse ich. Sie musste neu aufgespannt werden, weil sie nicht mehr verlässlich geschossen hat. Das ist mein erster Einsatz ohne sie. Fast alle Vampire, die ich getötet habe, habe ich mit meiner Armbrust erledigt.
Aber auch mit den Holzpfählen bin ich geschickt und treffsicher. Dass ich meine Armbrust jetzt vermisse, liegt vor allem daran, dass ihre Abwesenheit mein Ritual vor einem Einsatz stört. Ich benehme mich schon wie ein Sportler, der nicht ohne seine Glückssocke aufs Spielfeld gehen kann.
Ich schließe den Kofferraum und der Knall verscheucht alle unnötigen Gedanken aus meinem Kopf.
Schnell schreibe ich meinem Vater eine Nachricht: Sind angekommen. Dann stelle ich mein Handy auf lautlos und stecke es in meine Brusttasche. Sollte etwas schiefgehen, habe ich es griffbereit, um die Zentrale zu verständigen.
Leon und ich nicken uns zu und setzen uns in Bewegung. Es ist bereits dunkel. Die Straßenlaternen spenden Licht, aber nicht einmal Schatten bewegen sich vor uns auf der Straße. In der Ferne rauschen Autos durch die Nacht. Sonst ist es bis auf unsere Schritte und unseren Atem still. Sofort fühle ich ein nervöses Prickeln auf meiner Haut. In Paris mag zwar die Sonne untergehen, doch die Stadt selbst schläft niemals.
Wir erreichen die Eingangstüren von Lafayette. Unter dem Druck meiner Hand schwingt das Glas nach innen. Sie wurde aufgebrochen. Leon und ich wechseln einen Blick, dann schiebe ich mich als Erste hinein in den Eingangsbereich, der tagsüber von Touristen überrannt wird. Jetzt - verlassen und dunkel - wirken die Verkaufstheken und Glasvitrinen wie verfallene Häuser in einer Geisterstadt. Es ist stockduster. Nur der blasse Schein der Straßenlaternen vor der Tür fällt hinein. Wir können nicht riskieren, uns mit Taschenlampen zu verraten. Also muss das wohl reichen.
Ich gehe vor, Leon folgt mir. Es ist vollkommen still. Selbst unsere Schritte machen kaum Geräusche. Doch ich weiß, dass jemand hier ist. Ich spüre es einfach.
Leon sieht sich genauso aufmerksam um wie ich. Wir halten beide einen Holzpfahl in der einen und eine Holzsplittergranate in der anderen Hand. Doch das Erdgeschoss scheint verwaist. Um sicherzugehen, müssen wir höher. Ich steuere die Rolltreppe an, laufe langsam hinauf und sehe mich um. Das Erdgeschoss ist leer. Wie vermutet. Das bedeutet, der Vampir ist über uns. Meine Kopfhaut kribbelt, als könnte ich seine toten Augen auf mir spüren.
Gründlich gehen wir jedes Stockwerk ab, bevor wir uns das nächste vornehmen. Leon hält sich immer dicht hinter mir und gibt mir Deckung. Wir reden nicht. Aber das ist gar nicht nötig. Kleine Gesten genügen.
Mit jeder Sekunde, die vergeht, ohne dass wir etwas Auffälliges entdecken, steigert sich meine Aufregung. Schweiß rinnt mir in dicken Tropfen den Nacken hinunter. Die Haare auf meinen Unterarmen haben sich vor mehreren Minuten aufgestellt und nicht wieder hingelegt. Irgendwas stimmt nicht. Meine rechte Hand zittert leicht. Sie zittert nie. Irgendwas stimmt hier nicht.
Was sollte ein Vampir in einem verlassenen Kaufhaus wollen? Hier gibt es keine Nahrungsquelle. Weder Blutkonserven noch Menschen ... Außer uns ...
Mein Körper ist gespannt wie eine Bogensehne. Ständig wende ich mich zu allen Seiten um. Doch über mir erkenne ich nur die beeindruckende Glaskuppel, die sich dem Nachthimmel entgegenbiegt. Wenn ich zur Seite sehe, erblicke ich die Balkone, die an verlassene Logenplätze in der Oper erinnern. Aber ich finde keine Hinweise, die auf einen Vampirangriff deuten. Alle Ausstellungsstücke scheinen an ihrem Platz zu sein. Nichts ist umgeworfen, nichts wirkt verändert. Bis auf die Eingangstür.
Wir laufen weiter. Im nächsten Stockwerk stehen Schaufensterpuppen in schicken Kleidern. Die Kleiderständer versperren mir die Sicht. Hier kann man sich gut verstecken. Was ist, wenn er uns schon beobachtet?
Ich umklammere die Granate in meiner Hand noch fester, für den Fall, dass ich sie schnell werfen muss. Auch bei einem Überraschungsangriff treffe ich mein Ziel. Dafür müsste ich allerdings erst einmal wissen, was ich treffen muss. Noch immer höre ich nichts außer meinem und Leons Atem und dem Blut, das in meinen Ohren rauscht. Doch das heißt nichts. Vampire können sich schneller und leiser bewegen als jeder Mensch. Sie sind Dämonen. Das Böse, im Gewand eines menschlichen Körpers. Sie haben ihre Tricks. Ich mustere meinen Waffengürtel. Aber wir haben unsere eigenen.
Und dann höre ich es. Eine Puppe fällt um. Das Klirren auf dem Marmorboden hallt so laut wie ein Pistolenschuss durch das ganze Gebäude. Doch ich zucke nicht zusammen. Ich fahre herum. Leon ebenfalls. Und dann sehe ich spitze Zähne, die im schwachen Licht, das durch die schmuckvollen Fenster dringt, blitzen. Ohne zu zögern, werfe ich die Granate, ehe Leon und ich uns flach auf den Boden fallen lassen. Sie geht los. Schmerzensschreie erklingen. Holzsplitter bohren sich in totes Fleisch. Es sind zwei. Und sie rennen in unterschiedliche Richtungen davon.
Fast zeitgleich kommen Leon und ich auf die Füße. Ich gebe ihm ein Zeichen und er nickt. Er rennt rechts herum. Ich links. Sie dürfen nicht entkommen.
Nach der Explosion und den Schreien ist es nun wieder beängstigend still. Als hätte ich mein Gehör verloren, ohne es zu merken.
Auf dem weißen Boden glänzen zwei Blutstropfen wie Blütenblätter auf Schnee. Ich habe das Geschöpf verletzt. Sehr gut. Dann wird es leichter, es zu töten und von seinem Dasein zu erlösen.
Ich schleiche und zwinge mich, flach zu atmen. Es klirrt rechts von mir zwischen zwei Kleiderständern, als sei der Vampir gestolpert. Habe ich sein Bein verletzt? Das würde erklären, warum er so langsam ist. Doch mehr vernehme ich nicht. Keine Kampfgeräusche dringen von der anderen Seite zu mir herüber. Leon hat seinen Vampir auch noch nicht gefunden.
Ich schiebe Leon aus meinen Gedanken, um mich auf das zu konzentrieren, was vor mir liegt. Ein Fehler und ich habe meinen letzten Atemzug getan. Das weiß ich. Und das darf ich niemals vergessen.
Wieder ertönt ein Klirren. Ich folge dem Geräusch. Den Holzpfahl hoch erhoben. Wieder entdecke ich Blutspuren. Diesmal an einem Kleiderbügel. Mein Herz pumpt immer schneller. Trotzdem zwinge ich mich, ruhig weiterzuatmen.
Ich biege um die Ecke. Die Blutstropfen werden größer. Der Vampir muss hier länger gestanden haben. Eine Lache hat sich gebildet. Ich blicke mich um. Doch die Spur endet an dieser Stelle. Kein weiterer Tropfen verrät die Richtung, in die er verschwunden ist. Der Weg endet hier.
Als ich realisiere, was das bedeutet, ist es zu spät. Ein Schatten stürzt von der Decke auf mich herunter und ein schwerer Körper reißt mich mit sich zu Boden. Ich schlage hart auf. Der Holzpfahl rutscht mir aus der Hand, weil ich meinen Kopf vor dem Aufprall schütze. Mein einziger Trost ist, dass der Vampir einen schmerzverzerrteren Laut ausstößt als ich selbst.
Ich lasse mir keine Zeit, mich vom Sturz zu erholen, sondern springe sofort auf die Beine. Mein rechter Knöchel schmerzt, doch ich ignoriere es. Und sobald ich meinem Gegner entgegensehe, erstickt das Adrenalin sowieso alle anderen Empfindungen.
Zwei Meter von mir entfernt steht er. Groß gebaut, jung und agil, sieht er aus wie ein Mensch, obwohl er das nicht mehr ist. Man erkennt es an den Augen. Bevor die Seele diesen Körper verlassen hat, bevor der Mensch, der einst darin gesteckt und dessen Herz einst geschlagen hat, gestorben ist, sind seine Augen vermutlich von einem gewöhnlichen Blau gewesen. Nun leuchten sie wie zwei Saphire, in denen sich die Strahlen der Laternen brechen wie in einem Prisma. Sie wirken lebendig. Doch das täuscht. Die Augen sind genauso tot wie der Körper, der sich vor mir aufgebaut hat, bereit, sich auf mich zu stürzen.
Er hat eine bedrohliche, kampfbereite Haltung eingenommen. Aber er ist verletzt. Splitter haben sich in seine Beine gebohrt, einige sogar in seinen Hals. Sie verhindern, dass die Wunden heilen. Noch immer sickert Blut heraus. Wie hat er es trotz der Verletzungen geschafft, an die Decke zu springen und mich von da zu überfallen?
Ich bewege mich nicht. Ich bleibe ganz ruhig stehen und schätze meinen Gegner ab. Auf den ersten Blick würde ich ihn auf Anfang zwanzig schätzen - etwa mein Alter. Doch vermutlich hätte dieser Körper schon vor Hunderten von Jahren zu seiner letzten Ruhe gelegt werden sollen. Das werde ich heute nachholen. Diese tote Hülle wird die Beerdigung bekommen, die sie verdient hat.
»Willst du da nur nutzlos in der Gegend rumstehen, Vampirjägerin?«, fragt er auf einmal spöttisch, und ich zucke zusammen. Ich habe sie noch nie zuvor sprechen hören.
Ein Grinsen verzieht sein Gesicht. So schelmisch. So selbstsicher. So menschlich. Beinahe als wäre der Mensch nicht während seiner Verwandlung zum Vampir gestorben. Als wäre er noch dort.
Nur eine Täuschung, erinnere ich mich. Eine böse Täuschung, um mich aus dem Konzept zu bringen. Damit ich denke, ich würde einen Menschen töten, und zögere. Doch das tue ich nicht. Das ist nicht mein erster Kampf mit einem Vampir. Ich weiß, was ich zu tun habe.
Dennoch bleibe ich stehen. Genauso wie er.
Er nimmt seine Hand aus der Hosentasche seiner Jeans und fährt sich durch das pechschwarze Haar. Ich schlucke. Warum greift er mich nicht an? Hätte ich meine Armbrust, hätte ich ihn schon längst erschossen. Doch um ihn mit dem Holzpfahl zu töten, muss er nah vor mir stehen. Für einen direkten Angriff bin ich zu langsam. Die übernatürliche Schnelligkeit dieser Monster verschafft ihm einen Vorteil. Ich habe nur eine Chance gegen ihn, wenn er sich mir nähert. Doch das tut er nicht.
Ich behalte seine Hand im Blick. Sie fährt zum Hals und zieht zwei Splitter heraus. Dabei verzieht der Vampir vor Schmerz das Gesicht. Die spitzen Zähne blitzen zwischen seinen vollen Lippen auf. Als wollten sie ankündigen, dass sie sich gleich in meine Halsschlagader bohren werden. Und diese pocht so heftig von innen gegen meine Haut, als wollte sie das Gleiche.
»Hat es dir bei meinem Anblick die Sprache verschlagen?«, fragt mich das Monster, das nicht wie eines aussieht. Ich sage nichts. Weil das tatsächlich der Fall ist.
Ein Knall ertönt von der anderen Seite der Galerie. Er ist ohrenbetäubend laut. Darauf folgt ein Schrei. Gegenstände poltern zu Boden. Ein weiterer Schrei erklingt. Es ist ein Todesschrei. Leon hat seine Aufgabe erfüllt.
Das Monster sieht sich um, wendet mir den Rücken zu - und genau das ist sein Fehler. Ich nutze die Ablenkung, greife mir einen Holzpfahl aus meinem Stiefel und renne auf ihn zu. Er schafft es nicht mehr, sich rechtzeitig umzudrehen. Ich bohre ihm den Pfahl in den Rücken und er schreit auf. Doch er wehrt sich. Sein Herz habe ich verfehlt. Er geht zum Gegenangriff über, getrieben von seinem Schmerz. Eigentlich sind Vampire viel stärker als Menschen, aber er ist geschwächt. Seine Beine sind verletzt und jetzt auch sein Rücken. Er versucht, mich zu packen, doch ich bin schneller. Mit meinem rechten Bein ziehe ich ihm seine unter dem Körper weg und er landet rücklings auf dem Boden. Der Pfahl bohrt sich noch tiefer in das tote Fleisch, erreicht aber das Herz nicht.
Ich beuge mich über ihn und habe schon den nächsten Pfahl in der Hand, bereit, zuzuschlagen und seine Existenz zu beenden. Ich lasse die Waffe niedersausen, doch zwei große, sehnige Hände fangen den Pfahl im letzten Moment ab. Die Spitze zeigt direkt auf sein Herz, hat aber nur die erste Hautschicht durchdrungen. Ich stemme mich mit meinem ganzen Gewicht auf die Waffe. Der Vampir wehrt sich. Aber mit jeder Bewegung bohrt er sich den Pfahl in seinem Rücken tiefer in sein Fleisch. Seine Kräfte schwinden. Es fehlt nicht mehr viel. Ich kann ihn überwältigen. Doch ich zögere. Denn auf einmal spricht er wieder.
»Ihr habt sie umgebracht«, entfährt es ihm, während ihm Tränen über die Wangen rinnen. »Ihr habt sie umgebracht!« So viel Wut und Hass steckt in seinen Worten, doch in seinen Augen ist nichts davon zu sehen. Nur Trauer, die in seinen blauen Iriden ertrinkt. Ich bin so erstaunt, dass ich den Druck auf den Pfahl kurz verringere.
Das Monster schnappt nach vorne, ein stechender Schmerz fährt mir ins Handgelenk, die Waffe fällt mir aus der Hand. Bevor sie auf dem Boden aufkommt, ist mein Gegner auch schon verschwunden. So spurlos, als wäre das niemals passiert.
Ich blicke auf mein wild pochendes Handgelenk und sauge scharf die Luft ein. Mir wird warm und kalt zugleich, als die Realität auf mich einstürzt. Mein Herz pumpt noch schneller. Es scheint all das Leben vorholen zu wollen, das ich niemals haben werde.
Ich starre auf die Innenseite meines Handgelenks. Die Haut ist an dieser Stelle so dünn, dass meine blauen Venen hindurchscheinen. Doch nicht das hält meinen Blick gefangen, sondern die beiden Punkte, aus denen langsam mein Blut tropft. Sie sehen unscheinbar aus. Fast schon harmlos. Doch das sind sie nicht. Panik droht mich zu übermannen. Ich weiß, was das bedeutet.
Auf meinem Handgelenk. Ein Biss. Mein besiegeltes Schicksal.
2. Kapitel
Ich höre schnelle Schritte. Sie kommen näher. Hastig schiebe ich meine Ärmel herunter und verberge die Bissspuren unter dem dicken Stoff. Unbeholfen komme ich auf die Beine. Sie zittern stärker als nach jedem Training und jeder Verfolgungsjagd. Ein kräftiger Windstoß würde schon reichen, um mich vornüberfallen zu lassen.
»Lana!«, ruft Leon aufgeregt und taucht zwischen zwei Kleiderständern auf. Er ist unverletzt. Das erkenne ich an seinem beschwingten Gang und dem unbekümmerten Gesichtsausdruck. Ich zwinge mich, beides nachzuahmen. »Alles gut?«
»Alles gut«, wiederhole ich. Der Biss scheint beim Klang dieser Lüge protestierend zu pochen.
»Hast du ihn erwischt?«, fragt mich Leon und blickt sich auf der Suche nach einer Leiche um. Überrascht sieht er mich an. Ich scheitere nie. Bis heute.
»Er ist mir entwischt«, sage ich und versuche, unbekümmert zu klingen. »Ihn hatten nicht genug Splitter getroffen. Er war immer noch zu schnell.«
Leon grinst selbstgefällig. »Vielleicht bin ich ja nicht mehr nur der zweitbeste Jäger unseres Alters, wenn ich einen Vampir mehr erledigen konnte als die berüchtigte Lana Delacroix.«
Ich zwinge mich, verschlagen zu grinsen, weil es das ist, was ich unter normalen Umständen tun würde. Leon darf nicht merken, dass etwas nicht stimmt. Niemand darf das. Also sage ich in einem für mich typischen, leicht gelangweilten Tonfall: »Träum weiter. Das war ein Glückstreffer. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.«
Leon grinst breit und gibt mir einen Kuss. Ich versteife mich automatisch, zum Glück merkt er es nicht.
»Verständige die Zentrale. Die Leiche muss fortgeschafft werden.«
Ich nicke und wende mich von ihm ab, damit er nicht sieht, dass meine Hände zittern, während ich mein Handy aus meiner Brusttasche ziehe. Irgendwie schaffe ich es, meinen Vater anzurufen.
»Lana?«, fragt er. »Alles gut gelaufen?«
François Delacroix, der Leiter der Zentrale, fragt immer zuerst nach der Mission und erst danach, wie es uns geht. So ist er eben. Ich habe schon vor Jahren aufgehört, mich deswegen schlecht zu fühlen.
»Es war nicht nur ein Vampir, sondern zwei. Einen hat Leon erledigt. Der andere ist verletzt entkommen.«
Unzufriedenes Grummeln von der anderen Seite der Leitung.
»Geht es euch beiden gut?« Erst jetzt kommt die Frage.
»Ja, beide unverletzt«, lüge ich.
Äußerlich sehe ich vielleicht gesund aus, doch ich habe die schlimmste Verletzung erlitten, die es für einen Vampirjäger gibt.
»Sehr gut. Wir schicken eine Reinigungstruppe. Die kümmert sich um den Rest.«
Die meisten Jäger gehen auf die Jagd nach Vampiren. Aber einige von uns übernehmen auch die wichtige Aufgabe, unsere Existenz und die unserer Feinde vor dem Rest der Menschheit geheim zu halten. Dazu gehören neben dem Einsatz von Bestechungsgeldern auch weniger schöne Methoden wie die Beseitigung unliebsamer Überreste. Ich bin gerade sehr froh, dass ich mich darum nicht kümmern muss. Meine Finger zittern fast zu stark, um das Handy festzuhalten, geschweige denn einen Leichnam.
»Danke«, antworte ich einen Hauch zu spät und lege auf. Mein Vater und ich haben uns noch nie viel aus Begrüßungsoder Abschiedsformeln gemacht. Dafür nehmen wir uns keine Zeit. Wir kommen immer direkt zum Punkt. Dass wir uns nicht immer gut verstehen, liegt nicht daran, dass wir zu unterschiedlich sind, sondern zu ähnlich.
»Wir können zurückfahren«, teile ich Leon mit.
»Na dann los«, sagt er, noch ganz beschwingt vom Adrenalin und der Freude über seinen Triumph. Ich ringe mir ein Lächeln ab und folge ihm. Nur mit aller Kraft kann ich verhindern, dass ich unter der Erkenntnis, die über mir schwebt, zusammenklappe. Mein Herz schlägt noch. Es leugnet etwas, was mein Kopf längst verstanden hat: Ich bin bereits tot.
Die ganze Autofahrt über schildert mir Leon, wie er die Vampirin ausgeschaltet hat. Doch ich höre ihm kaum zu. Noch immer hallen die traurigen Schreie des Vampirs, den ich nicht habe töten können, in meinem Kopf nach, begleitet vom Pochen der Wunde an meinem Handgelenk.
Leon sitzt am Steuer, weil ich ihn darum gebeten habe. Ich könnte gerade keine zwei Meter fahren, ohne einen Unfall zu bauen.
Wir erreichen die Zentrale viel zu schnell für meinen Geschmack. Ich bin noch nicht bereit. Leon ist zu aufgekratzt, um zu merken, dass etwas nicht stimmt. Er fährt sich immer wieder mit der rechten Hand über seine kurzen, blonden Haare, durch die sich nun dunkle Streifen getrockneten Blutes ziehen. Rote Flussadern in einer Wüste. Der Anblick bereitet mir Übelkeit.
Der Motor erstirbt, genauso wie Leons Stimme. Er steigt aus, ich tue es ihm gleich. Ich bewege mich so mechanisch wie ein aufgezogenes Kinderspielzeug, während nur noch ein Gedanke durch meinen Kopf kreist: Irgendwie muss ich es schaffen, in mein Zimmer zu gelangen, bevor jemand den Biss entdeckt.
Ich belaste meinen rechten Knöchel, obwohl es schmerzt. Leon darf nicht merken, dass ich verletzt bin. Er würde mich ins Krankenzimmer schicken, wo ich mich einer gründlichen Untersuchung unterziehen müsste. Das ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Also ertrage ich den stechenden Schmerz, der durch meinen Körper fährt, sobald ich auftrete. Der Schmerz gefällt mir sogar. Er zeigt mir, dass meine Verletzung noch da ist. Er zeigt mir, dass ich noch ein Mensch bin.
Leon tritt vor mir ins Haus und hält mir die Tür auf.
Alles sieht aus wie immer und doch wirkt alles anders.
Mir ist dieses Haus noch nie so altmodisch vorgekommen wie in diesem Moment. Die Wände sind mit dunklem Holz getäfelt und der Boden ist mit alten Teppichen ausgelegt, die jeden Schritt dämpfen. Der Eingangsbereich ist groß genug, dass mehrere Pariser Wohnungen darin Platz finden würden. Direkt gegenüber der Tür prasselt ein Feuer in einem steinernen, massiven Kamin, durch den ein sehr dicker Weihnachtsmann ohne Probleme hineinklettern könnte.
Es ist Anfang September. Draußen ist es auch nachts noch warm. Aber das Feuer brennt immer. Sommer wie Winter. Vielleicht traut sich niemand, es erlöschen zu lassen, weil das Feuer ein Zeichen für unsere Aufgabe ist. Solange es brennt, brennt auch der Hass in unserer Brust.
Die Fenster sind hoch, doch meist hängen dicke Vorhänge davor. Als wären wir ebenfalls Vampire, die sich vor der Sonne schützen müssen. Ohne es zu merken, haben wir uns über die Jahrhunderte unseren Feinden angepasst.
Leon läuft bereits auf meinen Vater zu. Er sitzt in einem großen, braunen Ledersessel am Feuer, auf einem kleinen Tisch neben ihm ruht ein Whiskeyglas. Die Flammen des Kamins spiegeln sich in der bernsteinfarbenen Flüssigkeit und scheinen sie in Brand zu stecken. Dieser Anblick ist mir so vertraut wie mein Spiegelbild. Mein Vater sitzt immer in diesem Sessel, wenn eine Mission läuft und erhebt sich erst, wenn das Einsatzteam zurückgekehrt ist.
Er steht auf, verschränkt die Arme hinter dem Rücken und hört Leon konzentriert zu, während dieser ihm im Detail von unserer Mission berichtet.
François Delacroix kämpft nicht mehr selbst. Bei seiner letzten Mission vor fünfzehn Jahren wurde seine Schulter zertrümmert. Seitdem kann er Holzpfähle nicht mehr sicher genug in der Hand halten.
Er hat es mir nie gesagt, aber ich weiß trotzdem, dass das der schlimmste Moment seines Lebens war. Die Erkenntnis, niemals wieder einen Vampir umbringen zu können, hat ihn sogar schwerer getroffen als der Tod seines kleinen Bruders, der bei einer Mission ums Leben gekommen ist. Und ich glaube, mein Vater hat immer gehofft, dass er genauso gehen würde. Ein ehrenhafter Tod für ein ehrenhaftes Leben - das sagt er immer, wenn es um seinen Bruder geht. Doch ich weiß, dass er in erster Linie von sich selbst spricht.
Der Biss juckt noch stärker.
Mein Vater kennt keine Gnade. Sie wurde ihm nicht beigebracht. Was wird er erst tun, wenn er von meiner Verletzung erfährt?
Ich schlucke schwer, reiße mich dann aber zusammen und setze ein ungezwungenes Lächeln auf. Mit durchgedrückten Schultern laufe ich zum Kamin hinüber und gebe meinem Vater einen kurzen Kuss auf die Wange. So begrüße ich ihn immer nach einer geglückten Mission. Und er schenkt mir dafür immer ein mildes Lächeln, das mir mitteilt, dass er froh ist, dass ich noch atme. Auch wenn er keine Zeit hat, solche Sentimentalitäten laut auszusprechen.
»Ein aufregender Abend«, sagt er und wirft einen kurzen Blick auf meine Hand. Genauer gesagt auf meinen Ringfinger. Leon hat meinen Vater bestimmt um Erlaubnis gefragt, ob er mir einen Antrag machen darf. Wie man es schon vor Jahrhunderten getan hat. Denn Traditionen sterben in unseren Kreisen niemals aus. Sie sind unsterblich. Genauso wie unsere Feinde.
Mein Vater geht nicht weiter darauf ein.
»Du siehst müde aus.« So was sagt er nur selten zu mir. Sein Blick verändert sich sogar, bis er fast besorgt wirkt. Das bedeutet, dass mir mein ungezwungenes Lächeln nicht so gut gelungen ist, wie es hätte sollen.
»Ja, ich fühle mich schon seit ein paar Tagen ein bisschen erkältet«, lüge ich. »Ich muss einfach mal ausschlafen.«
»Dann tu das. Das hast du dir verdient.« Ich habe schon mit Vorwürfen gerechnet, weil ich bei unserem Einsatz einen Vampir habe entkommen lassen, doch mein Vater scheint heute Abend guter Stimmung zu sein.
»Das hast du mir gar nicht erzählt«, sagt Leon vorwurfsvoll. Wir sind zwar Vampirjäger, was so ziemlich der gefährlichste Beruf auf der Welt sein muss, aber er macht sich schon Sorgen um mich, wenn ich mir nur einen Holzsplitter in den Finger jage. Normalerweise finde ich das charmant. Gerade will ich aber nur allein sein.
»Ich wollte nicht, dass du dich sorgst«, sage ich und lächle sanft. »Jetzt sollte ich wirklich schlafen.« Ich küsse ihn kurz auf die Wange.
Er nimmt mich noch in den Arm und flüstert mir ins Ohr: »Wir werden den Abend nachholen. Versprochen.«
Das befürchte ich, denke ich, verkneife mir aber, es auszusprechen, verabschiede mich von Leon und meinem Vater und mache mich schnellen Schrittes auf den Weg zu meinem Zimmer. Mein Knöchel tut immer noch weh. Das ist ein gutes Zeichen.
Schon von Weitem sehe ich Zoes schwarzen Haarschopf um eine Ecke huschen und beschleunige meine Schritte. Sie darf mich nicht entdecken, sonst will sie die ganze Nacht lang über das reden, was heute Abend nicht passiert ist. Und das kann ich nicht. Ich muss allein sein. Ganz allein.
Die Gänge sind länger und verwinkelter als heute Morgen noch, da bin ich mir gerade sicher. Das erste Mal in meinem Leben fällt mir auf, an wie vielen Gemälden meiner toten Verwandten ich vorbeigehen muss, um zu meinem Zimmer zu gelangen. Das ganze 17. und 18. Jahrhundert der Familie Delacroix zieht an mir vorbei. Die Porträts zeigen erhabene Männer, die alle die gleiche Haltung und den gleichen Gesichtsausdruck wie mein Vater tragen. Als wäre in all diesen Jahrhunderten immer und immer wieder dieselbe Person zur Welt gekommen.
Mein Vater war der erste Delacroix, der nur ein Kind bekommen hat. Der Einzige, der keinen männlichen Erben zeugen konnte. Doch meinen Vater schien das nie gestört zu haben. Ich bin seine Erbin und bei meiner offiziellen Ernennung zu seiner Nachfolgerin hat er mich voller Stolz in den Augen angesehen. Es hat für ihn keinen Unterschied gemacht, dass ich ein Mädchen bin, weil ich besser gekämpft habe als alle Jungen in meinem Alter. Weil ich härter und verbissener gearbeitet habe. Weil ich alle unsere Traditionen geehrt habe. Bis jetzt.
Endlich erreiche ich die alte Holztür, die zu meinem Zimmer führt, reiße sie auf und schlüpfe in Sicherheit. Ich lehne mich mit meinem Rücken gegen die Tür und drehe den Schlüssel im Schloss. Kurz verweile ich in der Dunkelheit und versuche meinen Herzschlag zu beruhigen. Doch es gelingt mir nicht. Ich betätige den Lichtschalter. Mein Zimmer sieht genauso altmodisch aus wie die Gänge, durch die ich gerade gegangen bin. Manchmal fühle ich mich tatsächlich, als wäre ich in einem anderen Jahrhundert geboren worden als die Menschen in der Welt vor meinem Fenster.
Ich gehe ins Bad, schlüpfe aus meinem Anzug und betrachte die Wunde. Es besteht kein Zweifel. Es ist ein Vampirbiss. Zwei Punkte. Einer für jeden Eckzahn, der sich in mein Fleisch gebohrt hat.
Aber ich sehe auch Schrammen auf meiner Haut. Mein Knöchel pocht und als ich ihn aus meinem Stiefel schäle, stelle ich mit Erleichterung fest, dass er geschwollen ist. Wäre ich bereits ein Vampir, würden meine Verletzungen heilen.
Schnell gehe ich in meinem Kopf alle Fakten über Vampirbisse durch, die ich gelernt habe, sobald ich lesen konnte.
Es gibt zwei Arten von Bissen.
Ein Vampir kann seinem Opfer das Blut aussaugen. Dabei kann er den Menschen zwar umbringen, ihn aber nicht verwandeln, weil er zu wenig Gift abgibt. Das reicht gerade dazu aus, dass das Opfer die Begegnung mit dem Vampir vergisst und die verräterischen Bissspuren verheilen.
Ein Vampir kann sein Opfer aber auch beißen, ohne von seinem Blut zu trinken. Dabei schießt das Gift durch seine Zähne in den Blutkreislauf des Menschen und macht diesen zu einem von ihnen. Der Biss wird dann niemals verblassen.
»Anzeichen für eine einsetzende Verwandlung«, flüstere ich meinem Spiegelbild entgegen. »Frische Wunden heilen, gesteigerte Lichtempfindlichkeit, Brennen der Haut im Sonnenlicht, unbändiger Hunger.«
Meine Wunden sind noch da. Das Licht ist zwar ein bisschen zu hell, aber das liegt an der Glühbirne und nicht an meinen Augen. Die Sonne scheint nicht, also kann ich den dritten Punkt nicht überprüfen. Und ich habe zwar Hunger, aber ich habe nach jedem Einsatz Hunger. Das heißt nicht, dass ich mich gerade in ein Monster verwandle.
»Genau«, sage ich laut, um die Gedanken zu übertönen, die hektisch durch meinen Kopf zu rennen scheinen. »Genau. Genau. Genau.«
Ich verlasse das Bad und schlüpfe in eine kurze Pyjamahose und ein Top. Steif lege ich mich in mein Bett unter die schwere mitternachtsblaue Decke.
Er hat nur von meinem Blut getrunken. Er hat mir kein Gift verabreicht. Ich bin noch ein Mensch. Ich bin noch ein Mensch. Ich bin noch ein Mensch.
Aber was ist, wenn nicht?
3. Kapitel
Eine Stunde nachdem es mir endlich gelungen ist, einzuschlafen, werde ich durch ein Klopfen an meiner Tür geweckt. Bis in die Morgenstunden lag ich wach in meinem Bett und habe mich wild hin und her gewälzt. Als ich nun die Augen öffne, fühle ich mich furchtbar. Der Kopfschmerz pocht wie ein Hammer gegen meine Schädeldecke. Und das Klopfen hört einfach nicht auf.
»Was?«, rufe ich mit rauer Stimme.
»Ich bin’s, Leon.« Er verstummt kurz. Vermutlich ist ihm die Gereiztheit in meiner Stimme nicht entgangen. »Hast du vergessen, was heute passiert?«
Ich denke nach, doch es will mir nicht einfallen. Erst schüttle ich den Kopf, bis mir klar wird, dass Leon mich nicht sehen kann, weil er immer noch vor meiner verschlossenen Tür steht.
»Anscheinend.«
»Heute ist Camilles Beerdigung. Du hast noch eine halbe Stunde. Ich glaube nicht, dass dein Vater es gutheißen würde, wenn du zu spät kommst.«
Mein Magen fällt. Ich warte nur darauf, dass er polternd auf dem Fußboden aufschlägt.
»Danke fürs Wecken. Ich beeil mich.«
»Sehr gut.« Leon zögert wieder kurz. Ich höre ihn vor der Tür atmen. Wieso atmet er so laut? Es klingt, als stünde er direkt neben meinem Bett. »Geht’s dir heute besser? Brauchst du was?«
»Danke, nein«, rufe ich. »Ich muss mich nur schnell fertig machen.«
»Alles klar.« Wieder zögert er. Er sagt zwar nichts mehr, aber sein Atmen ist unüberhörbar. Bis jetzt ist mir nie aufgefallen, wie viele Geräusche diese Tür durchlässt. »Wir sehen uns gleich.« Endlich entfernt er sich. Seine Schritte werden leiser, bis sie aus meiner Hörweite verschwunden sind.
Ich schiebe mich langsam zur Bettkante. Jeder Muskel in meinem Körper ist erschöpft, und ich fühle mich ausgehungert. Aber es hilft nichts. Schwungvoll stehe ich auf, um meinem Körper vorzugaukeln, dass ich nicht total erledigt bin.
Ich stocke. Bedächtig wippe ich von meinen Fußballen zu den Zehen und wieder zurück. Dann mache ich einige Schritte. Ich hüpfe dreimal. Mein Magen fällt erneut. So rasant wie in einem Freefalltower.
Sofort setze ich mich auf mein Bett und ziehe die Socke an meinem rechten Fuß runter. Mein Atem stockt. Die Schwellung ist fort. Mein Knöchel sieht aus, als wäre er nie verletzt gewesen.
Ich mustere meine Arme. Meine Haut ist glatt und gleichmäßig - makellos. Nicht eine Schramme ist zu sehen. Alle Blessuren des gestrigen Kampfes sind verschwunden. Nur die Bissspuren prangen immer noch gut sichtbar auf meinem Handgelenk.
Das kann nicht sein.
Ich sprinte in mein Bad. Ich brauche mehr Licht. In meinem Schlafzimmer war es wegen der schweren Vorhänge vorm Fenster zu dunkel, deswegen konnte ich die Verletzungen nicht richtig erkennen. Genau. Das wird’s sein, rede ich mir ein. Ich betätige den Lichtschalter und zucke sofort zusammen. Es ist auf einmal so grell in dem kleinen Raum aus weißen Fliesen, dass meine Augen brennen. Schnell lösche ich das Licht wieder.
Ich gehe langsam zurück in mein Schlafzimmer. Auch hier ist keine Lampe erleuchtet. Die Vorhänge sind so dick, dass sie keinen Strahl Sonne durchlassen. Und doch erkenne ich alles so deutlich, als wäre es taghell. Ich sehe mein massives Bett auf dem dunklen Holzgestell, die Bettwäsche, dunkel wie der Nachthimmel, meinen alten Sekretär, an dem ich so gut wie nie sitze, den Kleiderschrank, der immer offen steht, weil ich nie daran denke, ihn zu schließen. Auf den Familienfotos, die an den Wänden hängen, erkenne ich selbst die kleinsten Details jedes einzelnen Gesichts.
Mein Puls rast immer schneller und mein Atem geht abgehackt.
Das kann nicht sein.
Ganz langsam, als würde ich mich einem gefährlichen Tier nähern, laufe ich auf den Vorhang zu, der die gleiche Farbe wie meine Bettwäsche hat. Der samtige Stoff hat sich immer angenehm unter meinen Fingern angefühlt, gerade kratzt er. Ich atme tief durch. Meine Hand zittert. Wieso habe ich plötzlich Angst davor, einen Vorhang zur Seite zu ziehen? Ich kenne die Antwort. Doch ich will sie nicht einmal denken.
»Schluss mit dem Scheiß«, stoße ich aus und ziehe den Vorhang einen Spaltbreit auf. Ein dünner Streifen Sonnenlicht teilt mein Zimmer in zwei Hälften. Ich stehe noch im Schatten. Wo ich mich wohlfühle. Aber ich muss es wissen.
Langsam strecke ich meine Hand aus. Jeden Zentimeter in Richtung Licht muss ich mir hart erkämpfen. Ich spüre deutlich die Wärme an meinen Fingerspitzen, dabei liegt meine Hand noch im Schatten. Das bilde ich mir ein. Das bilde ich mir ein. Das bilde ich mir ein.
Meine Hand hat den Spalt erreicht. Ich tauche meine Fingerspitzen in das Licht, als würde ich damit die Wassertemperatur in einem Pool testen. Tausend kleine Nadeln bohren sich schmerzhaft in meine Haut. Panisch zucke ich zusammen. Auf einmal bestehen die Strahlen der Sonne für mich nur noch aus Splittern. Trotzdem wage ich es erneut. Ich zwinge mich, nicht vorm Schmerz zurückzuzucken. Es brennt. Doch es ist noch erträglich. Meine Haut beginnt nicht zu verbrennen, wie es bei einem Vampir der Fall wäre. Es schmerzt. Aber ich kann es aushalten.
Denke ich zumindest. Bis sich meine Haut so rot färbt, als hätte ich sie auf eine heiße Herdplatte gedrückt. Ich ziehe meine Hand zurück in den Schatten und betrachte meine geschundenen Fingerkuppen. Sie verändern sich. Die Verbrennungen verblassen und sehen nach einigen Sekunden nur noch aus wie ein Sonnenbrand. Ich kann meiner Haut dabei zusehen, wie sie heilt. Zusammen mit der Rötung verschwinden auch die Schmerzen.
Das kann nicht sein.
Ich starre erneut auf die Bissspuren an meinem Handgelenk. Sie müssten verschwunden sein, gemeinsam mit allen Erinnerungen an meinen Kampf mit dem blauäugigen Vampir. Aber sie sind noch da.
Das kann nicht sein.
Ich blicke auf die Uhr auf meinem Nachttisch. Mir bleiben nur noch zehn Minuten. Und wie ich Leon kenne, wird er mich vor meiner Tür abholen.
Wie in Trance schlüpfe ich in meine Kampfmontur. Wir tragen sie wie Soldaten ihre Uniform bei der Beerdigung eines verstorbenen Kameraden. Ich überprüfe mehrmals, dass der Ärmel die Bissspuren an meinem rechten Handgelenk vollständig bedeckt. Die Panik will immer wieder in mir hochkochen, doch ich drücke sie in mein Inneres. Ich muss jetzt zu dieser Beerdigung. Weiter kann ich nicht planen.
Ich stecke meine rotbraunen Haare zu einem strengen Knoten zusammen und werfe einen letzten Blick in den Spiegel. Meine grünen Augen leuchten. Wie Smaragde.
Das kann nicht sein.
Leons Klopfen lässt mich so stark zusammenfahren, dass es mich nicht wundern würde, wenn ich mir dabei etwas gezerrt hätte. Ich atme tief durch und klammere mich an mein Mantra: Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Zittrig entweicht mir die Luft. Es darf einfach nicht sein.
Im Versammlungssaal im ersten Stock der Zentrale sitzen die Pariser Vampirjäger bereits zusammen. Hier finden alle wichtigen Veranstaltungen statt: von Taufen über Hochzeiten bis hin zu Beerdigungen. Ganz vorne vor den hinter Vorhängen verborgenen bodentiefen Fenstern stand ich, als mein Vater mich vor zwei Jahren zu ihrer zukünftigen Anführerin erklärt hat. Diese vier Wände beobachten schon seit Jahrhunderten alle Ereignisse, die das Leben eines Jägers ausmachen. Welche Geschichten sie zu erzählen hätten, wenn sie sprechen könnten ...
Mit diesen Gedanken lenke ich mich ab, während ich in der ersten Reihe zwischen meinem Vater und meiner Mutter sitze. Die Delacroixs sitzen immer hier. Die Anführer der Jäger. Die Mutigsten und Ehrenhaftesten unter ihnen. Zumindest hat das einst gestimmt.
Ich drehe mich kurz um. Leon sitzt mit seinen Eltern zwei und Zoe mit ihren Eltern und Geschwistern vier Reihen hinter mir. Beide lächeln mich an, sobald sie meinen Blick auffangen. Zoe deutet auf ihren Ringfinger und verzieht dann das Gesicht zu einer Schnute. In Zoe-Sprache heißt das so viel wie: Tut mir leid, dass du noch nicht verlobt bist. Aber keine Sorge. Leon holt es nach.
Ich lächle gequält zurück und richte meine Aufmerksamkeit wieder nach vorne.
Auf einer Empore ruht ein geöffneter Sarg, der so gründlich poliert wurde, dass seine schwarze Lackierung leuchtet. Ein Bild von Camille steht daneben. Sie lächelt breit. Das hat sie immer getan. Bis ich alt genug war, selbst zu kämpfen, war sie der Protegé meines Vaters. Wenn ihr Leben nicht so frühzeitig beendet worden wäre, hätte sie den Platz als Vaters Stellvertreterin eingenommen. Sie war gerade einmal achtunddreißig Jahre alt, als sie starb. Ihr Mann Jean sitzt mit leeren Augen neben meinem Vater und starrt nur das Bild seiner Ehefrau an. Ihren Sohn, der noch ein Baby ist, hat er auf dem Arm. Der Kleine zappelt unruhig in den Armen seines Vaters. Er versteht nicht, was vor sich geht - ich wünschte, ich wüsste es auch nicht.
Ich fixiere den Vorhang, als hätte ich Angst, jemand könnte ihn ohne Vorwarnung aufreißen und die Sonne mich treffen. Doch er bleibt geschlossen. Auch auf dem Weg hierher haben die Vorhänge im Flur das Tageslicht von mir ferngehalten. Sie sind meist geschlossen. Die Nachbarn sollen nicht erfahren, was in diesem Gebäude passiert. Da wir unsere eigenen Leute so besser beschützen können, leben die meisten Jäger hier gemeinsam in der Zentrale. Über dem Eingangsportal hängt das Logo einer erfundenen gemeinnützigen Organisation, die sogar eine eigene Website hat, um zu verschleiern, was wir hier wirklich tun.
Leises Tuscheln erfüllt den Saal, bis mein Vater sich von seinem Stuhl erhebt. Sofort wird es still.
»Wir sind heute zusammengekommen«, beginnt er und wendet sich an die rund fünfzig anwesenden Jäger und Jägerinnen, deren Familien sich derselben Aufgabe verschrieben haben wie unsere, »um eine der Unseren zu betrauern. Wir sind gemeinsam aufgewachsen, haben zusammen trainiert und gemeinsam geblutet. Alles für unsere heilige Aufgabe.«
»Von heute bis in alle Ewigkeit«, antworten wir alle unisono.
»Camille hat immer wieder ihren Mut unter Beweis gestellt. Sie hat gekämpft. Wir haben ihr viele Siege zu verdanken und deswegen werden wir ihrer stets gedenken.«
Jeans Schultern beben vor unterdrückten Tränen, doch er weint nicht. Ich kann ihn kaum ansehen.
»Bei einer Mission ist Camille leider einem der Monster der Nacht unterlegen. Sie wurde gebissen, ihr Schicksal besiegelt.«
Mein Vater macht eine auffordernde Geste mit dem ausgestreckten Arm und die Doppeltüren auf der anderen Seite des Raumes öffnen sich. Zwei Männer in Kampfmonturen eskortieren eine Frau in ihrer Mitte.
Die Kälte, die mich bei diesem Anblick erfasst, trifft mich unvorbereitet. Ich kenne das Prozedere. Ich habe diesen Beerdigungen schon als kleines Kind beigewohnt. Es gehört dazu. Doch gerade ertrage ich es kaum.
Camille oder der Körper, der einst Camille gehört hat, läuft den Mittelgang entlang. Sie ist ausgezehrt und wirkt müde, aber sie sieht aus wie Camille. Meine Trainerin. Die Frau, die mich gelehrt hat, eine starke Kriegerin zu werden. Und doch hat sie es nicht geschafft, mich so nobel und ehrenhaft zu erziehen wie sich selbst.
Jean sieht die Hülle seiner Frau nicht einmal an. Doch ihre Augen suchen verzweifelt seinen Blick, während sie in ihren Sarg steigt.
Ich muss hier raus. Ich kann mir das nicht ansehen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht.
Einer der Männer, der Camille eskortiert hat, reicht ihr einen Holzpfahl. Mir ist übel. Ich zittere. Ich muss hier raus.
Doch ich bin wie erstarrt. Camille sitzt in ihrem eigenen Sarg, atmet und bringt nun den Holzpfahl in Stellung, um ihn sich in die Brust zu jagen. Sie weiß, wo ihr Herz liegt. Es wird nicht das erste Herz sein, das sie pfählt. Aber das letzte.
So verlangt es unsere Tradition. Wenn wir gebissen werden, wenn wir drohen uns in einen Vampir zu verwandeln, müssen wir das Einzige tun, was uns dann noch bleibt: uns das Leben nehmen. Wir setzen uns in unseren eigenen Sarg, nehmen einen Pfahl und besiegeln selbst unser Schicksal. So war es schon immer und wird es vermutlich auch immer sein.
Der Biss an meinem Handgelenk pocht wieder stärker. Wenn ich in Camilles Augen sehe, blicke ich direkt in meine Zukunft. Sie wurde vor drei Tagen gebissen. Sie hat es direkt nach ihrer Mission gemeldet und die letzten Tage ihres Lebens im Verlies verbracht. Sie hat das getan, was ihre Erziehung verlangt. Ich bin der Feigling.
Camille sieht das letzte Mal zu ihrem Mann hinüber, er kann ihrem Blick nicht länger ausweichen und die ersten Tränen rinnen seine Wangen hinab. Er weint leise, aber das gedämpfte Geräusch ist noch viel herzzerreißender als ein lauter Schluchzer. Camille lächelt matt, als sie ihren Sohn betrachtet. Er lächelt zurück und streckt die Arme nach ihr aus. Sie ist seine Mutter. Für ihn hat sich daran nichts geändert. Mir wird so übel, dass ich meine Lippen aufeinanderpressen muss, weil ich Angst habe, mich sonst zu übergeben. Camilles Lippen verziehen sich zu einem schmalen Strich. Ihr Sohn muss im selben Raum sein, während seine Mutter sich tötet. Wieso ist mir die Grausamkeit dieser Tradition vor diesem Moment nicht klar gewesen?
Schmerz verzieht Camilles Gesicht, ehe sie sich abwendet und mich anschaut. Ich habe sie in dem Moment für tot erklärt, als sie mit dem Biss am Hals in der Zentrale ankam. Doch sie sieht mich genauso an wie früher. Was ist, wenn Camille noch immer bei uns ist? Was ist, wenn sie gar kein Monster ist? Was ist, wenn wir falschliegen? Was ist ...?
Mein Gedanke wird jäh unterbrochen, als Camille sich den Pfahl in die Brust stößt. Ich habe aufgehört zu atmen. Ich starre sie an. Ihr Mund steht offen, als wäre sie von ihrem eigenen Angriff überrascht. Ihre Hände liegen fest um das Holz. Mehrere Sekunden. Dann erschlafft ihr ganzer Körper. Erst ihre Hände. Sie lassen den Pfahl los, der in ihrem Oberkörper stecken bleibt. Ihr Kopf sackt nach vorne und schließlich bricht sie zusammen.
»Von heute bis in alle Ewigkeit«, sagen alle, doch ich kann meine Lippen nicht dazu bringen, sich zu bewegen. Immer noch starre ich Camille an. Ihre tote Gestalt. Ich bin als Nächste dran.
Und jetzt kann mir auch der Satz »Das kann nicht sein« nicht mehr helfen.
4. Kapitel
Ich verlasse den Raum, sobald ich es kann, ohne unnötig Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ich stolpere fast über meine eigenen Füße - so hastig versuche ich Abstand zwischen mich und Camilles Leiche zu bringen.
»Lana!« Leon läuft mir hinterher und ich kann unmöglich so tun, als hätte ich ihn nicht gehört. Er holt mich ein und sieht besorgt auf mich herunter. »Was ist los?«
Ich kann ihm nicht die Wahrheit sagen. Es tut weh, sich das einzugestehen. Aber ich kann ihm nicht sagen, was mit mir los ist. Er würde niemals unsere Regeln brechen. Nicht einmal für mich.
So habe ich mir Liebe nicht vorgestellt.
»Nichts«, sage ich ausweichend. »Ich fühle mich erkältet. Und Camille und ich standen uns nah.«
»Natürlich. Natürlich. Wie kann ich nur so unsensibel sein?«, stößt Leon aus und zieht mich an sich. »Es muss gerade sehr hart gewesen sein, dich noch mal an ihren Tod erinnern zu müssen.«
Ich schlinge meine Arme um seinen Körper und lehne meinen Kopf an seine Schulter. Kurz fühle ich mich tatsächlich besser. Aber nur für eine Sekunde. Denn dann höre ich es. Wie das Blut durch seine Adern rast. Es klingt wie ein rauschender Fluss. Ein Wasserfall. Ich spüre seinen Herzschlag bis in meine Zehen. Und dann ... ich atme tief durch die Nase ein ... rieche ich es auch noch. Das warme, frische Rot in seinen Adern.
Wie gebannt starre ich auf seine Halsschlagader. Sie pulsiert. Das Blut drückt sich von innen gegen seine Haut, als wollte es zu mir kommen.
Ruckartig löse ich mich von Leon. Er sieht perplex auf mich herab. Doch ich nehme seinen Gesichtsausdruck kaum wahr. Das Blut in seinem Körper lenkt mich von allem anderen ab.
»Sorry«, bringe ich irgendwie hervor. »Ich fühle mich wirklich nicht gut. Ich muss mich hinlegen. Sorry«, krächze ich, drehe mich um und renne davon.
Meine Mutter hat mir schon drei Teller Hühnersuppe gebracht, damit ich so schnell wie möglich wieder gesund werde. Ich habe jeden Teller aufgegessen, doch meinen Hunger konnte ich nicht stillen. Die Suppe scheint ihn sogar angestachelt zu haben. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte.
Schon seit Stunden sitze ich auf meinem Bett, ohne mich zu rühren. Die Beine an meinen Körper gezogen, die Arme um meine Knie geschlungen und mein Kinn darauf abgelegt. So sitze ich da. Mit geschlossenen Vorhängen. In der Dunkelheit, die für mich keine mehr ist. Ich sehe alles viel zu deutlich. Dabei will ich doch nur, dass alles verschwimmt. Wenigstens für einen Moment. Damit ich mein Schicksal vergessen kann.
Ich will nicht sterben.
Dieser Gedanke trifft mich mit einer Heftigkeit, die mich fast umwirft. Ich will nicht sterben. Ich will mich nicht in einen Sarg setzen und mir einen Pfahl in die Brust rammen, während alle Menschen, die ich jemals gekannt habe, zusehen. Allein beim Gedanken daran wird mir so kalt, als wäre ich bereits tot. Vielleicht bin ich das ja auch. So habe ich es gelernt. Sobald man gebissen wurde und sich in einen Vampir verwandelt, stirbt die Seele. Das, was einen Menschen zu einem Menschen macht, vergeht, bis nur der Blutdurst übrig bleibt.
Ich spüre den Hunger. Doch ich bin noch hier. Ich denke und fühle noch. Ich bin immer noch Lana Delacroix. Oder etwa nicht?
Wenn ich das hier überstehen will, brauche ich Antworten. Und es gibt nur einen Ort in diesem Haus, wo ich sie bekommen kann. Steif schiebe ich mich vom Bett. Ich werfe einen Blick zum Fenster. Es ist schon dunkel. Den Tag habe ich zumindest überstanden. Aber wie soll es morgen werden? Ewig werde ich die Fassade nicht aufrechterhalten können.
Vorsichtig lasse ich mein Schloss klicken und trete in den Flur. Ich horche. Niemand rührt sich. Ich kann die anderen in ihren Zimmern gleichmäßig atmen hören. Also setze ich mich in Bewegung. Die Gänge sind leer. Es bleibt ruhig. Bis auf den Wachposten im Aussichtszimmer über der Eingangshalle nutzen wohl alle diese Nacht, um Schlaf nachzuholen. Nur ich kann meine Augen nicht schließen.
Ich tappe durch die Dunkelheit und kann doch alles genau erkennen. Wohin mein Blick auch schweift, überall begegnen mir protzige Möbel, schwere Vorhänge, aufdringliche Teppiche. Erst als ich die Eingangshalle durchschreite und die schwere Tür zum Keller öffne, verändert sich meine Umgebung. Hier starren mir nur graue, kalte Wände entgegen. Sofort spüre ich die Veränderung in der Luft. So viel deutlicher als früher. Jeder Partikel, der in der Luft schwebt, scheint sich auf meine Haut zu legen und dort zu verweilen. Ich spüre die Feuchtigkeit und den Staub, rieche die Verzweiflung, lange bevor ich sie sehe.
Ich war schon oft hier. Das ist alles Teil der Ausbildung. In meiner Familie wird man auch als Kind nicht von den hässlichen Wahrheiten unseres Vermächtnisses verschont.
Die Treppe findet kein Ende, windet sich mehrmals um die Ecke. Ein schmaler Schacht führt immer weiter hinab in die Tiefe. Wenn ich mich umdrehe, sehe ich keinen Ausweg. Doch ich gestatte mir nicht, stehen zu bleiben. Das Pochen in meinem Handgelenk zwingt mich weiterzugehen.
Und dann höre ich es. Seine Emotionen verlassen mit jedem Atemzug seinen Körper. Die Luft wird noch dicker und schmeckt verbrauchter. Hunger, Verzweiflung, Einsamkeit. Wie habe ich das all die Jahre nicht spüren können?
Die letzten Schritte fallen mir schwer, aber auch sie bringe ich hinter mich. Nun stehe ich in einem Gang, der zu allen Seiten hin von kleinen Gefängniszellen gesäumt ist. Obwohl. Als Gefängniszellen kann man sie wohl kaum bezeichnen. Es handelt sich eher um Verschläge.
Alle Zellen sind leer. Bis auf eine.
Ihr Bewohner hat mich bereits entdeckt. Doch er regt sich nicht. Er sitzt still wie eine Statue, und ohne das Blinzeln seiner Lider würde ich glauben, er wäre nicht real.
»Lana Delacroix.« Er flüstert meinen Namen. Seine Stimme ist so leise, dass ich sie kaum hören dürfte, trotzdem zucke ich so heftig zusammen, als hätte er mich angeschrien.
»Woher kennst du meinen Namen?«
Ein leichtes Lächeln verzieht seine eben noch eingefrorene Mimik. Langsam wendet er sich mir zu. Ich kann ihm genau ansehen, dass er nicht aus diesem Jahrhundert stammt. Solche feinen und aristokratischen Gesichtszüge gibt es in unserer Zeit nicht mehr. Seine Nase hat einen Haken, seine Augen sind dunkelbraun, blondes Haar fällt ihm um die Schläfen. Er sieht aus wie dreißig. Doch das täuscht. Wenn man weiß, wonach man zu suchen hat, kann man die Jahre in seiner Iris erkennen. Wie die Kreise in einer Baumrinde.
»Ah, Lana Delacroix. Die Erbin dieser heiligen Hallen.
Welch eine Ehre«, sagt er und breitet die Arme aus, als wäre der Anblick, der sich uns bietet, nicht bedrückend, sondern prächtig. Als wäre der Boden nicht dreckig, die Zellen nicht klein, die Wände nicht karg.
Er sitzt schon seit Monaten hier unten. Trotzdem kann er noch lächeln. Ob eine lange Existenz lehren kann, selbst im Angesicht des Grauens eine entspannte Haltung zu bewahren? »Natürlich weiß ich, wer du bist.« Er fasst mich ins Auge und legt den Kopf schief. Kann er so mehr erkennen? »Du bist nicht hier, um mich zu foltern«, stellt er ganz ruhig fest.
Kurz huscht sein Blick zur großen Tür am Ende des Gangs. Die Schwere und Größe der Metalltür gibt jedem auch ohne Worte deutlich zu verstehen, dass man sie nicht durchschreiten sollte. Ich weiß, was dahinter liegt. Das Laboratorium. Dort finden Experimente statt. An Vampiren. Ich starre die Tür ebenfalls an. Hinter ihr befindet sich der einzige Raum in diesem Haus, zu dem ich keinen Zutritt habe. Mein Vater meint, ich wäre zu jung für das, was mich dahinter erwartet. Und wenn er das sagt, kann ich mich glücklich schätzen, dass ich noch nie einen Fuß über die Schwelle setzen musste.
Mit Gewalt reiße ich meinen Blick los und richte ihn wieder auf den Vampir in der Zelle vor mir. Er scheint schon lange nicht mehr die Tür, sondern mich betrachtet zu haben. Noch immer sind seine Züge nicht feindselig. Nur interessiert.
»Was führt dich zu mir?«, fragt er und lässt die Arme lässig über seine angewinkelten Knie hängen.
»Ich ...«, setze ich an, doch meine Stimme erstirbt. Etwas tief in mir hat mich hierhergetrieben. Auf der Suche nach Antworten, die ich mir nicht selbst geben kann.
»Ich heiße übrigens James«, sagt der Vampir. »Es kommt mir nicht gerecht vor, dass ich deinen Namen kenne und du meinen nicht.«
»James«, wiederhole ich tonlos. Natürlich haben Vampire Namen. Darüber habe ich zuvor nie nachgedacht.
James kneift die Augen zusammen.
»Du bist anders, als ich es mir vorgestellt habe«, sagt er.
»Wie hast du dir mich vorgestellt?«, frage ich automatisch, weil es leichter ist, über alles andere zu reden als das Pochen an meinem Handgelenk.
»Nicht so freundlich«, sagt er. »Feindseliger.«
Früher wäre ich das sicherlich gewesen, doch das spreche ich nicht aus.
»Um zu meiner ersten Frage zurückzukommen«, sagt James und blickt unverwandt zu mir hinauf, direkt in meine Augen und ich kann nicht anders, als zurückzusehen, weil ich mich den seinen nicht entziehen kann. »Was führt dich zu so später Stunde hierher?«
Ich lasse geräuschvoll beim Ausatmen die Luft entweichen und fahre mir mit allen zehn Fingern durch meine leicht welligen, dicken Haare.
Ich bin immer noch verzweifelt am Suchen nach einer Antwort, als James ein überraschtes Geräusch entfährt. Hastig drehe ich mich zur Treppe herum, voller Panik, dass uns jemand entdeckt haben könnte. Doch der Gang ist leer. Und James schaut auch nicht in diese Richtung, sondern in meine. Auf mein rechtes Handgelenk, um genau zu sein. Mein Ärmel ist hochgerutscht und die silbrig glänzende Narbe entblößt.
»Du wurdest gebissen«, stellt James nüchtern fest. »Wann?«
»Vor etwa dreißig Stunden«, sage ich mit matter Stimme.
»Angesichts der Tatsache, dass du vor einer Zelle stehst, statt in einer zu sitzen, schließe ich, dass du niemandem davon erzählt hast.«
»Richtig.«
»Wirst du es melden?«
Ich atme zittrig ein. »Ich weiß es nicht«, antworte ich wahrheitsgemäß.
James wirkt noch immer ruhig, gefasst und verständnisvoll. Sein sanftes Gemüt überrascht mich. Fast so sehr wie das Grinsen und die Tränen in den Augen des Vampirs, der mich gebissen hat.
»Ich verstehe dein Zögern«, sagt James ernst. »Ihr müsst euch selbst das Leben nehmen, bevor die Verwandlung abgeschlossen ist, nicht wahr?«
»Richtig.«
»Barbarisch, wenn du mich fragst.« Er legt den Kopf wieder schief. Ich bin mir nicht sicher, ob er diese Geste überhaupt bewusst macht. »Und trotzdem halten sich alle von euch daran. Die Frau, die bis heute Morgen in der Zelle gegenüber von meiner gesessen hat, wollte mich nicht einmal ansehen, nicht mit mir sprechen. Sie wollte lieber sterben, als wie ich zu sein.« Beim Gedanken an Camilles Blick, bevor sie sich den Pfahl ins Herz gestoßen hat, schmecke ich Galle auf meiner Zunge. »Für sie kam nur der Tod infrage. Für dich scheint das nicht zu gelten.« Seiner Stimme fehlt nach wie vor jedes Zeichen von Feindseligkeit. »Interessant.«
James schweigt eine Weile. Unwillkürlich frage ich mich, was ihn davon abhält, loszuschreien und mein Geheimnis zu verraten. Ich habe die Tür oben offen gelassen, die anderen Jäger könnten seine Schreie hören. Es wäre die perfekte Rache für eine Jägerin wie mich. Es wäre die perfekte Rache für alle anderen Jäger, ihre Erbin in dieser demütigenden Situation zu sehen. Doch er macht keine Anstalten, Derartiges zu tun. Und komischerweise rechne ich auch nicht damit.
»Was passiert jetzt mit mir?«, frage ich mit schwacher Stimme, die mich um Jahre jünger klingen lässt. In jeder anderen Situation hätte ich mich für die Schwäche in jeder Silbe gehasst. Heute fehlt mir die Kraft dazu.
»Die Verwandlung wird nicht mehr lange dauern. Du riechst zwar noch wie ein Mensch. Aber der Geruch von menschlichem Blut ist hartnäckig. Es wird noch mindestens einen Tag dauern, bis er vollständig verflogen ist. Trotzdem bist du jetzt schon mehr Vampir als Mensch«, stellt James fest und schnürt mir mit jedem Wort weiter die Brust zu. »Wunden müssten bereits schnell heilen. Du müsstest inzwischen empfindlich auf Licht reagieren, deine Sinne sollten sich geschärft haben. Deine Augen beginnen bereits zu leuchten. Auch den Hunger dürftest du bereits spüren.« Die letzte Feststellung ist auch eine Frage, deswegen nicke ich kaum merklich. »Hast du Blut zu dir genommen?«
»Nein!« Das erste Mal, seitdem ich diesen Keller betreten habe, ist meine Stimme laut.
James’ Blick ist mitleidig. »Du wirst dich nicht für immer dagegen wehren können. Je länger du wartest, desto schlimmer wird das Verlangen danach.« Er denkt nach. »Heute hat die Sonne vermutlich schon wehgetan, aber noch wird deine Haut der Sonne standhalten, ohne zu verbrennen. Ab morgen wird das nicht mehr der Fall sein. Du kannst das nicht länger verstecken.« Ist das Sorge, die in seiner Stimme mitschwingt? Das bringt mich völlig aus dem Gleichgewicht.
»Willst du mich nicht verraten?«