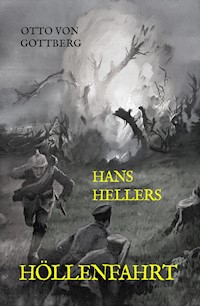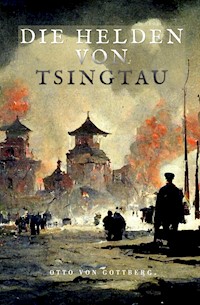Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschland in den Jahren des Ersten Weltkrieges. Der Arzt Geheimrat Professor Dr. Hullmann wird zum einstigen Polizeipräsidenten von Berlin, seine Exzellenz von Drewitz, gerufen, um dessen Gesundheit es schlecht bestellt ist. Im brandenburgischen Trebbin angelangt, wird er Zeuge einer Szene, wie zwei junge Frauen einen jungen Leutnant verabschieden, der zur Front zurückkehrt, und ihm beide auf seine Bitte hin einen Kuss geben. Es stellt sich heraus, dass es sich um die Töchter von Drewitz' handelt, Gerda und Elisabeth, die ihren Vetter Werner verabschiedet haben, in den sie beide verliebt sind. Bei Exzellenz von Drewitz angelangt, sieht der berühmte Arzt schnell, dass es mit dem Alten zu Ende geht, und er gibt ihm den Rat: "Exzellenz v. Drewitz, räumen Sie auf! Bestellen Sie Ihr Haus!" Dazu gehört natürlich auch, die beiden Töchter unter die Haube zu bringen. Doch neben Vetter Werner ist da auch noch Vetter Kurt, der zur Marine gegangen ist und es bis zum tapferen Träger des Ordens Pour le mérite gebracht hat: Der eine kämpft also auf den "blauen Wellen", der andere auf dem "grünen Rasen". Doch so romantisch und heiter sich diese Begriffe anhören, der Krieg ist furchtbar und er fordert seinen grausamen Tribut, was sowohl Elisabeth und Gerda als auch ihre Geliebten erfahren müssen. Am Ende wird es einsam im Anwesen der Drewitz' bei Trebbin ... Ein eindrucksvoller Roman über den Ersten Weltkrieg an der Front und in der Welt der Daheimgebliebenen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Otto von Gottberg
Grüner Rasen, blaue Wellen
Roman
Saga
Grüner Rasen, blaue Wellen
© 1919 Otto von Gottberg
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711570012
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Der Eilzug von Berlin nach Jüterbog jagte mit kaltem Ostwind um die Wette. Herbstzeitlosen blühten im schon welkenden Grün, und das männerleere märkische Flachland schien unter dem schneidenden Wehen in banger Sorge zu schauern. Es war der trübe Herbst des Russenschrecks, den nur das Leuchten des Namens Hindenburg erhellte.
Durch das Abteilfenster sah Hullmann am weissen Schild eines Bahnhofsgebäudes die Aufschrift Grossbeeren. Dem Ziele nahe, nahm er die Depesche aus der Brusttasche seines Überziehers und las wieder:
„Geheimrat Professor Dr. Hullmann, Königin-Augusta-Strasse, Berlin.
Bitte mich zu untersuchen. Wagen mit meinen Töchtern wartet Bahnhof Trebbin morgen, Donnerstag, 11.20 vormittags.
Drewitz-Priedelsdorf.“
Das herrische Telegramm setzte voraus, der meistgesuchte Diagnostiker Deutschlands werde ungesäumt dem Rufe folgen, aber versprach dann mit fast unverständlicher Höflichkeit ein Abholen durch Damen. Zur Fahrt hatte er sich gestern abend entschlossen, weil er neugierig war, Exzellenz v. Drewitz, den einstigen Polizeipräsidenten von Berlin und späteren Minister des Innern, kennenzulernen. —
Bald schrie ein Bremsenkreischen ins Rollen der Räder. Die Wagen verlangsamten ihren Lauf und standen. Ein Schaffner rief „Trebbin!“ Hullmann stieg aus und dachte die vier Gleise zwischen seinem Zug und dem Bahnsteig zu überschreiten. Ein warnendes „Zurücktreten!“ liess ihn stutzen, als er schon das fröhliche Leben vor dem roten Bahnhofsgebäude sah. Mehr als zwanzig Damen lachten und scherzten dort um Berge von Butterbroten, Stapel von Schinken und Würsten, Batterien bunter Limonadeflaschen und Kannen mit warmen Getränken auf weissgedeckten Tischen. Der schneidende Ost zauste meist blonde Haare und peitschte flatternde Röcke um jugendlich schlanke Glieder. Doch mit wehenden weissen Tüchern begrüssten die Jubelnden einen auf dem Strang dicht vor ihnen vom Westen in den Bahnhof rollenden Truppenzug. Aus den Frauenaugen über roten Wangen brannte vaterländische Liebe, die Deutschlands Streitern mit dem Besten aus Küche und Keller, mit Gebet und Segenswunsch gern wohl auch die frischen Lippen geboten hätten.
Der Truppenzug kam vor den hastig zu Tassen, Tellern und Schüsseln Greifenden zum Stehen. Hullmann ging um die Wagenkette auf den Bahnsteig. Auch seine Augen brannten, als todgeweihte Jugend mit siegesfrohem Hurra die grauumhüllten, schon von Marsch und Kampf benagten schlanken Körper weit aus den Wagenfenstern beugte und mit launigem Scherz die Gaben deutscher Schwestern nahm. Dicht vor ihm sprang ein junger Offizier ohne Helm aus dem Zug. Den Staub französischer Landstrassen noch im braunen Stoppelhaar, begrüsste er zwei der jungen Damen ohne Hüte und nahm mit beiden Händen die ihren. Frohbewegt sahen drei von der Natur mit froher Gebelaune beschenkte junge Menschen einander tief in die Augen, und jäh wie prasselnder Feuerüberfall an den Fronten draussen begann hastiges Fragen und Antworten. Feine Mädchenhände haschten nach dem Kreuz an des jungen Kriegers Brust. Seiner Gesichtshaut tiefes Braun unter weisser Stirn dunkelte noch, als er mit stolzem Aufleuchten hellbrauner Augen bekannte, er trage den Schmuck seit den Tagen von Lüttich.
„Warum schriebst du nichts davon? Warum hast du dich nicht angesagt?“
Er lachte: „Wer fände Zeit zum Schreiben oder Telegraphieren? Habe von der französischen Grenze bis Berlin durchgeschlafen!“
Wieder plapperten und scherzten die drei, bis ein Hornruf in das fröhliche Lärmen auf dem kleinen Bahnhof hallte. „Die Herren einsteigen!“ gebot die Stimme des Stabsoffiziers an einem Abteilfenster. Soldaten reichten Flaschen, Tassen, Teller aus den Wagen. Offiziere bei den gedeckten Tischen zogen Notizbücher aus den Taschen und schrieben schnell Adressen hinein. Zum Zug laufend, lachten sie zurück: „Ja, gnädiges Fräulein, Sie bekommen Ihre Karte aus Russland!“ Andre drückten beide Hände der ihnen doch fremden jungen Damen lange und warm. Es war die Zeit, da alle Deutschen Brüder oder Schwestern schienen.
Der junge Offizier ohne Helm hielt wieder die Hände der Mädchen: „Bekomme ich vor dem Einsteigen einen Kuss?“
„Von wem?“ Die vollen roten Lippen der Braunhaarigen hatten gefragt. Ihre bernsteinfarbenen Augen tanzten keck und schelmisch. Ihr Lachen sagte, sie wünsche sich den Kuss. Stumm stand die höhergewachsene ernste Blondine mit lichtblauen Augen und einer Nase, die fast wie jene der Germania auf dem Niederwald jäh aus der Stirnhöhle trat und in reiner, gerader Linie gegen schmale Lippen fiel. Brennendes Rot stieg langsam über ihre lichtweisse Haut vom Hals zur Stirn des Gesichts, das mehr schön als hübsch schien.
Der eben dreist und wagend lachende Offizier gab die Hände der Mädchen frei. Sein unsicher verlegener Blick suchte die Erde vor den Füssen, glitt zweifelnd an den jungen Damen hinauf und von der Braunhaarigen zur Blondine. Er wusste augenscheinlich nicht, welchem Mädchen er den im Übermut geforderten Kuss nehmen solle. Hullmann trat näher und glaubte wie im Theater auf die Lösung einer Verwicklung zu warten. Der Leutnant war wohl beiden Damen nicht nur befreundet, sondern innig zugetan. Welche ihm näher stand, verrieten auch ihre Mienen nicht. Die Blondine schlug die Augen nieder. Ihre schmalen Lippen sanken von der Mitte leicht gegen die Winkel. Das gab dem Mund etwas Herbes oder Kühles. Auf ihrer zarten, weissen Gesichtshaut lag noch Röte, und die Nasenflügel schwangen zu hastigem Atem. Die bernsteinfarbenen Augen der hübscheren Braunhaarigen aber lachten zuversichtlich oder gar wünschend, und Hullmann sah, dass sie dem jungen Offizier ähnele. So wie jetzt sie, sah eben er beim übermütigen Fordern des Kusses aus.
„Drewitz,“ mahnte mit nachsichtigem Vorwurf eine Stimme aus dem Offizierswagen. Der Leutnant drehte die Schultern und wollte zum Zug laufen. Ein schelmisch spöttelnder Blick der bernsteinfarbenen Augen liess ihn zögern und hastig eine Antwort auf die Frage stottern: „Von ... euch ... beiden!“
Die lachende Dunkelhaarige hob ohne Besinnen den Mund. Der Leutnant schien ihn nur flüchtig berühren zu wollen, aber das junge Mädchen warf die rechte Hand um seine Schulter und drückte ihre Lippen fest auf die seinen. Über das kriegsgebräunte Gesicht schoss eine Glutwelle zur lichten Stirn. Wie in jäh auflodernder Leidenschaft presste des Offiziers linke Hand zu einem zweiten Kuss fest die des Mädchens. Dann wendete er sich ab, atmete tief und trat mit gesenkten Augen vor die Blondine. Sie neigte den Kopf, legte die Hände sacht auf seine Achselstücke und streifte mit den kühlen, schmalen Lippen seinen Mund. Es war, als segne Germania einen Streiter für die Fahrt ins Wilde und Heisse unter Hindenburgs Fahnen.
Der Leutnant schied schnell, ohne die Augen zu heben, und lief zum Trittbrett des Offizierswagens. Der Zug rollte schon, als er die Tür zuklappte und sich aus dem Fenster beugte. Seine Hand grüsste, seine Augen brannten. Sein Blick aber suchte weder die Blondine noch die Braunhaarige, sondern irrte unschlüssig zwischen den Mädchenköpfen hindurch. Die jungen Damen schwangen wehende Tücher, bis der Zug ihren Blicken entschwand. Die Augen der Braunhaarigen tanzten durch einen feuchten Schimmer. Die klaren der ernsten Blondine sannen ins Weite. Der Wind zauste ihren flatternden Rock und klatschte das Tuch um die schlanken Glieder einer hochhüftigen Gestalt. —
Hullmann ging um das Bahnhofsgebäude herum. Ein einziger Wagen stand dort. Der Kutscher lüftete mit fragender Miene den Hut. Der Professor sprach ihn an: „Der Priedelsdorfer Wagen?“
„Jawohl, Herr Geheimrat, und hier kommen auch die gnädigen Fräuleins.“
Er drehte sich um. Die Blondine und die Braunhaarige standen vor ihm. „Also Schwestern sind die Damen!“
Es klang gewiss erstaunt oder ungläubig, denn die Braunhaarige scherzte: „Ja, Herr Geheimrat, und Sie wundern sich nicht als erster darüber. Meine Schwester heisst Gerda. Ich bin Elisabeth Drewitz, die jüngere.“
Die Blondine blieb nachdenklich und stumm auch während der Fahrt. Ihre Blauaugen träumten über das Flachland mit Herbstzeitlosen im welkenden Grün. Einmal zuckte der herbe Mund. Neugier liess Hullmann nach dem jungen Offizier fragen.
Gerda konnte also doch lächeln. „Unser Vetter Werner,“ sagte sie, „Sohn eines Generals v. Drewitz, Herr Geheimrat. Brüder zum Hinausschicken haben wir leider nicht.“ Auch über des Vaters Leiden gab sie Auskunft: „Da uns seit der Mobilmachung Leute fehlen, glaubt Papa mit dreiundsiebzig Jahren oft noch zugreifen und ein Beispiel geben zu müssen. Neulich sah ich ihn einem Arbeiter aus der Stadt zeigen, wie er Dung aufladen müsse. Er schleuderte die gefüllte Schaufel hoch über den Kopf auf den Wagen und erblasste plötzlich. Die Forke fiel aus seiner Hand. Er drückte die Faust über der Hüfte gegen den Rücken und ging mit aschfahlem Gesicht schwerfällig ins Haus. Seither spürt er Seitenstiche.“
„Nun sollen Sie helfen, Herr Geheimrat,“ und Elisabeths Hand wies über die im kalten Wehen dampfenden Pferde: „Dort sehen Sie Haus Priedelsdorf am Fuss des Löwendorfer Berges. Die Geographen nennen ihn den westlichsten Ausläufer des uralisch-baltischen Höhenzuges. Ich schätze ihn mehr als gute Rodelbahn. Doch im kommenden Winter verzichten wir auf Sport. Das Versorgen der durchfahrenden Soldaten gibt genug zu tun. Gerda kam natürlich auf den Gedanken, die Verpflegungsstelle einzurichten.“
„Wir hatten ihn gleichzeitig,“ widersprach die Blondine.
Elisabeth legte den Arm um der Grösseren Schulter: „Bewahre, Liebes! Beim Guttun bist du immer die erste! Glauben Sie mir, Herr Geheimrat. Gleich nach der Mobilmachung fuhr sie mit ihrem Spargeld nach Trebbin, kaufte ein und bat um Erlaubnis, die Tische auf den Bahnsteig zu stellen. Später kamen andre Damen aus der Stadt und vom Land zu Hilfe. Heute sind wir mehr als zwanzig Mädels, und Trebbin wetteifert mit der Nachbarschaft, um die Vorräte zu ergänzen. Zehn Speckseiten und achtundfünfzig Schinken hingen gestern in der Schatzkammer. Darum ist unsre Verpflegungsstelle die berühmteste und beliebteste an der Anhalter Bahn. Die Damen in Lichterfelde geben das freilich nicht zu. Um uns zu schlagen, stellten sie neulich sogar kleine Puddings auf ihre Tische. Ich fahre nämlich oft als Spionin die Strecke ab und vergleiche. Dabei sah ich die Leckerbissen, aber ärgerte mich nicht, denn Speck, durch die Maschine gedreht und schön dick auf Landbrot gestrichen, schmeckt besser als Süsses. Meinen Sie nicht?“
Der schmunzelnd Nickende sah auch Gerda lächeln. Ihre Finger schlossen Elisabeths Mund.
Die Braunhaarige lachte vergnügt, sah der Blonden warm in die Augen und schmiegte sich an ihre Schulter. Als anmutiges Bild zärtlichster Schwesternliebe sassen beide, bis der Wagen durch scharfen Geruch aus Viehställen, von regengenässtem Dung und dampfendem Stroh über das holprige Pflaster eines geräumigen Gutshofs rollte. Bald quietschten die Räder auf Sand und standen unter der glasbeschirmten Vorfahrt eines einfachen breiten Herrenhauses mit zwei Stockwerken und vierzehn Vorderfenstern im oberen. Aus dem roten Ziegeldach hob ein kleiner Uhrturm die runde Spitze mit einer Wetterfahne. —
Drinnen erklärte ein erster Blick die Bauanlage des schlichten alten Hauses. Vom Portal in der Mitte der Vordermauer sah Hullmann durch die viereckige Halle bis zur Verandatür in der Hinterwand. Ringsum standen Sessel und in einer Nische zur Rechten die Kleiderhalter.
Nach dem Ablegen führten die Mädchen nach links durch den langen Korridor, der von einer zur andern Seitenmauer das Haus durchschnitt. Von jedem Ende warf ein Fenster Licht herein. Neben dem zur Rechten waren die untersten Stufen einer Holztreppe zum Oberstock zu sehen. Die jungen Damen gingen auf das andre zu, und Gerda öffnete die letzte von drei Türen zu linker Hand. Hullmann bat die Schwestern, voranzugehen, und fand Zeit, in das Zimmer zu blicken. Zwei mit braungelber Seide umrahmte Fenster warfen Licht zunächst auf den schweren Mahagonischreibtisch zwischen den Scheiben. Über die Platte beugte sich mit dem Rücken zur Tür ein breitschultriger Graukopf, den die Mädchen anriefen: „Papa, der Herr Geheimrat! Und denke — wir sprachen Werner auf dem Bahnhof. Sein Regiment geht nach dem Osten.“
Der Aufstehende war noch grösser, als der erste Blick auf seinen breiten Rücken vermuten liess. Des Zurufs der Töchter nicht achtend, kam er mit erhobener Hand dem Besucher näher. Neben ihm tappten zwei riesige Hunde, die, wie der Herr, andre Geschöpfe ihrer Art zu überragen schienen. Zur Linken des Hünen mit dem gewellten Weisshaar über einem wie aus grauem Ton gekneteten bartlosen Gesicht stand beim Handschlag die mächtige dänische Dogge mit glänzendem gelbem Fell und zur Rechten der starke schottische Schäferhund. Keinen Laut gaben die wohlerzogenen Tiere. Nur Funkeln ihrer Augen verriet Neugier und Unwillen. Das eigenartige Bild erinnerte daran, dass schon der Berliner Polizeipräsident v. Drewitz als Freund schöner Hunde galt und stets mit mächtigen Doggen durch die Strassen der Hauptstadt ging. Doch wohl nur für seine Tiere gab der Alte Geld aus. Über seinen sonst kleinlichen Geiz spöttelten die Berliner, während er noch als Minister in der Wilhelmstrasse wohnte.
Jetzt schickte er die Töchter aus dem Zimmer und drückte den Besucher mit freundschaftlichem Auflegen seiner schmalen grossen Hände in einen Ledersessel zur Linken des Schreibtisches. In dem lebensgrossen Ölgemälde einer schönen Frau an der Wand zwischen den Fenstern fand Hullmann die dunklen Haare und braunen Augen der jungen Elisabeth wie des Leutnants auf dem Bahnhof. Auch sonst fiel die verblüffende Ähnlichkeit der drei Gesichter auf. Eine Metallplatte am Rahmen des Bildes trug die Aufschrift: „Elisabeth v. Drewitz geb. v. d. Helle, vom 1. 6. 73 bis 25. 11. 95.“
Doch der Arzt musste seinen Patienten betrachten. Nach ihm schien Gerda, die Germania, geartet. Auch aus seinem alten und harten Gesicht mit leicht hängenden Mundwinkeln sprang eine nur derbere Nase jäh aus der Stirnhöhle und fiel in fast gerader Linie gegen die Oberlippe. Die Hände auf dem Rücken, schwieg er wie in Erwartung von Fragen. Der Geheimrat musste das Gespräch beginnen, während seine Augen sich noch an dem kraftvollen hohen Körper freuten:
„Wenn ich Sie schon gekannt oder gesehen hätte, würde Ihr Ruf mich noch mehr überrascht haben, Exzellenz.“
Um einen Schatten grauer schimmerte das strenge Greisengesicht, denn Hullmanns freimütige Worte erinnerten daran, dass Leidende den grossen Diagnostiker gemeinhin nur riefen, wenn ihr eigner Arzt nicht mehr raten oder helfen konnte. „Mein Hausarzt wollte Ihr Urteil hören, Herr Geheimrat. Mir genügte und bekam seine Verordnung, als er nach dem ersten Anfall zu mehr Bewegung und weniger Nahrung riet.“
Hullmann nickte: „Hungern und schwitzen! Wir Ärzte kennen kein besseres Rezept! Doch worüber fordert der Kollege mein Urteil?“
Die schmalen Hände des noch Stehenden umspannten die Hüften: „Ich spüre in den Seiten stechende Schmerzen, die sich gegen die Wirbelsäule ziehen und wohl auch Ursache einer ungewohnten Müdigkeit und Schlaffheit sind.“
„Wollen Exzellenz den Oberkörper entblössen!“ Der Arzt wies auf das Liegesofa an der Wand und beugte sich bald über den schnell Entkleideten. Der Leib unter seinen Augen war ein Meisterstück der Natur und schien geschaffen, ein Jahrhundert zu überdauern. Doch der Liegende stöhnte unter dem Klopfen der Finger. Widersinnig handelte die Schöpfung, als sie dem prächtigen Körper mit dem Leben auch Fehler gab.
„Bitte sich anzuziehen, Exzellenz!“
Hullmann sass am Schreibtisch nieder und beschrieb zwei Seiten eines Bogens, den er in einem Umschlag barg und dem nähertretenden Kranken reichte: „Für Ihren Hausarzt, Exzellenz. Mehr kann ich leider nicht tun.“
„Und was fehlt mir?“
Des Arztes Augen prüften das harte, graue Gesicht. Durch tiefes Schweigen im Zimmer pochte das Ticken der Wanduhr. Es schien schwer, das Behagen und die Stille im Raum zu stören.
Doch der alte Herr forschte weiter: „Ist Gefahr, dass ...“
Der Professor hob die Hand. Seine Augen blinkten. Der Mund hätte fast gelächelt. Wer durfte in der logischen Abwicklung eines natürlichen Prozesses Gefahr sehen!
„Geht es mit mir zu Ende?“
Der Arzt hob die Schultern: „Auch Exzellenz müssen einmal sterben.“
Das Ticken der Wanduhr ward Hämmern.
„Die Wahrheit, Herr Geheimrat!“
Des Arztes Augen lasen in dem harten Gesicht, der Kranke sei stark genug, sie zu hören. Seine Hand wies über die Schreibtischplatte mit den zerstreuten Papieren eines Vielbeschäftigten: „Exzellenz v. Drewitz, räumen Sie auf! Bestellen Sie Ihr Haus!“
Das scheinbar aus grauem Ton geknetete Gesicht blieb regungslos. Ohne Wimperzucken sahen Augen, blau wie die der blonden Tochter, auf den ein Todesurteil sprechenden Mund. Bald hallte über das hämmernde Ticken der Uhr flüchtiges Räuspern und eine klare Stimme: „Machen Sie uns das Vergnügen, zu Tisch zu bleiben, Herr Geheimrat?“
Der Professor sah auf die Uhr: „Verbindlichsten Dank, Exzellenz, aber wenn der Kutscher schnell fährt, kann ich den Zug 1.32 Uhr nehmen.“ Er stand auf und verabschiedete sich.
Exzellenz v. Drewitz trat mit den Hunden ans Fenster. Die Tiere hoben Köpfe und Pfoten auf das Brett. Seine Finger krauten ihr Nackenhaar. Die Augen sahen durch die Scheibe auf das welke Gelb um die Zweige der alten Ulme im Hofe. Sonst linderte das Bild sanften Blätterspiels Schmerzen und bannte Ärger, denn warm wie seine Kinder und Tiere liebte er Bäume und Blumen. Heute schien ihm der unter seinen Augen gewachsene Baum fremd. Fremd fühlte er sich auch dem eignen Körper. Nach Gutdünken oder Laune hatte er mit ihm beim Vergnügen wie bei der Arbeit geschaltet und Stolz auf die strotzende Kraft der starken Glieder gespürt. Sein Eigentum schien der Leib, und war doch nur eine geborgte Hülle, ein Lehen Gottes, ein Haus, in dem er zur Miete wohnte. Fast glaubte er sich jetzt neben dem eignen Ich. Ohne sein Wollen oder Wissen murmelten die Lippen: „Exzellenz von Drewitz, räumen Sie auf!“
Selten hatte er an den Tod gedacht und nie ihn gefürchtet. Jetzt aber kam der Wunsch zu eben, bis die Zukunft von Vaterland, Haus und Kindern nach Sieg und Frieden wieder gesichert schien. Die Kraft seines Leibes hatte ihn stets überzeugt, er werde die in später Ehe geborenen Töchter noch verheiratet sehen. Unwillkürlich trat er zurück und hob die Augen zum Bild der verstorbenen Frau. Als Polizeipräsident von Berlin hatte er Elisabeth v. d. Helle vor zweiundzwanzig Jahren geheiratet. An den Hochzeitstag mochte er auch heute nicht denken, denn am Morgen des Festes kam Nachricht vom Verschwinden seines jüngeren Bruders mit Irmgard, der Schwester Elisabeths. Alfred hatte auf Wechseln den Namen des Älteren gefälscht, flüchtete nach England und nahm Elisabeths jüngere Schwester mit. Nicht einmal verlobt war das junge Ding dem verächtlich leichtsinnigen Tunichtgut. Niemand ahnte von ihrer Liebe zu ihm. Leidenschaftliche Briefe im Schreibtisch des Mädchens erklärten ihre Flucht. Der Polizeipräsident von Berlin konnte das Geschehnis vertuschen und der Majoratsherr auf Priedelsdorf die Schulden des jüngeren Bruders bezahlen. Langwieriges Ersparen der verausgabten Summen brachte ihm den Ruf eines Geizhalses. Die üble Nachrede hatte er gleichmütig getragen. Doch nach Gram und Ärger des Hochzeitstages kam bald der Schmerz über Elisabeths plötzlichen Tod. Die geliebte junge Frau erwartete vor zwanzig Jahren hier in Priedelsdorf die Geburt ihres zweiten Kindes, als durch Schneetreiben und Sturmwehen eines düsteren Winterabends ein Wagen vorfuhr. Kaspar v. d. Helle, Elisabeths Bruder, brachte den Schrecken, der nach vorzeitiger Geburt der kleinen Elisabeth bei Tagesanbruch der Mutter Leben endete. In der Halle traf der unwillkommene Besucher den zur Jagd in Priedelsdorf weilenden Vetter Fritz Drewitz, den heutigen General, der sofort begriff, dass die Wöchnerin vom Kommen ihres Bruders nicht hören dürfe. Doch ... Elisabeth ging durch die Halle, sah Kaspar und hörte ihn sprechen. Noch immer schrillte in den Ohren der grausige Schrei, der da als letzter von ihren Lippen durch das Haus gellte.
Die Augen brannten. Er nahm den Blick vom Bild an der Wand und trat wieder ans Fenster. Seine Lippen murmelten: „Exzellenz v. Drewitz, bestellen Sie Ihr Haus!“ Es gab viel aufzuräumen.
Klug und grausam schien der Ahn, der einst zwei Söhnen allen Drewitzschen Grundbesitz in den Majoraten Priedelsdorf und Kunzenberg hinterliess. Klug war er, weil seither bis immerhin heute nur Erben seines Namens auf den Gütern sassen. Bald freilich mochten sie der Familie verlorengehen. Aus dem Chaos des Weltkrieges schien das Gespenst einer Revolution das schon siegesgewiss grinsende Antlitz zu recken. Wenn nicht ein Wunder geschah, war bald auch das geliebte alte Preussen eine Republik, denn das Königtum vergass, dass das Buch der Bücher gebot: Du sollst mit deinem Pfunde wuchern! Der Krone Pfund war die Macht. Statt wuchernd sie zu mehren, liess sie sich Lot für Lot des kostbaren Pfundes nehmen. Das Königtum kämpfte nicht mehr, sondern wich vor Angreifern zurück und war darum zum Tod verurteilt wie alles Leben, das nicht rang und kämpfte. Wohl fand die Krone noch willige Helfer und Streiter. Auch er war als Mann wie als Beamter oft für sie in die Bresche getreten, aber heute überzeugt, dass er Zeit und Kraft nutzlos vergeudet hatte. Die Tage des heiss und schwärmerisch geliebten alten Preussenstaates waren gezählt. Das schmerzte mehr als des Geheimrats Todesurteil. Wer ahnte das namenlos bittere Weh im schier zerrissenen Herzen guter Preussen? Sie wollten und mussten in Treue und Ehrfurcht ihren König lieben. Sie taten es auch und grollten ihm doch, weil er sich von Volkstribunen der Väter stolzes Erbe rauben liess. Oft drückten Gram und Schmerz darüber Wasser in die wahrlich ans Weinen nicht gewohnten Augen. Als Kinderloser schiede er gern vom Leben, ehe das neue Geschlecht den rocher de bronce zum alten Eisen warf. Doch die Töchter blieben zurück. Für sie war aufzuräumen.
Auch grausam schien der Ahn, denn wieder einmal durften die Herren beider Majorate als Väter von nur Töchtern ihren Besitz nicht Kindern und Blutserben hinterlassen. Auf Priedelsdorf zog zunächst der kinderlos bejahrte Vetter Karl v. Drewitz und nach ihm ein Neffe Kurt, der Kapitänleutnant, ein. Dem greisen Vetter Hermann v. Drewitz auf Kunzenberg hatte der Krieg beide Söhne genommen. Wenn er starb, gingen auch seine Töchter von der väterlichen Scholle. Doch war er wohlhabend auch durch Heirat mit einer begüterten Frau. Gerda und Elisabeth hatten wenig Vermögen zu erwarten. Neben dem geringen Heiratsgut der Mutter blieben ihnen des Vaters Ersparnisse von zwanzig Jahren. Gern hätte er sie darum vor dem Scheiden verheiratet gewusst.
„Zu Tisch, Papa!“ riefen sie in die Tür. Er zwang sich, heiter zu blicken, und folgte ihnen über den langen Korridor. Die Wand zur Linken trug bis zur Halle nur die eine Tür zum verschlossenen grossen Festsaal. Vor ihr fassten die Töchter des Vaters Arme mit Fragen nach dem Urteil des Arztes. Zärtlich wie selten lächelte er auf ihre Köpfe herab: „Er gibt mir noch Zeit!“
Durch eine Tür gegenüber der Holzstiege zu den Räumen im Oberstock traten sie in das eichengetäfelte Esszimmer mit rundem Tisch. Beim Löffeln der Suppe beruhigte der Vater die Töchter über sein Ergehen. Sie plauderten bald von der Begegnung mit dem Vetter. Die immer gesprächige Elisabeth schilderte mit tanzenden Augen sein gebräuntes Gesicht, das bestaubte Haar, den durchweichten, abgescheuerten Rock. Die sonst stille, ernste Gerda gönnte heute der Schwester nicht das Wort. Tief atmete sie nach langem Erzählen auf: „Männlicher sah Werner aus und trug als einer von wenigen seiner Truppe schon das Eiserne Kreuz!“ Ihre Augen suchten den Teller, und die Stimme sank: „Das war auch zu erwarten.“
Der Vater sah sie scharf an. Die Stirn über dem grauen Gesicht trug tiefere Runzeln als sonst: „Warum?“
Gerdas immer leicht flammende Wangen röteten sich wieder. Vielleicht darum neigte sie den Kopf und sagte bestimmt, aber auch schnell und leise, als heische ihre Behauptung kaum eine Erläuterung: „Das lässt sich fühlen, aber nicht erklären.“
„Doch! Ich kann’s erklären!“ Elisabeths Augen tanzten: „Werner war nie sehr lustig, aber der Erste, Geschickteste und Mutigste schon beim Turnen und Spielen und doch immer bescheiden. Auch heute wartete er auf den Kuss so verlegen oder befangen, als wisse er gar nicht ...“
Sie verstummte, weil der Vater die Gabel niederlegte und ihr ungläubig in die Augen sah: „Geküsst hat er dich, Elisabeth? Junge Damen lassen sich nie küssen.“
Er schlug die Finger auf den Tisch. Seine Worte klangen hart und streng. Dann schwieg er unschlüssig, denn wieder spürte er vor den Kindern das gewohnte Unbehagen der Befangenheit. Er wähnte sich zu alt, um sie wirklich zu verstehen oder ihnen nahezukommen. Gerda sah einen feuchten Schimmer in der erschrockenen Schwester Augen. Sie dachte ihr Teil an Schuld und Scheltworten auf sich zu nehmen und hob den Kopf. Die Augen konnte sie freilich nicht voll aufschlagen, und ihre Stimme war unsicher: „Papa, auch ich habe ihn zum Abschied geküsst“
Wider Erwarten schienen ihre Worte den Vater zu besänftigen. Er sprach freundlicher: „Dann ist es nicht so schlimm, mein Kind! Auch wirst du rot und scheinst dich wenigstens zu schämen!“ Er nickte. Die Küsse von zwei jungen Mädchen durften als nur verwandtschaftliche gelten. Jetzt hätte er den Töchtern gern von ihrer Zukunft und vom Heiraten gesprochen. Als erwachsene Mädchen mussten sie hören, dass Frauen zwar nicht nach Geld heiraten, aber doch Vorsicht im Verkehr mit unbegüterten Männern walten lassen sollten. Das Vermögen des Generalleutnants v. Drewitz war klein und nicht nur seines Sohnes Armut für die Töchter ein Grund, in Werner nie mehr als den Vetter zu sehen. Er räusperte sich wieder, stützte die Armgelenke auf die Tischplatte und den Rücken an die Stuhllehne.
Elisabeths Augen suchten die der Schwester. Wenn Vater es sich am Tisch bequem machte, statt nach der Mahlzeit in sein Arbeitszimmer zu gehen, hielt er gewöhnlich eine Rede. Am liebsten verglich er die alte mit der neuen Zeit. Gegenwart und Jugend schnitten dann schlecht ab, obwohl Gerda oft den Mut fand, zu widersprechen oder zu scherzen, bis der Vater zugab, auch die Jugend habe ein Recht auf eigne Gestaltung ihres Lebens. Die Ältere verstand den Blick und drehte sich nach links zum Vater: „Dürfen wir aufstehen? Es ist Zeit, auf den Bahnhof zu gehen.“
Elisabeth sprang gar schon auf die Füsse und neigte die Lippen zum Kuss auf des Vaters Wange: „Bekommen wir den Wagen?“
Er strich ihr unschlüssig über das braune Haar, denn ungern versagte er den Kindern Wünsche.
Gerda kam ihm zu Hilfe: „Elisabeth, wir müssen bis zum Frieden die Pferde schonen und unsre Räder nehmen!“
Der Vater lächelte: „Gerda, du bleibst mein Musterkind!“ Doch zog er sich Elisabeths Köpfchen näher, um einen Kuss auf ihren Mund zu drücken. Die Ältere streichelte er nur mit den Fingern, während ihre Lippen seine Wange streiften. Gerda wunderte sich nicht. Alle Menschen und Tiere, auch Tyras, die Dänin, und Ajax, der Schotte, schenkten Elisabeth mehr Liebe als ihr. —
Durch das Fenster seines Arbeitszimmers sah der Alte die Töchter aus dem Haus treten und auf ihre Räder steigen. Über den Kleidern trugen sie gestrickte Seidenjacken, die ein Gürtel über den Hüften umschnürte. Die der blonden Gerda war hellblau. Die braunhaarige Elisabeth trug leuchtendes Altgold. Auf beiden Köpfen lagen Zipfelmützchen von Farbe und Gewebe der Jacken. Allerliebst sahen die Kinder aus. Er durfte wohl stolz auf sie sein. Auch hübsch waren beide, aber verschieden, wie von Erscheinung, so auch von Art. Die schon wieder lachend scherzende Elisabeth lag beim Anfahren vornüber und hob bei einem Schwanken des Rades den rechten Arm mit dem durch die Scheiben hallenden Jauchzen eines ausgelassenen Jungen. Gerda sass mit der gemessenen Würde einer Dame auch auf dem abscheulichen Fahrzeug einer neuen Zeit. Da sausten sie aus dem Hof. — —
Auf der Landstrasse drehte Elisabeth den Kopf zur Schwester: „Papa meint es herzlich gut, aber als er jung war, muss das Leben entsetzlich langweilig gewesen sein. Warum sollen wir einen ins Feld gehenden Vetter nicht küssen?“
Gerda sah lange vor sich auf den Weg und fragte dann dringlich: „Hast du wirklich nur den Vetter geküsst?“ Sie drehte den Kopf.
In ihren grossen blauen Augen stand so banges Warten oder Zweifeln, dass Elisabeth ihren Blick mied: „Er ist doch vorläufig nur unser Vetter!“
„Vorläufig, Elisabeth? Das klingt …“
„Nein, nein, Gerdchen!“ Die Jüngere wäre fast mit dem Rade gefallen. Schnell fing sie das Gewicht des Körpers mit dem die Erde stapfenden rechten Fuss auf und stand verwirrt, während die wartende Gerda eine Kurve fuhr.
Endlich sass die Jüngere wieder auf, holte die anfahrende Schwester ein und fragte leise, fast ängstlich: „Gerüchen, glaubst du, wir könnten uns je streiten oder entzweien?“
Gerdas nachdenkliche Augen sahen geradeaus. Langsam, aber entschieden schüttelte sie den Kopf „Nein, Liebes, wir sind uns gut und wollen es bleiben. Nicht wahr?“
Da erst drehte sie wieder den Kopf zur Schwester. Ihre weisse Gesichtshaut flammte bis zum blauen Zipfelmützchen in heisser Röte.
„Gerda Drewitz, wenn du dich so malen lassen könntest! Wunderschön siehst du aus.“
Die Blonde lachte fröhlich: „Aber dich nennen alle die hübschere Schwester!“ —
Auf dem Bahnhof war mehr als sonst zu tun. Wieder rollten Truppenzüge von West nach Ost. Die Mädchen fanden keine Zeit zum Lesen der Berliner Abendblätter, die sie abends nach Gewohnheit dem Vater mitbrachten. Beim Essen las er dann den Generalstabsbericht vor und war wohl ärgerlich, wenn sie ganze Sätze schon auswendig kannten. Als er heute sein Blatt über dem Teller entfaltete, zog er mit einem Freudenruf die Töchter aus ihren Stühlen neben sich. Sein Finger deutete auf die Meldung unter der des Generalquartiermeisters:
„Eins unsrer U-Boote, Kommandant Kapitänleutnant v. Drewitz, versenkte am 3. d. M. im Ärmelmeer den englischen Kreuzer ‚Eagle‘ durch Torpedoschuss.
Der Chef des Admiralstabes.“
Lauter las er nochmals den nun auch schon von den jubelnden Mädchen gesehenen Satz und fragte feierlich, fast ergriffen: „Habt ihr gehört und verstanden?“
Sie bejahten. Wieder las er langsam Wort für Wort und warf dann den Rücken gegen die Stuhllehne und die Armgelenke auf die Tischkante, als wolle er eine seiner Reden halten. Stolze Freude erhellte das sonst strenge graue Gesicht: „Da seht ihr unsern Namen für immer mit der Geschichte auch des grössten aller Kriege verknüpft. Überhaupt der Kurt! Ich traute ihm immer mehr zu als eurem Werner!“
„Aber Papa!“ Gerda schüttelte mit unmutigem Staunen den Kopf: „Wie kannst du so reden!“
Elisabeth schmollte: „Sonst hattest du ihn doch gern!“
Der Vater vergass den Generalstabsbericht vorzulesen: „Gewiss hatte ich ihn gern, aber dass er euch küsste, gefällt mir nicht. Auch ist er seit fast drei Monaten draussen. Aber was habt ihr von ihm gehört? Kurt schrieb vor nur drei Wochen, er käme endlich an den Feind. Auf der ersten Fahrt also schickte er den Engländer zu den Fischen und schrieb unsern Namen in die Kriegsgeschichte! Das heiss’ ich einen Drewitz, einen Seemann und Soldaten, einen Offizier! Obenein erbt er später Priedelsdorf! Es wäre mir wirklich lieber, er hätte euch gek ...“ Verlegen brach er ab: „Nein, meine Kinder, das wollte ich natürlich nicht sagen. Junge Damen lassen sich nie küssen.“
Elisabeth unterdrückte ein Kichern.
Gerda sprach ernst mit bebender Stimme: „Papa, du denkst doch sonst gerecht und sagtest früher in Gegenwart beider Vettern, du begriffest nicht, warum unsre Freundinnen aus der Nachbarschaft gerade Kurt als dem Seeoffizier runde Augen machten. Jetzt hat er sich ausgezeichnet. Aber Werner hält uns die Russen vom Leibe und half schon im Westen die Franzosen und Engländer nach Frankreich hineinjagen. Er ist zu bescheiden, um von grossen Taten zu schreiben oder zu reden. Aber seine kurzen Worte und sein Aussehen liessen ahnen, was er getan und getragen hat.
Verblüfft sah der Vater seiner Tochter flammendes Gesicht. Warum ereiferte sie sich für Werner? Der Kuss auf dem Bahnhof schien doch nicht ein nur verwandtschaftlicher gewesen zu sein. Immerhin hatte er im Ärger vielleicht ungerecht gesprochen und musste begütigen: „Na ja, na ja, Töchterchen! Seine Schuldigkeit hat er getan. Dafür ist er ein Drewitz. Auch erinnere ich mich, gesagt zu haben, es gefiele mir nicht, dass Backfische Kurt als jungen Seeoffizier wie ein Wundertier bestaunten. Übrigens war nicht nur von euren Freundinnen die Rede. Elisabeth trieb es am schlimmsten!“
Verdriesslich sah er der Jüngeren in die Augen und sprach verweisend weiter: „Du trugst sein blaues Bordjackett als Überzieher, seine Schärpe als Gürtel und seine goldene Ärmelkrone als Brosche. Damals aber hatte die Marine noch wenig geleistet. Sie war angesehen nur als die jüngere, du sagtest sehr töricht: die hübschere Schwester unsrer glorreichen Armee. Heute tragen Heer wie Flotte Siegeslorbeer, und Kurt hat sich durch eine kühne Tat einen Namen und uns Ehre gemacht. Ausserdem erbt er Priedelsdorf.“
„Und Werner bekommt Kunzenberg, nun der arme Onkel Hermann keine Söhne mehr hat,“ sagte Gerda.
Der Vater schloss die Augen, als wolle er nicht hören, und griff ärgerlich nach der Zeitung, um den Generalstabsbericht vorzulesen.
Da sprang Elisabeth auf, ohne ihn um Erlaubnis zu bitten, und brachte aus dem Nebenzimmer eine Postkarte: „Schicken wir Kurt einen Glückwunsch!“ Sie schrieb.
Der Vater las lächelnd: „Die jüngere Schwester in Priedelsdorf gratuliert der jüngeren Schwester von der Wasserkante zum neuen U-Boot-Helden.“
Der alte Herr schalt nicht etwa, sondern setzte darunter: „Bravo, mein Junge! Besuche bald dein künftiges Heim!“
Gerda nahm die ihr zugeschobene Karte mit gerunzelter Stirn, sah Elisabeth ärgerlich in die Augen und schüttelte den Kopf: „Warum schreibst du nicht gleich: hübschere Schwester?“ Dann kritzelte sie hastig: „Gruss auch von Base Gerda.
Der Vater sah ihr misstrauisch zu. Gerda dachte doch wohl mehr als nötig an Werner. Gern hätte er den Mädchen darum von dem Geheimnis der Herkunft ihres Vetters gesprochen. Doch das verbot ein dem General gegebenes Wort. Nur zu gern hatte er es einst verpfändet, denn, wie an den Tag seiner Hochzeit, wollte er nie auch an die Ursache des Todes seiner Frau erinnert sein. Kaspar v. d. Helle brachte an jenem stürmischen Abend einen Knaben ins Haus. Als die geliebte Frau leblos auf den Fliesen der Halle lag, jagte er darum den Besucher in Zorn oder Gram mit dem fremden Kindermädchen und dem Kleinen auf ihrem Arm wieder in die Nacht. Vetter Fritz, der heutige General, erbarmte sich des Kindes und brachte es seiner jungen Frau in die westpreussische Garnison. Das Paar liess den Kleinen Werner taufen und zog ihn auf, ohne zu verraten, dass er ein Findelkind sei. Bald adoptierten sie Werner, der schon in der neuen Garnison des zum Stabsoffizier beförderten Vetters als echter Drewitz galt, denn vom Geheimnis seiner Herkunft ahnten sogar Verwandte nichts. Den einzigen Wissenden band sein Wort. Als die Frau des Majors Fritz v. Drewitz starb, schickte er den Knaben ins Kadettenkorps. Der hübsche, muntere Junge kam während eines Sonntagsurlaubs von Potsdam zum ersten Besuch nach Priedelsdorf. Da erwachte zwar nicht Reue, aber doch Bedauern. Er hatte an dem Knaben nicht edel gehandelt, und Werners Adoptivvater dachte wohl ähnlich, da er Priedelsdorf noch immer mied. Um ihn zu versöhnen, lud er den Kadetten Sonntag für Sonntag zunächst von Potsdam und dann von Lichterfelde nach Priedelsdorf. Auch die Ferientage verlebte Werner hier, bis sein Vater ihn gar als Fähnrich in das Infanterieregiment in Jüterbog eintreten liess. Der Junge wollte seinem zweiten Heim und Gerda und Elisabeth, den Spielgefährtinnen seiner Knabenjahre, nahe bleiben. Natürlich ahnten auch die Mädchen nichts von seiner Herkunft und glaubten ihn jetzt wohl den Erben von Kunzenberg. Also musste er ihre Augen öffnen, denn wieder klang ihm in die Ohren: Exzellenz v. Drewitz, räumen Sie auf!
Vorläufig war seine Zunge noch gebunden. Der General aber fühlte wohl die Pflicht, den Schleier von seines Adoptivsohnes Vergangenheit zu ziehen. Sonst konnte der Junge Anspruch auf das Majorat Kunzenberg erheben und sich lächerlich machen. Ihn zum Offizier zu erziehen, war möglich gewesen. Die niemals engherzige Armee fragte nicht nach den Geburtsurkunden künftiger Führer, denn sie wusste aus der Geschichte deutscher und fremder Heere, dass die stolze Blüte Feldherrnruhm gar oft aus wilden Reisern spross. Nicht erst seit der Sohn Kaiser Karls V. und der Bürgerstochter Barbara Blomberg als Don Juan d’Austria bei Lepanto eine gewaltige und gefürchtete Seemacht ins Wellengrab schickte, gaben Gekrönte die Kinder ihrer Sünde gern dem Kriegsdienst. Was aber den Königen recht war, mussten sie ihren Rittern als billig zugestehen. Darum stiegen auch in der ruhmreichen preussischen Armee wilde Sprossen zu Ehren und Würden auf. Doch die Gerichte dachten anders und forderten eine Geburtsurkunde, wenn Werner das Majorat Kunzenberg forderte. Dann stand er gedemütigt vor Fremden. Darum musste sein Vater ihn unterrichten und auch vor allzu vertrautem Verkehr mit Gerda und Elisabeth warnen.
Er wollte dem General schreiben und ging von Tisch wieder ins Arbeitszimmer.
Noch am Abend liess er den Brief zur Post bringen.
Zwei Briefe in der Hand, trat Generalleutnant v. Drewitz aus seinem Stabsquartier in Brzeziny unter die Laterne, die kärgliches Licht ins Dunkel des neblig kalten Novembermorgens warf. Mit dem „Brr!“ eines Fröstelnden schlug er den Pelzkragen des langen grauen Mantels zum Helm auf. Nur seine grosse Hakennase und die noch jugendlich blanken Augen sahen von unten zwei Offiziere auf der Strasse, die ihre rechten Hände zum Gruss hoben. „Morgen, meine Herren“, dankte er beim Hinabsteigen über die drei Stufen und drückte die Finger seines Adjutanten, des Majors Kumm, und des Generalstabsoffiziers Hauptmann von Husslarn, der schon meldete: „Vorhut trat eben an, Exzellenz.“
„Also haben wir noch Zeit!“ Er ging zu seinem wiehernd scharrenden Fuchs, den der Dragonerwachtmeister des Stabes auf einer trockenen Insel im Schlammbrei des Dammes hielt. Während er ein Stück Zucker mit der Linken unter des Tieres schnuppernde Nase hob, glättete die Rechte das im Laternenlicht glitzernde Fell. Mit befriedigtem Kopfnicken gegen den Wachtmeister stelzte er auf Fussspitzen durch den Schlamm zur Kruppe des Fuchses. Als seine Finger an den Sehnen der Hinterbeine hinabglitten, hob ein Dragoner die Hufe. Umständlich befühlte er Horn und Eisen, denn er ging während des Feldzuges zum erstenmal zu Pferd an den Feind. Nicht darum allein war es geraten, mit eignen Augen zu sehen, ob er sich auf Tier und Beschlag verlassen könne.