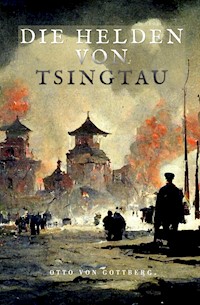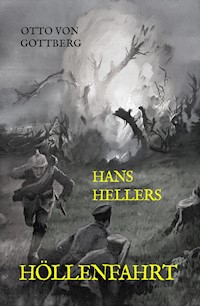
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ein Charakterbild des Lebens und Leidens eines deutschen Soldaten zur Zeit des Weltkrieges. Fast wortgetreu niedergeschrieben vermitteln sie die erschreckenden Eindrücke unter dem Einsatz neuer Kriegswaffen. Unbekannte Giftgase aus Lydditgranaten, verheerende Wirkungen neu eingesetzter Dumdumkugeln und neue Explosivgeschosse für den Fliegerkampf. Nach all dem Schrecken, lautet der Satz vieler Heimgekehrter "Ich kann mich noch nicht freuen, weil ich zu lange in der Hölle war."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Hellers Höllenfahrt
Erlebnisse in französischer Kriegsgefangenschaft
von
Otto von Gottberg
_______
Erstmals erschienen bei:
Otto Elsner Verlagsgesellschaft m. b. H., Berlin, 1917
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2017 Klarwelt-Verlag
ISBN: 978-3-96559-079-3
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Einführung
Erzählung
Einführung
uf dem Bahnhof in Konstanz saßen aus Frankreich gekommene Invaliden, darunter Stelzfüße und Einarme, aus deren Augen doch warm und hell die Freude am Wiederschauen der Heimat lachte. Nur ein anscheinend kaum Leidender stand ernsten, fast schwermütigen Gesichts und starrte so zweifelnd oder ungläubig ins Leere, dass ich fragen musste, warum er die Freude seiner Kameraden nicht teile. Er hob müde die Schultern und wehrte ab, als möge er sich nicht offenbaren:
„Ich kann mich noch nicht freuen, weil ich zu lange in der Hölle war.“
Ich gewann Hans Hellers Vertrauen und hörte allmählich die Geschichte seines grausigen Leidens in französischer Kriegsgefangenschaft. Wer sie liest, wird in der Tat glauben, in die Hölle, nämlich den tiefsten Abgrund menschlicher Verworfenheit, zu blicken. — —
Der Weltkrieg ist ein Kampf nicht nur des Rechts gegen das Unrecht in der Welt, sondern auch des Anstandes gegen Verkommenheit. Unsere Feinde führen die Waffen des Fürsten der Lüge, und teuflisch ist auch ihre Grausamkeit.
Der Engländer ist grausam im Kampf. Als erster verwendete er die in Notwehr auch von uns darum gebrauchten Giftgase in der Lydditgranate. Er ist der Erfinder der Dumdumkugel und neuerdings des Explosivgeschosses für den Fliegerkampf. Warf aber der Engländer einen Gegner nieder, dann findet sein unleugbar praktischer Sinn selten Zeit für zweckloses Quälen des Opfers. Des Russen Grausamkeit entspringt seiner Gleichgültigkeit gegen menschliches oder tierisches Leiden. Er liebt sein Pferd, aber denkt selten daran, ihm vor dem Verenden den Gnadenschuss zu geben. Er kaut neben einem in Schmerz und Qual sich windenden Sterbenden ein Butterbrot, ohne auf den Gedanken zu kommen, einen helfenden Finger zu rühren. „Brüderchen, du wirst sterben“, grunzt er wohl zwischen zwei Happen, aber . . . nitschewo . . ., das macht nichts, wenn das Butterbrot schmeckt. So ist die Masse der Russen geartet, obwohl der eine oder andere die angeborene Grausamkeit handelnd betätigen mag. Gewöhnlich geschieht es durch schnelles Morden, das freilich mehr oder wenig scheußlich sein mag. Der grausamste unserer Gegner aber ist — abgesehen von kulturlosen Halbwilden und Wilden, wie Montenegrinern, Italienern, Serben und Rumänen — der Franzose. Er will seine Grausamkeit durch Qualen niedergeworfener wehrloser Opfer betätigen. Er scheint einen Feind nicht bluten sehen zu können ohne den Wunsch, ein Messer in der Wunde herumzudrehen. Der gebildete Franzose mag das abscheuliche Verlangen gelegentlich unterdrücken. Vorhanden ist es zweifellos auch in ihm. Eine uralte, überlieferte Eigenschaft der Franzosen will jeden Hass auf einen Gegner schüren und mehren. Sogar in den Wunden besiegter Volksgenossen wühlt der Franzose mit gehässiger Grausamkeit. Auf dem Montmartre zu Paris wölbt sich eine aus dem ganzen Weichbild der weiten Riesenstadt sichtbare Kuppel als Dach der Kirche vom Heiligen Herzens Mit einem Aufwand von vielen Millionen unlängst so dickwandig gebaut, dass die Kirchenstürmer von zehn Revolutionen sich an den Mauern die Finger zerbrechen konnten, steht das Gotteshaus nicht als Sinnbild der Liebe, sondern des Hasses und der Grausamkeit. Begonnen nämlich wurde der Bau zur Feier eines politischen Sieges — (als die konservative und klerikale Rechte ans Ruder gekommen war) —, um das Empfinden der unterlegenen radikalen und irreligiösen Linken zu verletzen. Mit Spott verfolgen die Jakobiner wohl alle christlichen Bräuche, aber ihre höchste Wut und ihren grimmsten Ärger fordert die mystische Anbetung des Heiligen Herzens heraus. Darum sollte auf dem Montmartre keine gewöhnliche Kirche, sondern eine dem Mysterium vom Heiligen Herzen geweihte stehen. Umgekehrt beschlossen nach einem Wahlsieg der Linken die Radikalen das Empfinden der bezwungenen Klerikalen zu verwunden durch ein Gesetz, das aus allen Gerichtssälen das Kruzifix verbannte. Um Wut, Schmerz und Empörung der unterlegenen Gegner bis zu Qual und Verzweiflung zu steigern, wählten die Sieger von allen Tagen des Jahres gerade einen — den Karfreitag — um die Gottesbilder auf die Straße zu werfen! Das erklärt wohl, warum die Franzosen die dem deutschen Gemüt schier unverständlichen seelischen und körperlichen Quälereien an unseren Verwundeten und Gefangenen begehen und warum sie den Deutschenhass auch gegen Wehrlose schüren. Des Siegers Edelmut ist dem Franzosen so unbekannt wie Ritterlichkeit, deren er sich mit aufdringlich lauter Stimme vor aller Welt rühmt, weil er sie die ihm fernste und fremdeste Eigenschaft weiß. Hellers Geschichte ist darum nicht nur die des Leidens eines pflichttreuen deutschen Soldaten, sondern auch ein Charakterbild des französischen Volkes zur Zeit des Weltkrieges. Fast wortgetreu niedergeschrieben, wird sie im Streiter an der Front den Wunsch nach Rache und Vergeltung wecken. Dem Leser in der durch unser tapferes Heer vor französischer Grausamkeit geschirmten Heimat mag sie sagen, wie gut es ihm auch in einer Zeit kleiner Entbehrungen geht.
Otto v. Gottberg.
Erzählung
ährend wir auf der Wiese lagen, weckten mich Rufe. Die Augen öffnend, sah ich Kameraden zur Chaussee laufen und nach Westen schauen. Auch ich sprang neugierig auf. Ein Trupp Husaren kam die Straße entlang. Der voraustrabende Oberleutnant hielt bei den aus dem Chausseegraben aufstehenden Offizieren unseres Bataillons. Wir konnten zuhören und sahen dann zwanzig Husaren in der Kolonne zu zweien an uns vorüberreiten. Das war alles, was von der Schwadron noch lebte. Doch mussten wir Hurra schreien, bis die Luft zitterte. So gefielen sie uns. Die nassen Haare ihrer Pferde tropften von Schweiß. Blut und Staub klebte darin. Die Nüstern der Tiere waren rot, die Ohren gespitzt und die peitschenden Schweife gehoben, denn obwohl müde und abgehetzt, wieherten und tänzelten sie noch in Erregung. Mit den staubgrauen Haaren mancher Husaren spielte der Wind. Sie hatten die Mützen verloren, während sie vormittags dreimal je eine feindliche Schwadron angriffen und zusammenhauten. Mit zerbrochenen Lanzen, mit blutbefleckten, zerschrammten Gesichtern saßen manche mit Verbänden um Kopf und Arm im Sattel, aber aus ihren großen Augen blitzte mit Stolz die Freude am Sieg. Lachend zeigten sie auf reiterlose Pferde, die sie den Franzosen genommen hatten.
Wir liefen nebenher und wollten uns erzählen lassen. Da hieß es „an die Gewehre“. Auf der Straße, über die unsere Husaren gekommen waren, marschierten wir in den schwülen Abend und tiefer nach Frankreich hinein. Die Sonne sank blutrot in den Staub, der von der Erde stieg. Die Nacht brachte keine Kühlung. Wir schritten aus, ohne zu sprechen oder zu singen. Die Hitze drückte wie eine Last, obwohl ich als zweiter Mann vom rechten Flügel in der vordersten Gruppe marschierte. Ich horchte ins Dunkel, das kein Mond erhellte. Doch durch die schwarze Nacht zuckte zuweilen ein Wetterleuchten, dessen Blitzen die bleichen Gesichter der Gruppenkameraden mit tiefen, scharfen Linien zeigte. Hinterher schien es noch dunkler. Ich sah nichts und hörte nur das Schurren eisenbeschlagener Stiefelsohlen im stets gleichen, einschläfernden, doch nie verlangsamten Takt. Wenn das Auge sich wieder an die schwarze Nacht gewöhnte, schienen die Umrisse der Kameraden die von Riesen unter überlangem dünnen Gewehr, das unter seltsam hoher Helmspitze schräg über ungeheuer dickem Tornister lag. Vor uns blinkte ein kleines Glühwürmchen in der Luft. Das Hauptmotiv mit der brennenden Zigarre im Munde hatte sich umgedreht.
Nach Stunden leuchtete weit voraus ein größeres rotes Flämmchen. Mehr und mehr färbte der Widerschein einer fernen Feuersbrunst den Himmel. Da ward es in nächster Nähe um uns noch dunkler. Fast mit der Nase stießen wir auf einen Menschenschwarm. Mancher knipste schnell die Taschenlampe an. Wir hatten endlich den Krieg vor Augen. Verwundete aus dem Kampf begegneten uns. Die einen hinkten an Stöcken, andere ließen sich von Kameraden stützen. Viele trugen um den Kopf weiße Binden, durch die Blut sickerte.
„Weiter, weiter!“ hieß es, und „Rechts heran, Straße freigeben!“ rief der Hauptmann in den Trupp der Verwundeten, dem allerhand Karten folgten. Sie fuhren Schwergetroffene zum Verbandsplatz. Über das Quietschen der Räder klang oft Stöhnen. Die Pferde der Gespanne wieherten laut in die Nacht. Sie spürten die Nähe der Reittiere unserer Offiziere.
Wir fragten die Verwundeten, was es gegeben habe. Sie antworteten: „Wir haben sie gekloppt, aber die Hälfte von uns ist liegengeblieben. Gebt‘s ihnen dafür, Kameraden.“
Ob es noch weit zum Lazarett wäre, wollten sie wissen. Wir konnten nicht antworten.
Ich weiß nicht, wieviel Verwundete uns entgegenkamen. Gar viele begegneten uns während des Marsches. Da ward es hinter uns in der langen Kolonne noch stiller. Auch waren wir müde. Es gab weder Halt noch Rast. Wir hatten nichts zu essen oder zu trinken. — — —
Das Schwarz zwischen Himmel und Erde ward grau. Ich konnte vorn den Hauptmann und um mich die Gesichter der Gruppenkameraden sehen. Als schon vor Aufgang der Sonne Licht auf die Landschaft fiel, gewahrte ich, dass wir auf dem nächtlichen Marsch an den Feind nicht allein gewesen waren. Zur Rechten und Linken zogen auf gleichlaufenden Straßen andere Kolonnen westwärts. In der grauen Uniform waren sie schwer zu erkennen. Doch die mitziehenden Wolken von Staub sagten, dass auch dort Stiefelsohlen an müden Füßen auf Landstraßen schurrten.
Im Rücken ging die Sonne auf. Vor uns wanderten unsere Schatten. Wir machten eine kurze Rast. Der Hauptmann sprach mit uns, während er sein Pferd in mannshohen Weizen führte, um es Ähren fressen zu lassen. Verwundete begegneten uns nicht mehr. Es war kälter als während der Nacht, und doch sah ich in den Gesichtern um mich, dass, wie mir, jedem Kameraden jetzt im Sonnenlicht froher, freier und wärmer war. Wir wussten, es ginge an den Feind, aber mit dem Dunkel war der Druck von der Brust und die Beklemmung aus dem Kopf gewichen. Ich wusste wieder, wir marschierten zum Sieg. Da hörten wir das „Bumm“ des ersten Kanonenschusses. Ein zweiter folgte. Dann klang es dauernd wie fernes dumpfes Bellen.
Die Straße stieg leicht an. Wir erklommen eine flache Höhe und sahen vor uns zur Rechten der Chaussee auf den Stoppeln und in den Feldern rote Flecken im Sonnenlicht wie große Blumen lachen. Was konnte das sein? Unser Zugführer sah. durch das Fernglas: „Gefallene Franzosen“ Keine halbe Stunde verging, bis wir Tote aus nächster Nähe sahen. Wenige trugen das deutsche Feldgrau. Eine nicht zu zählende Menge lag im Rot und Blau der Franzosen. Dann wich mein Nachbar zur Rechten, unser Flügelmann, mit einer Biegung nach links einem wahren Berg von Leichen aus, obwohl die Toten nicht auf der Straße, aber hart daneben lagen. Die ganze Kolonne machte wie in Ehrfurcht einen Bogen um die Gefallenen, und Ehrfurcht spürten wir auch vor den feindlichen Toten. Sie hatten treu bis zum Ende die Erde ihrer Heimat verteidigt und das Leben für ihre Brüder gegeben, wie wir zu tun entschlossen waren. Ein schlimmer Kampf mit Kolben und Bajonett musste hier an der Straße und im Weizenfeld zur Rechten gewütet haben. Das Korn war noch nicht gemäht, aber lag blutbefleckt weit in der Runde flach niedergetreten. Von den Gefallenen stemmte mancher noch die erstarrten Füße in den Heimatsboden, den er hatte halten und nicht lassen wollen. Unter bleichen Händen sahen wir Löcher, die in Schmerzen erkaltete Finger gewühlt hatten. Mit dem Spaten waren tiefere Löcher gegraben. In ihnen hatte der noch im Anschlag liegende Tote seinen letzten Atem und ein Gewehr sein letztes Geschoss ausgestoßen.
So zeigte das Licht der aufgehenden Sonne uns den Krieg. Auch der Donner der Kanonen klang näher, und hinter der nächsten Bodenwelle sahen wir zur Linken der Straße drei unserer Batterien in Stellung. Die Geschütze feuerten noch nicht, aber die Kanoniere warteten auf den Befehl dazu und riefen:
„Ihr kriegt zu tun. Vorn kämpfen sie seit gestern Nachmittag.“
Da dachte ich an das eben geschaute Bild an der Straße und der Morgen schien wieder kälter. Das Plaudern in der Kolonne verstummte. Aber von hinten rief Reservist Nagel, der Spaßmacher unserer Kompagnie:
„Na, Justav Krüger, zwei schöne Leichen jibt’s nicht, wenn wir beide heute dran glauben müssen!“