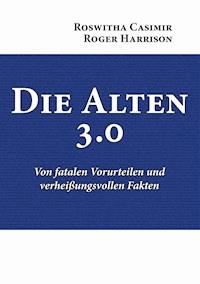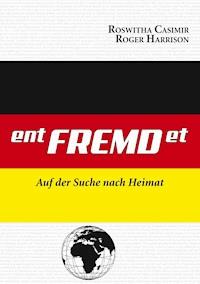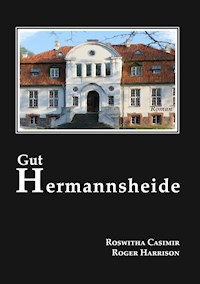
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Leiche im Moor, ein undurchsichtiger schottischer Pensionär und der Gründer des Musterguts sind die Hauptdarsteller der zweiten Erzählung aus der Grafschafter Trilogie. Angestoßen durch den Leichenfund verfolgen wir den Lebensweg des eigenwilligen Industriellensohns Victor van Vals durch zwei Weltkriege und erleben das Entstehen des fiktiven Guts Hermannsheide. Schauplätze sind neben seiner Heimat das angrenzende Emsland, die niederländische Region Twente sowie Münster und Berlin. Seine zwanzigjährige Tochter Marie erlebt die britische Besatzung der Grafschaft Bentheim, bis sie in den Nachkriegswirren spurlos verschwindet. Warum wird der Schotte mit ihrem Verschwinden in Zusammenhang gebracht, welches Rätsel umgibt ihn und seine Familie? Erst knapp siebzig Jahre nach Kriegsende werden die Geschehnisse aufgelöst und offenbaren spektakuläre Familiengeheimnisse. "Gut Hermannsheide ist die zweite Erzählung aus der Trilogie um das Gut in der Grafschaft Bentheim. Bisher erschienen ist Band 1 "Das Dilemma".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bisher von den Autoren veröffentlicht:
Cyberrom@nzen
1996
Die Alten 3.0
2016
entFREMDet
2017
Grafschafter Trilogie:
Das Dilemma
2018
Gut Hermannsheide
2019
Mörder!
2020 (voraussichtlich)
Die Autoren:
Roswitha Casimir, geboren 1952 in Koblenz. Die gelernte Betriebswirtin war zunächst in einer Anwaltskanzlei und seit 1984 in einer internationalen Behörde in München, Berlin, Wien und Den Haag tätig. 2005 wurde sie aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand versetzt.
Roger Harrison, geboren 1954 in Hannover, hat schottische Wurzeln und wuchs in den USA und Großbritannien auf. Der Ex-Unternehmensberater und Internetpionier war bis 1996 in London und anschließend in München und Den Haag selbständig tätig. 2010 beendete er sein Berufsleben.
Die Autoren sind miteinander verheiratet und leben heute in Nordwestdeutschland unweit der niederländischen Grenze.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prolog
Kapitel I: Letztes Jahr in der Grafschaft Bentheim
Abschnitt 1: Déjà-Vu
Abschnitt 2: Forsthaus
Abschnitt 3: Douglas und Fiona
Abschnitt 4: Einzug
Abschnitt 5: Bußmann und seine Freunde
Abschnitt 6: Die Leiche
Kapitel II: Jahrhundertwende
Abschnitt 1: Die Familie van Vals
Abschnitt 2: Schüttorf 1896
Abschnitt 3: Aussprache
Abschnitt 4: Wietmarschen
Abschnitt 5: Ankunft in Berlin
Abschnitt 6: Meyer‘s Hof
Kapitel III: 20. Jahrhundert
Abschnitt 1: Studium
Abschnitt 2: Wannsee
Abschnitt 3: Katharina
Abschnitt 4: Neuigkeiten von Zuhause
Abschnitt 5: Chaos
Abschnitt 6: Plan B
Kapitel IV: Das Mustergut
Abschnitt 1: Beruf und Leidenschaft
Abschnitt 2: Aufbau
Abschnitt 3: Krieg
Abschnitt 4: Schlechte Zeiten
Abschnitt 4: Marie
Abschnitt 5: Gefährliche Zeiten
Abschnitt 6: Flucht in die Niederlande
Kapitel V: Kriegswirren
Abschnitt 1: Kriegserklärung
Abschnitt 2: Bombadierung
Abschnitt 3: Der Offizier
Abschnitt 4: Liebe
Abschnitt 5: Familiennachzug
Abschnitt 6: Desaster
Kapitel VI: Vor wenigen Wochen
Abschnitt 1: Dorf in Aufruhr
Abschnitt 2: Recherchen
Abschnitt 3: Verhör
Abschnitt 4: Die Aufzeichnungen
Abschnitt 5: Deters
Abschnitt 6: Der Gerichtsmediziner
Abschnitt 7: Soko Marie
Vorwort
Die vorliegende Erzählung ist Teil einer Trilogie um das fiktive Gut Hermannsheide in der niedersächsischen Grafschaft Bentheim.
Bei der Trilogie handelt sich um drei inhaltlich zusammenhängende, jedoch jeweils abgeschlossene Geschichten, in die wir, wo nötig, Hintergrundinformationen aus den anderen Teilen integriert haben, um die Bücher unabhängig voneinander und in beliebiger Reihenfolge lesen zu können.
Während der 2018 erschienene Band Das Dilemma in der Gegenwart spielt, umfasst Gut Hermannsheide die Zeit zwischen Jahrhundertwende und Zweitem Weltkrieg. Voraussichtlich Mitte 2020 erscheint der dritte und letzte Band mit dem Arbeitstitel Mörder!, der die Nachkriegszeit beleuchten wird.
Für alle drei Erzählungen gilt: Sie basieren auf wahren Vorgängen – nämlich den Ideen und Gedanken zweier Autoren, die sie ersannen. Hirngespinste könnte man sagen. Handlung, Figuren und Örtlichkeiten sind in teilweise reale geschichtliche Ereignisse eingebunden, jedoch unserer Fantasie entsprungen. Ähnlichkeiten mit konkreten Ortschaften, existenten Personen und tatsächlichen Geschehnissen sind nicht immer zufällig, vieles hätte durchaus so stattfinden können, dennoch: Die Geschichten sind fiktionale Werke. Wer sich trotzdem wiedererkennt, verfügt über mindestens so viel Fantasie wie die Autoren.
Die Verfasser Juli 2019
Prolog
Sie verschwand auf unerklärliche Weise und tauchte nie wieder auf.
Marie war als Dolmetscherin und Hausmädchen für einen britischen Offizier tätig, der Ende des Zweiten Weltkriegs Gut Hermannsheide mit seiner Kompanie beschlagnahmte, nachdem britische und polnische Truppen die Grafschaft besetzt hatten.
Da das Haupthaus des Gutes in den letzten Kriegstagen durch einen Bombenangriff beschädigt und unbewohnbar geworden war, nahm der Offizier im nahegelegenen Forsthaus Quartier. Seine ursprünglich knapp einhundert Mann umfassende Kompanie, die nach der verlustreichen Operation Overlord, der Invasion in der Normandie von Juni 1944, auf gerade einmal 34 Mann geschrumpft war, wollte er in den Arbeiterhäusern unweit des Gutes unterbringen, die allerdings durch Gutsmitarbeiter und ihre Familien bewohnt waren.
Dieses Requirieren von Wohnraum fiel ihm ausgesprochen schwer. Die Bewohner mussten alles zurücklassen und ihr Zuhause innerhalb von Stunden räumen, ohne zu wissen, wohin. Auch wenn es Kriegsfeinde und die besonders verhassten Deutschen waren – er erkannte die Not der einzelnen Menschen und versuchte, so rücksichtsvoll wie möglich zu handeln. Der deutsche Nationalsozialismus und sein dämonischer, fanatischer Diktator Hitler mochten einen schrecklichen Krieg angezettelt haben, der Millionen Tote forderte und unzählige Menschen ins Unglück stürzte, doch nicht jeder Deutsche war ein Nazi, Mörder und Judenhasser.
Nach Ansicht des Majors war der Krieg so gut wie beendet, Deutschland lag auf dem Boden, die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht musste unmittelbar bevorstehen, zumal Gerüchte über den Tod Hitlers die Runde machten. Ja, bestraft werden sollten natürlich alle Schuldigen, doch in seinen Augen war dies nun Sache der Justiz und nicht des Militärs.
Gleichzeitig sorgte er sich um seine eigenen Leute. Sie waren jung, kaum einer über 25 Jahre alt, und sie hatten Dinge gesehen und erlebt, die sie sich vor dem Krieg gewiss nicht einmal hätten vorstellen können. Sie hatten gefährliche, entbehrungsreiche und kräftezehrende Monate auf ihrem Vormarsch zum niederländisch-deutschen Grenzgebiet hinter sich, wo sie kaum mehr von der Nachschubversorgung bedient werden konnten und weitgehend auf sich selbst gestellt waren. Sie hatten es nun mehr als verdient, eine ordentliche warme Mahlzeit zu essen, in einem Haus und einem richtigen Bett zu schlafen, sich vernünftig zu waschen und anständig zu versorgen.
Für ihn selbst musste keine Familie ihre Wohnung räumen, da der letzte Förster von Hermannsheide an der Ostfront gefallen war, keine Familie hinterließ und das Haus leer stand. In dieser Försterei konnte der Major im unteren Bereich seine Kommandantur einrichten und im oberen Stockwerk wohnen.
Den Einheimischen, die ihre Häuser für seine Leute verlassen mussten, wollte er gern gestatten, in den Nebengebäuden und Stallungen der weitläufigen Gutsanlage unterzukommen, bis ihnen von der Militärverwaltung Wohnraum zugewiesen wurde. Gleichzeitig wollte er die Menschen darüber informieren, dass die britische Militärregierung bereits aktiv geworden war, den Verwaltungssitz des Landkreises von Bentheim nach Nordhorn verlegt hatte und sich so schnell wie möglich um die Belange der Bevölkerung kümmern würde. Die Verständigungsprobleme waren jedoch enorm. Sein Dolmetscher war schon in der Normandie gefallen, weder er selbst noch seine Leute sprachen Deutsch und die Bewohner höchstens ein paar Brocken Englisch.
So war er erfreut und erleichtert, als sich eine junge Frau als Übersetzerin anbot und tatsächlich respektable Sprachkenntnisse vorwies. Er erfuhr von ihr, dass sie Marie hieß und die Tochter der Gutsbesitzer war. Nachdem sie seine Informationen und Anweisungen klar und selbstsicher an die Bewohner weitergegeben und sie offenkundig beruhigt hatte, fragte der Major, wo sie selbst wohnte. Sie zuckte nur mit den Schultern.
»Seit der Bombardierung mal hier, mal da. Es ist ja mild, deswegen ist es nicht schlimm, im Stall oder Schuppen zu schlafen.«
»Und Ihre Familie?«
»Meine Eltern sind in Ostpreußen, um meine Großmutter zu holen.«
Der Major war von ihrer inneren Ruhe und offensichtlichen Gelassenheit beeindruckt, mit der sie dem Ausnahmezustand dieser Zeiten begegnete. Er bot ihr an, gegen Kost und Logis für ihn zu arbeiten und eines der Zimmer im Obergeschoss des Forsthauses zu beziehen.
»Wenn Sie erlauben...« Sie zögerte ein wenig.
»Es gibt da ein Gartenhäuschen hinter der Försterei. Das könnte ich mir herrichten. So würde ich Sie nicht stören ...«
»... und ich dir nicht zu nahe kommen ...«, beendete der Major den Satz in Gedanken und mit einem inneren Grinsen.
Aber er hatte volles Verständnis, dass eine junge und attraktive Frau wie sie zögerte, Tür an Tür mit einem Fremden zu wohnen. Sie war zwar klein und zierlich, doch mit ihrem entschiedenen Auftreten und ihrer Schönheit fiel sie sofort in der Menge auf. Sie hatte einen sportlichen Körper, leicht gebräunte Haut, zu einem Pferdeschwanz gebundenes blondes Haar, babyblaue strahlende Augen und einen Schmollmund in einem perfekt geschnittenen Gesicht. Er musste sich zwingen, sie nicht regelrecht anzustarren. Stattdessen nickte er knapp und reichte ihr zur Besiegelung der Absprache die Hand.
»In Ordnung. Richten Sie sich in Ruhe ein und melden Sie sich morgen früh um acht Uhr in der Kommandantur.«
Marie war die einzige Tochter von Victor und Katharina van Vals, dem Verwalter-Ehepaar von Gut Hermannsheide. Ihre Mutter stammte aus Ostpreußen, wo noch die Großmutter lebte. Ihr Vater kam aus Schüttorf, wo es ebenfalls noch Verwandte gab, alles Schwestern ihres Vaters. Wegen einer alten Familienfehde hatte sie jedoch mit diesen Verwandten, außer mit Tante Henriette und ihrer Familie, keinen Kontakt, hatte sie nicht einmal je kennengelernt. Es schien sich um Erbstreitigkeiten zu handeln, die aus der Jugend ihres Vaters herrührten. Mit Tante Henriette allerdings, einer jüngeren Schwester ihres Vaters, war sie gut befreundet. Henriette Deters war bereits Großmutter, und Marie hatte ein inniges Verhältnis zu Enkelchen Peter, der mehrfach auf dem Gut seine Ferien verbracht und den sie immer gern gehütet hatte.
In den Wirren der Nachkriegszeit mit ihrem nicht enden wollenden Strom von Besatzern, Flüchtlingen, heimkehrenden Soldaten, ehemaligen Zwangsarbeitern, Hamsterern oder Obdachlosen, mieden vor allem die Frauen die Landstraßen und einsamen Wege abseits von Siedlungen. Da Gut Hermannsheide rund eine Stunde Fußweg von Schüttorf entfernt lag, besuchte Marie ihre Tante erst wieder im Herbst 1947. Es gab viel zu erzählen, doch im Mittelpunkt stand die bedauerliche Tatsache, dass Maries Eltern in Ostpreußen vermisst waren und sie sie inzwischen vermisst gemeldet hatte.
Henriette war voller Sorge und Mitgefühl, trauerte sie doch selbst um ihren Bruder und ihre Schwägerin. Gleichwohl freute sie sich darüber, dass Marie recht propper aussah und überraschenderweise zugenommen hatte, obwohl sie klagte, dass es ihr körperlich gar nicht gut ginge, was aber wohl an ihrer Untröstlichkeit läge. Marie erzählte, sie müsse nun für ein paar Monate in den Haushalt eines in Osnabrück stationierten Generals ziehen, um dessen kürzlich aus England nachgezogenen schwangeren Frau zur Hand zu gehen. »Ihr« Major habe es wohl nicht ablehnen können, als sein Vorgesetzter bei einem Besuch darum bat, dass sie sich einige Monate um seine Frau kümmere.
In den kommenden Monaten schrieb Marie zweimal an Henriette – eine Postkarte mit dem kurzgefassten Inhalt, dass es ihr in Osnabrück soweit gut ginge, der britische Generalmajor Farndale und seine Lady freundlich zu ihr seien und sie wohl im Januar oder Februar zurückkomme. Ihre zweite und letzte Nachricht war eine Weihnachtskarte. Traurig sei sie, dass die Eltern nach wie vor vermisst seien und sie das Weihnachtsfest nicht mit der Familie feiern könne, doch ansonsten ginge es ihr gut. Sie freue sich auf ihre baldige Rückkehr und das Wiedersehen mit Tante Henriette und ihrer Familie.
Danach hörte man nie wieder von ihr.
Zunächst machten sich Tante Henriette und ihre Familie keine größeren Sorgen, schließlich war Marie eine selbständige und selbstbewusste junge Frau. Lediglich der kleine Peter fragte beständig nach, wann Tante Marie – und vor allem das Geschenk, das sie ihm versprochen hatte – endlich käme. Erst als Ende März 1948 noch immer kein weiteres Lebenszeichen von ihrer Nichte gekommen war, begann Tante Henriette mit Nachforschungen. Sie bat einen Nachbarn, der Besorgungen in Nordhorn zu erledigen hatte, auf der Kommandantur in der Bentheimer Straße vorzusprechen und nach der Privatadresse des Generalmajors Farndale in Osnabrück zu fragen, den Marie in einer ihrer Nachrichten ja namentlich erwähnt hatte.
Der Nachbar kam mit der Information zurück, dass der Generalmajor bereits vor sechs Monaten nach London zurückberufen worden. Er war noch so schlau gewesen, nach der Ehefrau zu fragen; vielleicht war sie ja allein in Osnabrück verblieben. Darauf erhielt er die Auskunft, dass der Generalmajor seit vielen Jahren Witwer sei und gar keine Frau habe.
Verwirrt und tief beunruhigt entschied Tante Henriette, nun auf der Stelle und höchstpersönlich in Hermannsheide nach Marie zu suchen. Zumindest der Major, Maries letzter Arbeitgeber, musste schließlich wissen, wo sie war. Zusammen mit ihrem früheren Verwalter – die Straßen waren für Frauen allein immer noch nicht ganz gefahrlos – machte sie sich ungeduldig zu Fuß auf den Weg.
Seit wenigen Tagen herrschte für die Jahreszeit ungewöhnliche und beständig zunehmende Kälte im Land, die Temperaturen waren in der Nacht auf bis minus zwanzig Grad gefallen, die Straßen waren vereist, es wehte ein scharfer Wind. Kaum waren sie aus der Stadt heraus, wurde ihnen klar, dass sie bei diesem Wetter unverhältnismäßig lange für den Fußmarsch nach Hermannsheide brauchen würden. Sie wollten schon umkehren, besseres Wetter abwarten und nach einer Fahrgelegenheit suchen, als das Pferdefuhrwerk des lutherischen Pastors von Bentheim anhielt und sie mitnahm.
Der Pastor, der mangels eigener Kirche seine in der Grafschaft versprengten Schäfchen auf regelmäßigen Rundtouren betreute, war auf dem Weg nach Birkenvenn, was nur wenige Kilometer nördlich von Hermannsheide lag und wo er eine Messe lesen wollte. Als sie dankbar zugestiegen waren und die Tante mit einem erleichterten Seufzer im hinteren Teil des Planwagens Platz nahm, realisierte der Pastor mit Wohlgefallen, dass sich nun auf seinem Wagen neben seinem selbstverständlich lutherischen Küster Siegfried, der die Zügel führte und der reformierten Frau Klasing, die ebenfalls nach Hermannsheide wollte, die katholische Tante und ihr calvinistischer Verwalter gesellt hatten. Fünf Personen und vier unterschiedliche Konfessionen. Er selbst hielt von kirchlichen Konflikten nichts und sehnte sich nach der christlichen Versöhnung zwischen Lutheranern und Katholiken, ja, am besten allen Glaubensrichtungen. Einen Moment verlor er sich mit einem verträumten Lächeln in der Vorstellung, wie er und sein lutherischer Amtskollege in der früheren katholischen Kirche St. Laurentius zu Schüttorf in friedlicher Eintracht und mit allen Gläubigen auf dem so außergewöhnlich, da kreisrund angeordneten Gestühl saßen und ein gemeinsames Abendmahl feierten.
»Eines Tages …,« dachte er zuversichtlich, verfolgte sodann jedoch interessiert die Unterhaltung seiner Mitfahrer. Frau Klasing, eine Bekannte von Henriette, hatte sie nach dem Grund ihres Besuchs in Hermannsheide gefragt und zeigte sich erstaunt, als sie den Zweck des Ausflugs erfuhr.
Nein, nein, das könne nicht stimmen, dass Marie bis nach Weihnachten in Osnabrück gewesen sei. Das sei erheblich kürzer gewesen! Sie sei zwar im Winter ein paar Wochen verschwunden gewesen und man hatte gehört, dass sie in Osnabrück bei einer englischen Generalsfamilie war. Doch spätestens die Woche vor Weihnachten war sie zurückgekehrt. Genau eine Woche vor Weihnachten habe sie sie nämlich im Forsthaus von Hermannsheide gesehen. Nein, sie täusche sich nicht – das wisse sie ganz genau!
Der Heilige Abend sei ja auf einen Mittwoch gefallen und genau in der Woche zuvor, also am 17. Dezember, sei sie am Forsthaus gewesen, um Näharbeiten abzugeben, die die Frau des Majors in Auftrag gegeben hatte. Sie lieferte ihre Näharbeiten schließlich immer mittwochs aus. Mit der Lady konnte sie sich ja leider nicht verständigen – gerne hätte sie mit ihr geplaudert, zumal sie sah, dass sie schwanger war. Sie hatte auf einmal schon ein hübsch rundes Bäuchlein, die Frau Major. Doch der Herr Major sei hinzugekommen, habe die Nähsachen in Empfang genommen, ihr einen großzügigen Geldbetrag und eine Konservendose mit eingemachtem Schweinefleisch in die Hand gedrückt und freundlich zugenickt. Da blieb ihr nichts übrig, als zu gehen. Gleichzeitig habe sie die Marie zufällig hinter einem Fenster im ersten Stock entdeckt und ihren Namen gerufen. Marie habe darauf das Fenster geöffnet, ihr zugewunken und »Schöne Festtage und ein gesegnetes Weihnachtsfest!« gewünscht. Sie war sicherlich bei der Hausarbeit gewesen, die gute Marie. Sie hatte ja immer gut zu tun, das fleißige Ding. Das Forsthaus war schließlich ein großes Haus und jetzt, wo die Dame des Hauses auch noch schwanger war, gab es bestimmt noch mehr für sie zu tun, nicht wahr.
Es sei aber sinnlos, zum Forsthaus zu fahren, denn Marie sei gewiss nicht mehr dort, schließlich seien der Engländer und seine Frau bereits vor längerem ausgezogen. Zurück in ihre Heimat, habe es geheißen. Das müsse wohl Ende Januar gewesen sein, und seither stünde das Forsthaus leer. Wo Marie nun wohnte, könne sie leider nicht sagen. Jedenfalls nicht in Hermannsheide, das würde sie wissen.
Henriette war entsetzt. Es hatte also offensichtlich keinen Sinn, weiterzufahren, auch ihr Begleiter war dieser Meinung. So entschieden sie sich, abzusteigen und kämpften sich im Schneesturm zurück nachhause. Frau Klasing und der Pastor hatten versprochen, sich umzuhören und sich zu melden, falls sie etwas über Maries Verbleib erfuhren.
Zurück in Schüttorf schickte Henriette ihren Enkel Peter umgehend zur Polizei, um Marie vermisst zu melden. Um Gotteswillen, vielleicht hatte man es mit einer Straftat zu tun! Vielleicht war Marie nach England oder anderswohin entführt worden oder sogar tot, ermordet! Die Tante war höchst beunruhigt. Auch der Rest der Familie war in Aufruhr, so wie bald ganz Schüttorf, wo sich die Nachricht von Maries mysteriösem Verschwinden wie ein Lauffeuer verbreitete.
KAPITEL I
Letztes Jahr in der Grafschaft Bentheim
1
Déjà-Vu
Erneut überfiel Alexander McGregor ein merkwürdiges Vertrautheitsgefühl, als er vor dem ehemaligen Herrenhaus der Gutsanlage von Hermannsheide stand. In den letzten beiden Jahren grundsaniert und wieder aufgebaut, beherbergte es einen Landgasthof mit Biergarten, einen altmodischen Kolonialwarenladen, eine Reihe von Wohnungen sowie im gesamten linken Flügel eine »Tagesbetreuung für Senioren und Kinder«. Alexander erlebte ein Déjà-vu – das Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein und viel über diese Örtlichkeit zu wissen. Dabei sah er sich jedoch vor den Ruinen dieses Herrenhauses stehen, so wie es vor seiner Sanierung ausgesehen haben mochte. Gleichzeitig war er sich sicher, zum ersten Mal in seinem Leben hier oder in der näheren Umgebung zu sein.
Ein solches Erlebnis war ihm nicht vollständig neu, doch frühere Vorfälle angeblicher Erinnerungen waren flüchtig und entlarvten sich rasch als Täuschung, eine Art Fehlschaltung des Gehirns. So war es ihm bereits kurz gegangen, als sie das Forsthaus besichtigten. Die Auffahrt zum Haus durch ein Wäldchen, der Anblick von außen, waren ihm seltsam vertraut erschienen. Doch sobald sie das Haus betraten, verging diese Empfindung.
Nun allerdings war das Phänomen auffallend stark und intensiv. Aus einer vagen Intuition wurde nahezu Gewissheit. Sein Blick fiel auf den modernen Eingangsbereich des Hauses, doch gleichzeitig meinte er, vor einer eingefallenen und zerstörten Freitreppe mit steinernen Balustraden zu stehen.
Erstaunlich. Paradox und rätselhaft.
Zweifelsohne war Alexander ein fantasiebegabter Mensch, schließlich hatte er bis zu seiner kürzlichen Pensionierung sein Auskommen als Computerspiele-Entwickler bestritten und war in seiner Freizeit begeisterter Rollenspieler. Hinzu kam, dass er sich mit Kryptozoologie beschäftigte, einem Gebiet der Zoologie, das verborgene Tiere aufspürt und erforscht. Diese, allerdings noch nicht allgemein anerkannte Wissenschaft wurde um 1950 von dem Zoologen Bernard Heuvelmans begründet. Obwohl sich viele Scharlatane auf diesem Gebiet herumtrieben, gab es unter ihnen eine Reihe ernstzunehmender Forscher. Ihren Gedanken hatte er sich angeschlossen und ging mit ihnen davon aus, dass Drachen zu den Nachfahren der Dinosaurier zählten und die Berichte, die uns aus dem Altertum oder dem Mittelalter überliefert sind, einen wahren Kern enthielten.
Nicht wenige Menschen bezeichneten ihn wegen seiner Hobbys und Leidenschaften als exzentrisch und ein wenig weltfremd. Doch er stand durchaus mit beiden Beinen fest auf der Erde, glaubte weder an Übersinnliches noch an Wahrsagerei. Daher konnte er sich die intensiven und überaus realistischen Gedanken- und Bilderfetzen nicht erklären, die ihn beim Anblick des Herrenhauses geradezu überfallen hatten.
Vor dem Gebäude stehend, blieb ihm keine Zeit, sich diesem Phänomen weiter zu widmen, denn nun verlangte seine Frau Clara nach Aufmerksamkeit.
»Was denkst du? Sollen wir kaufen? Ich finde vor allem die Lage und das Grundstück einfach wunderschön! Auch sonst habe ich nichts zu kritisieren. Wir werden viel renovieren müssen, aber finanziell hält sich das in Grenzen, wenn wir mit anpacken.«
Natürlich sprach sie nicht über das Herrenhaus, sondern um das einige hundert Meter entfernt gelegene ehemalige Forsthaus, das sie zuvor besichtigt hatten und wo ihn eine erste Erinnerungstäuschung überrascht hatte.
Sie wartete nicht, bis er antwortete. Im Grunde musste er keine Antwort geben, denn Claras Worte ließen erkennen, dass sie sich bereits für einen Kauf entschieden hatte. Alexander wies zwar gern von sich, unter ihrem Pantoffel zu stehen, musste aber zugeben, dass vorwiegend das getan wurde, was sie wollte. Ein Veto-Recht stand ihm prinzipiell zu – er verwendete es indes nur äußerst selten. Sie hatten überaus ähnliche Ansichten und einen ähnlichen Geschmack. Daher war sie meist in der Lage, ihn von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Andererseits hatte sie sich die wenigen Male, wo er eine andere Meinung vertrat und partout ihre Sicht der Dinge nicht akzeptieren wollte, einsichtig und nachgiebig gezeigt.
Der Immobilienmakler hatte erzählt, das bis vor kurzem ein altes Ehepaar im Forsthaus lebte. Als die Frau starb, habe sich der Witwer entschlossen, in ein Altersheim zu ziehen. Seither, es mochten zwei oder drei Monate her sein, stand das Haus zum Verkauf.
»Sie könnten also sofort einziehen, wenn Sie möchten.«
Zum Abschied hatte er ihnen noch ein ausführliches Exposé überreicht und einen Spaziergang sowohl durch die Ortschaft als auch zum Gutsgelände empfohlen.
»Es wird viel getan, Sie werden überall Bauarbeiten sehen.«
»Wir haben davon gelesen. Es ist einer der Gründe, warum wir überhaupt auf Hermannsheide aufmerksam geworden sind.«
»Überdenken Sie Ihre Entscheidung ruhig gründlich, doch lassen Sie sich nicht allzu viel Zeit. Es gibt einige ernsthafte Interessenten für das Forsthaus. Es ist ja auch ein kleines Juwel. Und in der näheren Umgebung hätte ich sonst leider kein Objekt, das für Sie in Frage käme. Die Nachfrage ist hoch, seitdem in Hermannsheide so viel passiert.«
Ähnliches verkündeten Immobilienmakler wohl bei jedem Verkaufsobjekt, doch in diesem Fall schien man ihm glauben zu können. Hermannsheide war zum beliebten Wohnort geworden und das Haus eine seltene und doch bezahlbare Gelegenheit.
2Forsthaus
Nachdem Alexander sein sechzigstes Lebensjahr überschritten hatte – Clara war nur ein Jahr jünger –, hatten sie begonnen, nach einem Ort zu suchen, wo sie ein Haus kaufen und sich nach dem Ende ihrer Berufstätigkeit dauerhaft niederlassen könnten. Damals lebten sie in den Niederlanden, in Den Haag, um genau zu sein, wo Clara in einer europäischen Behörde tätig war, während Alexander als Informatiker und Spieleentwickler von zuhause arbeitete. Clara, Tochter eines deutschen Diplomaten, der alle vier Jahre in ein anderes Land versetzt worden war und später als Europäische Beamtin selbst von häufigem Wohnsitzwechsel betroffen, hatte nie ein Heimatgefühl entwickelt. Alexander hingegen liebte seine Heimat Schottland und fühlte sich dem Land im Innersten tief verwurzelt; es hatte ihn aber beruflich jahrzehntelang in andere Länder verschlagen, so dass er sich im Alter ein Leben in den Highlands oder einer der abgelegenen Inseln nicht mehr vorstellen konnte. Sie fuhren regelmäßig nach Schottland in Urlaub, doch dauerhaft dort leben – nein, das konnten sich beide nicht vorstellen.
Daher fasste das Paar zunächst den Gedanken, ihren Lebensabend in den Niederlanden und am Meer zu verbringen, gab diesen Plan jedoch schnell und desillusioniert auf, als sie die Immobilienpreise kannten und sich eingestehen mussten, dass sie sich dort ein Haus nach ihrem Geschmack nicht würden leisten können.
Clara las ihrem Mann eines Morgens aus einer der deutschen Zeitungen vor, die sie abonniert hatte. Die Rede war von einem aufsehenerregenden Projekt an der niederländisch-deutschen Grenze im Nordwesten, das die frühere Landarbeitersiedlung Hermannsheide zu neuem Leben erweckte, die sich in den letzten Jahrzehnten – wie so viele andere ländliche Siedlungen nicht nur in Deutschland – zu einem leblosen Schlafdorf ohne Infrastruktur zurückentwickelt hatte. Es hatte sich anscheinend ein potenter, geheimnisumwitterter Investor gefunden, der die im zweiten Weltkrieg bombardierte und seither im Dornröschenschlaf liegende Gutsanlage wieder aufgebaut hatte.
Angefangen habe alles vor wenigen Jahren mit einer kleinen Anlage für altersgerechte Wohnungen. Sowohl auf dem weitläufigen Gutsbezirk mit dem herrschaftlichen Gutshaus als Mittelpunkt als auch dem angrenzenden Dorf hätten mittlerweile zahlreiche Bauvorhaben lebendige Arbeits-, Einkaufs-, Dienstleistungs- und Freizeitbereiche zwischen Generationenwohnanlagen, Pflegeheim, Grundschule und Kindertagesstätte entstehen lassen. Dazu habe man das frühere Ortszentrum neu gestaltet und den Dorfplatz zu neuem Leben zu erweckt, wo der alte Dorfgasthof nach jahrelangem Leerstand renoviert und um einen Anbau für einen Dorfladen erweitert wurde. Nun seien die Pläne weitgehend verwirklicht, abschließend würden noch einige Außenanlagen entstehen.
Das alles hörte sich spannend und beeindruckend an, zumal das Projekt wegen seiner einzigartigen und mutigen Ansätze in- und ausländische Medienaufmerksamkeit erregte und sogar für den Deutschen Städtebaupreis und andere Auszeichnungen nominiert war. Die Neugierde des Ehepaars war geweckt.
»Vielleicht finden wir dort unsere Heimat. Ich werde gleich die Immobilienseiten durchforsten und ein paar Makler anrufen. Was denkst du?«
»Hm.«
Clara war es gewöhnt, dass Alexander sich in solchen Situationen nicht weiter äußerte, sondern abwartete, was sie plante. Damit war er in all den Jahren ihrer Ehe gut gefahren. Es hatte ihm nicht nur viel Energie erspart, sondern auch entscheidend dazu beigetragen, dass seine Frau ihre Ehe noch immer als glücklich und harmonisch bezeichnete.
»Ich könnte mir keinen besseren Mann wünschen«, schwärmte sie gern.
Tatsächlich informierte sie ihn bereits am selben Abend, dass sie Kontakt mit Maklern aufgenommen und man ihr verschiedene Objekte angeboten habe. Doch nur eines käme in Frage.
»Das alte Forsthaus von Hermannsheide. Zwischen der Gutsanlage und dem Dorf gelegen, alles in Gehweite und sogar mit einem eigenen Wäldchen!«
Das hörte sich in der Tat attraktiv an. Alexander mochte ausgefallene Gebäude und vor allem alleinstehende Häuser auf einem großen Grundstück. Seine Privatsphäre war ihm ungeheuer wichtig. In einem Reihenhaus von der Stange mit handtuchgroßem Gärtchen oder gar in einer engen Mietswohnung meinte er, nicht leben zu können.
»Weißt du, was das Allertollste an der Sache ist?«
»Hm ...?«
»Rate mal, wo genau Hermannsheide liegt!«
»Äh ... hm ... in Deutschland?«
»Ja, natürlich in Deutschland!«, lachte sie. »Gar nicht weit von Münster entfernt. Stell dir nur vor! Dann können wir deinen Geburtsort zu besuchen! Ich habe bereits einen Hausbesichtigungstermin für kommenden Samstag vereinbart. Wenn wir wollen, können wir anschließend über Münster zurückfahren.«
»Das hast du gut gemacht.«
Er wusste zwar nicht so recht, was er in seinem Geburtsort tun und lassen sollte, hatte seine Mutter doch dort nur entbunden. Kurz darauf waren seine Eltern nach Großbritannien zurückgekehrt und nie wieder nach Deutschland gekommen. So aufregend seine Frau diesen Umstand seiner Geburt auch fand, er selbst hatte wenig Interesse und keinerlei Bezug zu der Stadt oder der Umgebung. Selbst früher, als seine Eltern noch lebten, war ihre Zeit in Deutschland nie Thema gewesen. Wenn er Clara mit dem Besuch eine Freude machte, sollte es ihm allerdings recht sein.
3Douglas und Fiona
Alexanders Vater, Douglas McGregor, war genauso schottisch, wie sein Name. Er war ausgesprochen stolz auf seine Zugehörigkeit zu dem Clan der McGregors. Alexanders Mutter Fiona hingegen entstammte dem »traditionell rabiaten und amoralischen Campbell-Clan, einer Meute Kilt tragender Mafiosi mit bekanntermaßen flexibler Auffassung von Loyalität«, wie sein Vater gern mit missbilligend herabgezogenen Mundwinkeln zu sagen pflegte.
Die McGregors nahmen für sich in Anspruch, vom ersten König der Schotten abzustammen, hatten jedoch in einem Machtkampf im 16. Jahrhundert ihr gesamtes Territorium an die bis dahin mit den McGregors eng verbündeten Campbells verloren. Hieraus entwickelte sich eine Clanfehde, die auch nach 400 Jahren noch längst nicht beigelegt war. Hochzeiten zwischen den beiden Clans kamen jahrhundertelang überhaupt nicht vor und sind bis heute äußerst selten, und so wusste Alexander: Seine Eltern verband eine wahre Liebesehe.
Seinen Vater störte dieser uralte Streit der beiden Clans von dem Moment an nicht mehr, als er Fiona erstmals sah. Sie war ein wenig größer als er und auffallend schön. Sofort verfiel er ihrer Eleganz und klassischen Schönheit, ihrer aufrechten, erhabenen, geradezu königlichen Haltung, ihren intensiven grünen Augen, ihrer hellen, ebenmäßigen von Sommersprossen übersäten Haut und ihrem hüftlangen leicht gewelltem rotblondem Haar. Aber auch ihre Klugheit und Intelligenz, ihre Schlagfertigkeit, ihre Bildung und Ihr Humor waren bemerkenswert, wie er schnell feststellen durfte.
Obwohl ihr Weg bis hin zur Eheschließung kein leichter war – beide Clans erhoben Einspruch und verboten eine Eheschließung, was eine heimliche Heirat und der darauf folgende Bruch mit ihren Familien sowie ein lebenslanges Fernbleiben der jungen Eheleute von ihren Heimatorten zur Folge hatte – wurden sie ein überaus glückliches und zugleich unkonventionelles Paar, das ihre Exzentrik und Extravaganz auslebte und diese Eigenschaften offensichtlich an ihren einzigen Sohn Alexander weitergegeben hatte.
Douglas war Major im Offizierskorps der Britischen Armee gewesen und hatte als Mitglied der Heeresgruppe unter dem Befehl von Generalfeldmarschall Montgomery in Frankreich und Deutschland gekämpft. Alexander wusste darüber nicht viel mehr, als dass sein Vater nach Kriegsende bei Münster in Norddeutschland stationiert war. Den genauen Namen des Ortes und der Kaserne hatte er sich nicht gemerkt, er wurde von seinem Vater auch nie thematisiert.
Als die Offiziere ihre Ehefrauen nachholen durften, war auch seine Mutter nach Deutschland gekommen, wo sie mit ihm schwanger wurde. Ausweislich seiner Geburtsurkunde kam er am ersten Weihnachtstag 1947 im Military Hospital in Münster zur Welt. Kurz danach, es wird im Februar oder März 1948 gewesen sein, kehrte die kleine Familie auf die Insel zurück und ließ sich wieder in Schottland nieder, allerdings in Dundee, weit entfernt von ihren Heimatorten, da ihre Familien weiterhin jeglichen Kontakt mit dem Paar ablehnten.
Unweit von Dundee erwarben sie ein kleines Farmhaus, wo sie alte Obstsorten züchteten. Fiona dachte sich für einen Teil der Ernte besondere Marmeladenrezepte aus und verkaufte ihre Produkte in hübschen Gläschen auf dem Wochenmarkt. Ansonsten waren sie in der Gemeinde aktiv, spielten Tiddlywinks und waren Mitglieder der Oxford University Tiddlywinks Society, der im Übrigen auch der berühmte Savage Club und dessen noch berühmteres Mitglied, Prinz Philipp, angehörten. Im Deutschen Flohhüpfen genannt, handelt es sich um ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem kleine runde Kunststoff-Chips durch die Luft geschnippt werden – im anglo-amerikanischen Raum ein beliebtes Wettkampfspiel, sogar mit einer professionellen Liga, die nationale und internationale Meisterschaften ausrichtete.
Außerdem schrieben beide. Douglas arbeitete an einem Cloudspotters Guide – einer Anleitung zum Wolkengucken, denn er war Mitglied in der Cloud Appreciation Society, der Gesellschaft der Wolkenwertschätzer, deren Mitglieder es genossen, absichtslos in den Himmel zu gucken und die vorbeiziehenden Wolken zu genießen. Um diesen Führer zu schreiben, erwarb Douglas extra eine sündhaft teure Remington-Schreibmaschine, nachdem er gelesen hatte, dass der von ihm verehrte amerikanische Schriftsteller Mark Twain ein Modell dieses Herstellers verwendete.
Fiona schrieb auch, weigerte sich hingegen, eine Schreibmaschine zu benutzen. Nahezu täglich saß sie an ihrem Schreibtisch und füllte eine Kladde nach der anderen mit handschriftlichen, weitgehend unleserlichen Eintragungen. Alexander hänselte seine Mutter gern damit, altmodisch zu sein, doch sie meinte nur, das müsse so sein, anders könne sie diese Geschichte nicht schreiben, wobei sie allerdings niemals über den Inhalt sprach.
Möglicherweise verherrlichte Alexander den Lebenswandel seiner Eltern, die ihr Leben nach eigenen Vorstellungen gestalteten und nichts auf die Meinung anderer gaben. Er war jedenfalls überzeugt, dass sie ausgesprochen glücklich und zufrieden waren, bis sie am Freitag, den 17. April 1964 im Alter von erst 46 und 49 Jahren bei einem Verkehrsunfall jäh aus dem Leben gerissen wurden.
Sie hatten sich auf Bitten von Alexander auf den langen Weg von Dundee nach Oxford gemacht, wo er im Begriff stand, sein erstes Trimester am Hertford College der Oxford University zu absolvieren. Beim Aufbruch aus dem Elternhaus wenige Tage zuvor hatte er in der Eile und Aufregung eine Aktentasche vergessen, in der sich Studienunterlagen befanden, die er dringend benötigte. Es war ihm peinlich, seine Eltern anzurufen und seine Nachlässigkeit einzugestehen, doch seine Mutter lachte nur entspannt und meinte, er solle sich keine Sorgen machen. Es verstünde sich von selbst, dass sie gern nach Oxford kämen, um ihm die Mappe zu bringen.
Auf der ungefähr 500 Meilen langen Fahrstrecke von Schottland nach Südengland gab es damals erst vereinzelt Autobahnabschnitte und aufgrund der Straßenarbeiten viele Umleitungen und Baustellen. Als sie den fertig gestellten Autobahnabschnitt der M74 in der Nähe von Glasgow befuhren, kam ihnen unvermittelt ein Geisterfahrer entgegen und stieß frontal mit ihnen zusammen.
Fiona wurde aus dem Auto auf die Fahrbahn geschleudert und von einem entgegenkommenden Fahrzeug überrollt. Sie war sofort tot. Douglas wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst nach Stunden von der Feuerwehr mühevoll herausgeschnitten werden. Auf der Fahrt zum Krankenhaus verstarb auch er. Der Unfallverursacher hingegen kam mit leichten Verletzungen davon.
Alexander war wenige Monaten zuvor siebzehn Jahre alt geworden und von einem Tag auf den anderen auf sich allein gestellt. Er war ein behütetes, wohl umsorgtes, ja, verwöhntes Einzelkind. Verständlicherweise hatten seine Eltern nicht mit einem so überraschenden, frühen und gemeinsamen Tod gerechnet, so dass außer einem nichtssagenden Testament, das Alexander als Alleinerben einsetzte, keine näheren Verfügungen vorhanden waren. Alexander saß in seinem Elternhaus und war gleichermaßen ratlos wie verzweifelt. Er wusste, dass es auf Seiten beider Eltern Verwandtschaft gab, doch Kontakt bestand nicht, er hatte sie nie kennengelernt. So wähnte er sich völlig allein und auf sich gestellt. Seine Freunde und die Bekannten seiner Eltern konnten ihn nur trösten, wirklich helfen konnten sie ihm nicht. Sicher war er Alleinerbe, doch schon mit einer Geldabhebung, einer Überweisung oder dem Ausstellen eines Schecks war er heillos überfordert. Auch an eine Aufnahme des Studiums war für ihn in dieser Situation nicht zu denken.
Kurz darauf wurde vom Bezirksgericht ein Vormund bestellt, der sich um ihn bis zu seiner Volljährigkeit mit einundzwanzig Jahren kümmern sollte, was sich als Glückfall für Alexander herausstellte. James Mackenzie von der Kanzlei Slater & Stewart war ein liebenswürdiger und fürsorglicher ruhiger älterer Herr mit gütigem Blick und seriösem Auftreten. Alexander fasste sofort Vertrauen. Er regelte nicht nur die Finanzen, sorgte für die Auszahlung der Waisenrente der britischen Armee und organisierte den Verkauf des elterlichen Anwesens, sondern war auch ansonsten jederzeit für Alexander da. Er ermutigte ihn, mit einem Trimester Verzögerung sein Studium der Informatik und Mathematik in Oxford aufzunehmen und sorgte dafür, dass er ohne finanzielle Sorgen studieren konnte. Das half Alexander, nicht in Trauer und Depression zu verfallen, sondern nach vorne zu blicken, sich auf seine Ausbildung und seine Zukunftsaussichten zu konzentrieren. Jedoch dauerte es Jahre, bis er den Verlust der Eltern ansatzweise verarbeitet hatte, plagte ihn doch neben dem Gefühl tiefer Einsamkeit und Verlassenheit ein ebenso heftiges wie unnötiges Schuldgefühl.
Hätte er doch die Aktenmappe nicht zuhause vergessen.
Wäre er doch bloß selbst nachhause gefahren, um sie zu holen.
Dann wäre der Unfall nicht passiert, seine Eltern würden leben.
Diese Gedanken kreisten unaufhörlich in seinem Kopf. Hinzu kam nach der Überwindung der ersten Trauerphase der wiederkehrende Gedanke, wie wenig er doch über seine Herkunft, seine Verwandtschaft, das Leben seiner Eltern vor seiner Geburt und in seinen ersten Lebensjahren wusste.
Auch seinem Vormund gegenüber sprach er von seinem Unbehagen und dem Wunsch, mehr über seine Herkunft zu erfahren. Mackenzie hatte gleich bei Mandatsübernahme versucht, Verwandte ausfindig zu machen, war jedoch gescheitert. Die beiden Großelternpaare waren seit langem tot, sein Vater hatte zwei ältere Brüder, die jedoch unverheiratet im ersten Weltkrieg gefallen waren; seine Mutter war Einzelkind wie er gewesen. Auch die obligatorische Ausschreibung an den Geburtsorten seiner Eltern, Inveraray und Campbeltown, war ohne Ergebnis geblieben.
»Alle Papiere, die für dich von Wichtigkeit sein könnten, habe ich in diesem Ordner abgelegt. Außerdem gibt es die kleine Truhe aus dem Arbeitszimmer deiner Mutter mit allen Briefen, Fotos, handschriftlichen Notizen und Kladden, die sie hinterlassen hat. Vielleicht ergibt sich daraus etwas.«
Alexander hatte alle Unterlagen sorgfältig durchgesehen, sortiert und viele Tränen darüber vergossen. Er hatte sich einiges von den Aufzeichnungen versprochen, doch die Briefe und Papiere betrafen nur die letzten wenigen Jahre vor ihrem Tod. Es gab noch einige Fotos von ihm, die meisten kannte er bereits. Die Kladden, an denen seine Mutter regelmäßig gearbeitet hatte, waren für Alexander nicht lesbar. Es schien sich um eine Art Tagebücher zu handeln, die jedoch mit Textfragmenten durchsetzt waren. Ganze Abschnitte sahen für ihn wie eine Geheimschrift aus, möglicherweise handelte es sich um eine Art Kurzschrift. Er hatte keine Idee, wie er den Inhalt entziffern könnte, es erschien ihm allerdings auch nicht so wichtig. Bisher unentdeckte Einzelheiten oder Rückblicke auf ihr früheres Leben, und seien es nur Andeutungen, hatte er nicht finden können, daher glaubte er an eine halbfertige Erzählung, vielleicht einen Roman. In einem der wenigen lesbaren Einträge klagte sie, nicht die Kraft aufzubringen, »endlich ernsthaft mit dem Buch zu beginnen«.
Obwohl Alexander überzeugt war, dass diese Unterlagen keine neuen Erkenntnisse enthielten, brachte er es nicht über das Herz, sie wegzuwerfen. Die kleine Truhe begleitete ihn sein Leben lang.
4Einzug
Das Forsthaus in Hermannsheide, das Clara als ihren neuen Lebensmittelpunkt auserkoren hatte, stammte aus dem Jahr 1910, befand sich jedoch in einwandfreiem Zustand mit guter Grundsubstanz. Vom letzten Eigentümer war es den modernen Ansprüchen, wenn auch nicht unbedingt dem Geschmack der McGregors, angepasst worden. Es verfügte über ein fast neuwertiges Dach, isolierte Wände, moderne Fenster mit Doppelverglasung und eine neuwertige Gasheizung, sah aber von außen noch angenehm urig und ursprünglich aus.
Vor allem die idyllische Lage und die geradezu herrschaftliche Anmutung der Zufahrt waren unübertrefflich: Das Haus lag in einem eigenen Tannenwäldchen, dessen sicher zweihundert Meter lange mit Kies versehene Auffahrt vor dem Hauseingang kreisförmig um einen riesigen verwitterten Steinbrunnen führte.An der Vorderfront war das Haus ab dem ersten Stockwerk mit Holz verkleidet, am Hausgiebel prangte eine Holzschnitzerei mit der Inschrift Tannenhof – ein wirklich passender Name. Hinter dem Haus erstreckte sich ein hübscher, leicht verwilderter Garten sowie eine Streuwiese. Ansonsten gab es auf dem riesengroßen Grundstück mehrere Schuppen und kleine Nebengebäude, die es zu entdecken galt.
Bald konnten sie sich nicht mehr vorstellen, woanders zu leben. Hier und nirgends anders, so waren sich beide sicher, wollten sie alt werden. Keine 200 Kilometer westlich von Hermannsheide, wo sie an der niederländischen Küste gewohnt hatten, wäre ein solches Anwesen für sie unerschwinglich gewesen. Entsprechend groß waren ihre Freude und ihre Entschlossenheit, aus dem Haus ein Schmuckstück zu machen. Sie hätten nach einer kurzen Renovierung einziehen können, allerdings den im Innenbereich herrschenden Charme der 1970er Jahre beibehalten müssen. Sie entschlossen sich, ihre gesamten Ersparnisse zu investieren und eine Hypothek aufzunehmen, um das Haus ganz nach ihrem eigenen Geschmack umzubauen.
Die Renovierungsarbeiten zogen sich beinahe zwei Jahre hin. Nach dem Hauskauf hatte Alexander seine berufliche Tätigkeit beendet und war einstweilen alleine nach Hermannsheide gezogen, während Clara noch beruflich in Den Haag verpflichtet war. Unter der Woche war er auf sich alleine gestellt und widmete sich voll und ganz dem Umbau, die Wochenenden und Urlaube verbrachten sie gemeinsam in ihrer neuen Heimat, wo Haus und Garten langsam aber sicher die Gestalt annahmen, die sie sich wünschten. Zwei Jahre führten sie eine Wochenendbeziehung, bis es soweit war, dass Clara pensioniert wurde und die kleine Wohnung in der Nähe ihrer Arbeitsstelle aufgeben konnte, um ganz nach Hermannsheide zu ziehen.
Noch fehlten den McGregors soziale Kontakte vor Ort. Sie hatten zwar mit großem Interesse die vielfältigen Aktivitäten zur Belebung des kleinen Ortes verfolgt, aber wenig Zeit und Möglichkeit gehabt, sich aktiv einzubringen. Die Gutsanlage war weitgehend fertiggestellt, alle Wohnungen, Ladengeschäfte und Gewerbeflächen waren besetzt. Ein ländlicher Gasthof mit Biergarten, eine Bäckerei mit Café, ein kleiner Kolonialwarenladen im historischen Stil, ein Friseur, ein Physiotherapeut und ein Hausarzt hatten sich angesiedelt; im Handwerkerhof waren die ersten Meisterfachbetriebe eingezogen und im hinteren Bereich der Stallungen befanden sich ein kleiner Reiterhof und eine Hundepension. Derzeit waren im Außenbereich des Gutsbezirks umfangreiche Arbeiten im Gange; unter anderem sollte in dem bislang naturbelassenen kleinen Moor- und Heidegebiet in der Nähe des Herrenhauses ein Park mit einem großen Teich entstehen.
Sowohl im Gutsbezirk als auch im Dorf herrschte bereits ab den frühen Morgenstunden reges Treiben. Wie früher erledigten die Menschen ihre Besorgungen beim Bäcker, im Dorfladen, am Kiosk oder gingen zur Arbeitsstelle, zum Arzt, zum Friseur. Schulkinder liefen von der Bushaltestelle zu ihrem neuen Schulgebäude um die Ecke. Erst kürzlich hatte die Grundschule wiedereröffnet, nachdem sie vor über zwei Jahrzehnten wegen Kindermangels ihre Pforten schließen musste. Nun waren alle Klassen gut besetzt.
Junge Familien waren bevorzugt angesiedelt worden, doch es gab auch viele ältere und alte Leute in Hermannsheide. Der demografische Wandel machte hier keine Ausnahme. So sah man neben den Kindern und jungen Familien zahlreiche ältere Herrschaften auf der Straße, ob noch gut zu Fuß, auf dem Fahrrad, mit Rollator oder per Elektromobil. Die meisten von ihnen strebten zum Gutshaus, wo sich eine »Tagesbetreuung für Senioren und Kinder« niedergelassen hatte.
Dieses generationenübergreifende Projekt genoss besondere Aufmerksamkeit in den Medien, versuchte man doch mit einem neuartigen Konzept, Alt und Jung zusammenzubringen. Die Senioren und die Kinder hatten zwar getrennte Bereiche und jeweils eigene Ruheräume, doch es gab eine große Halle, der beide Zonen miteinander verband und in dem gemeinsam gegessen, geplaudert, musiziert, Musik gehört, Sport getrieben oder gespielt wurde. Im Sommer öffneten sich die großen Schiebetüren hin zum gemeinsamen Außenbereich, der sowohl über einen großen Abenteuerspielplatz als auch einen Seniorenparcours verfügte und viele Sitzmöglichkeiten im Schatten von Kastanienbäumen bot.
Alexander und Clara hatten damit begonnen, ab und zu in dem Café auf dem hübschen Dorfplatz zu frühstücken, wo sie sich an sonnigen Tagen am liebsten an einen der runden Tische setzten, ihren Milchkaffee schlürften und Croissants aßen.
»Wie in Frankreich!«
Die auf dem Dorfplatz frisch angepflanzten Bäumchen würden wachsen und eines Tages zu mächtigen, schattenspendenden Bäumen werden und die Illusion südlicher Lebensart vervollkommnen. Französisches Savoir-vivre in Nordwestdeutschland – wer hätte das gedacht! Das war ganz nach Claras und Alexanders Geschmack, die sich wie im Dauerurlaub fühlten. Während sie so ihren Gedanken nachhingen, trat plötzlich ein Mann an ihren Tisch, klopfte mit den Knöcheln seiner zur Faust geballten rechten Hand zweimal auf die Tischplatte und ließ ein kurzangebundenes »Moin« vernehmen.
Sie erinnerten sich nicht, ihn je gesehen zu haben und wussten nicht so recht, wie sie reagieren sollten.
»Guten Morgen«, erwiderte Clara ganz spontan. »Ist das nicht ein wundervoller Tag heute? Was meint denn der Wetterbericht?«
Der Mann beachtete sie nicht, sondern fixierte Alexander.
»Sind Sie der Engländer?«
»Gott bewahre, natürlich nicht!«, empörte sich Alexander in gespieltem Ernst. Das war seine Standardreaktion, wenn jemand Großbritannien mit England und die Schotten mit den Engländern verwechselte.
»Ich bin Schotte, mit den Engländern habe ich am liebsten nichts zu tun!«
Spätestens an dieser Stelle lachten die Menschen normalerweise, aber der Fremde verzog keine Miene.
»Sind Sie zu Besuch oder leben Sie jetzt hier?«
Alexander fixierte den Fremden.
»Äh, möchten Sie sich nicht zuerst vorstellen, bevor Sie mir so viele Fragen stellen? Wir sind uns doch noch nicht begegnet, oder?«
Der Mann blickte sich unruhig um, strich sich hilflos durchs Haar und murmelte etwas Unverständliches. Schließlich drehte er sich abrupt um und ging rasch davon. Clara und Alexander sahen sich verdutzt an.
»Was war das denn?« Clara lachte kopfschüttelnd.
»Was für ein seltsamer Typ. Kennst du ihn?«
»Nein, nie gesehen. Keine Ahnung, was er wollte.«
5Bußmann und seine Freunde
An einem anderen Tag – an diesem Morgen war es regnerisch, und sie saßen im Inneren des kleinen Cafés – machten sie die Bekanntschaft gleich einer ganzen Gruppe von Einheimischen. Drei Frauen und zwei Männer ungefähr ihres Alters saßen am Nebentisch und unterhielten sich angeregt. Es wurde viel gelacht und gescherzt. So blieb es nicht aus, dass Clara und Alexander immer wieder hinüberblickten und bei manch ansteckendem Gelächter mitlächelten.
»Sympathische Truppe«, flüsterte Alexander. »Ob die alle hier am Ort leben?«
Sie bemerkten, dass auch die Gruppe plötzlich miteinander tuschelte und verstohlene Blicke zu ihrem Tisch warf. Bald rief einer von ihnen, ein Mann mit auffallend störrischem, ehemals rot-braunem und nun weißen Strähnen durchgezogenem Haar und hagerer, schlaksiger Figur zu ihnen hinüber:
»Guten Morgen! Sagen Sie, sind Sie nicht die neuen Nachbarn, die den Tannenhof gekauft haben?«
Sie hatten die Frage kaum bejaht, da wurden sie schon eingeladen, sich doch zu der Gruppe zu gesellen. Das taten sie gern, und nach etwas Stühlerücken war genügend Platz geschaffen, um sich dazu zu setzen. Man stellte sich gegenseitig vor – da sich alle sogleich ganz selbstverständlich duzten, beschränkten sie sich auf ihre Vornamen Hajü, Doro, Carsten, Angelika und Renate.