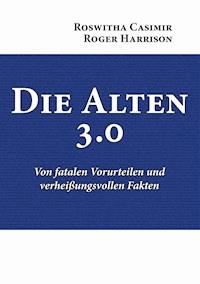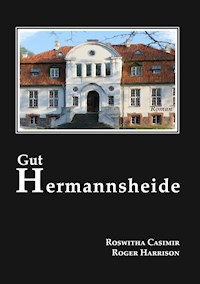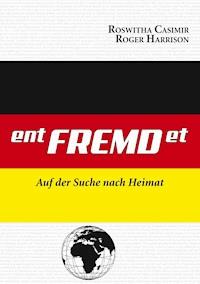
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch widmet sich der Heimat und all jenen, die auf der Suche nach einer Heimat sind. Es geht um Menschen, die, aus welchen Gründen auch immer, ihren Geburts- oder langjährigen Wohnort verlassen und die Erfahrung der Heimatlosigkeit machen müssen. Und es geht um Menschen, die sich von ihrer Heimat entfremdet fühlen. Das Gefühl der Entfremdung betrifft neben Migranten und Landsleuten, die im eigenen Land ihren Lebensmittelpunkt wechseln, viele Menschen, die ein Fremdheitsgefühl zu ihrem Land entwickelt haben, sich als Fremde im eigenen Land fühlen. Mit der Flüchtlingskrise seit 2015, die uns mit hunderttausenden Zuwanderern konfrontierte, rückte die Frage des Zusammenlebens mit Fremden, sprich: die Integration von Menschen aus fremden Kulturkreisen, verstärkt in den Fokus. Aber auch zahlreiche andere Gruppen suchen eine neue Heimat. Sie können Landsleute sein, die in ein anderes Bundesland oder eine Ortschaft ziehen, sie können sich aber auch aus anderen Gründen entfremdet fühlen. Nicht selten wird gerade als Grund für die Entfremdung vom eigenen Land der Umstand der vermeintlichen Überfremdung Deutschlands durch die unkontrollierte Aufnahme zu vieler Flüchtlinge gemacht. Das Buch will durch Information zur Reflektion anregen und mögliche Auswege aufzeigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Prolog
Vorwort
Kleines Glossar
Ausländer
Der Fremde – die Fremde – das Fremde
Mentalität
Nation, Staat, Volk, Staatsvolk
Rasse, Ethnie, Population
Heimat
Herkunftsland, Heimatland, Vaterland
Vaterlandsliebe, Nationalstolz, Patriotismus
Nationale Identität, Nationalismus, Ethnozentrismus
Migration, Einwanderung, Zuwanderung
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie
Integration, Assimilierung, Einbürgerung
Leitkultur, Deutschtum
Muslime und Islam
Deutschland und die Deutschen
Was bedeutet deutsch?
Wer sind die Deutschen und ihre Vorfahren?
Seit wann existiert Deutschland?
Die Deutschen – ein Volk?
Die moderne deutsche Nation
Nationale Identität
Nationalflagge
Nationalhymne
Kulturnation, deutsche Kultur und Leitkultur
Deutschtum – Deutschtümelei
»Biodeutsche« und »Passdeutsche
«
Hugenotten
Ruhrpolen
Vertriebene und Aussiedler
Saarländer
Ethnische Minderheiten in Deutschland
Volksgruppe der Friesen
Sinti und Roma
Sorben
Dänische Minderheit
»
Ausländische Mitbürger«
Gastarbeiter
Boatpeople
EU-Ausländer
Überraschung? Die Deutschen als Migranten
Auswanderungswellen
Deutsche im Ausland
Deutschsprachige Minderheiten
ent
FREMD
et
Heimat Deutschland
Gesellschaftliche Situation
Wohlstandsgesellschaft Deutschland?
Die Wiedervereinigung und ihre Folgen
Einwanderungsland Deutschland
Einwanderungsgesetz und Zuwanderungsgesetz
Flüchtlingskrise
Migranten und Migrationshintergrund
Ist der Islam schuld, wenn Integration nicht klappt?
Sichtweisen
Sicht von Politik und Wissenschaft
Sicht der Deutschen
Sicht der Migranten
Schlusswort
Literatur
PROLOG
Heimatlos
Wir ohne Heimat irren so verloren
und sinnlos durch der Fremde Labyrinth.
Die Eingebornen plaudern vor den Toren
vertraut im abendlichen Sommerwind.
Er macht den Fenstervorhang flüchtig wehen
und läßt uns in die lang entbehrte Ruh
des sichren Friedens einer Stube sehen
und schließt sie vor uns grausam wieder zu.
Die herrenlosen Katzen in den Gassen,
die Bettler, nächtigend im nassen Gras,
sind nicht so ausgestoßen und verlassen
wie jeder, der ein Heimatglück besaß
und hat es ohne seine Schuld verloren
und irrt jetzt durch der Fremde Labyrinth.
Die Eingebornen träumen vor den Toren
und wissen nicht, daß wir ihr Schatten sind.
Max Herrmann-Neiße (1886–1941)
Fremd im eigenen Land
Ich habe einen grünen Pass mit ‘nem goldenen Adler drauf
Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf
Jetzt mal ohne Spaß: Ärger hab‘ ich zuhauf.
…
Das Problem sind die Ideen im System
Ein echter Deutscher muss auch richtig Deutsch aussehen
Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr
Gab‘s da nicht ‘ne Zeit, wo‘s schon mal so war?
…
Politiker und Medien berichten, ob früh oder spät
Von einer überschrittenen Aufnahmekapazität
Es wird einem erklärt, der Kopf wird einem verdreht
Dass man durch Ausländer in eine Bedrohung gerät
Somit denkt der Bürger, der Vorurteile pflegt
Dass für ihn eine große Gefahr entsteht
…
Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land
Kein Ausländer und doch ein Fremder
…
Ausschnitt aus einem Song von Advanced Chemistry, einer 1987 gegründeten
Heidelberger Hip-Hop-Gruppe. Die zentralen Themen der Gruppe waren
politisch motiviert und drehten sich wiederholt um ihre Identität als
Deutsche ausländischer Herkunft.
Im Herbst 1992, kurz nach den rassistischen Pogromen in
Rostock-Lichtenhagen, erschien »Fremd im eigenen Land«.
VORWORT
Wir wollen in diesem Buch von Heimat sprechen.
Von Heimat und Daheim sein, von dem Ort, wo wir herkommen, wo wir Wurzeln geschlagen haben und wo wir hingehören, wo wir uns aufgehoben und aufgefangen erleben, wo wir angenommen sind. Von einem Lebensort, in dem wir nicht nur zu Hause sind, sondern uns auch zu Hause fühlen.
Wir wollen von Menschen sprechen, die auf der Suche nach einer neuen Heimat sind.
Von Menschen, die – aus welchen Gründen auch immer – ihren Geburts- oder langjährigen Wohnort verlassen müssen oder wollen. Mit der Flüchtlingskrise seit 2015, die uns mit hunderttausenden von Zuwanderern konfrontierte, rückte die Frage des Zusammenlebens mit diesen Fremden, sprich: die Integration von Menschen aus fremden Kulturkreisen, verstärkt in den Fokus.
Weltweit leben mehr als 210 Millionen Menschen in einem Staat, der nicht ihre ursprüngliche Heimat ist. Sie stammen aus anderen, meist fernen Kulturkreisen und wurden verfolgt, wollten einem Kriegsgeschehen oder wirtschaftlicher Not entkommen.
Aber auch andere Gruppen suchen eine neue Heimat. Sie mögen aus einem Nachbarland kommen, das wir wegen ähnlicher Kultur und Sprache gar nicht als »richtiges« Ausland empfinden. Sie können sogar Landsleute sein, die in ein anderes Bundesland oder eine Ortschaft ziehen. Da auch sie ihren bisherigen Lebensmittelpunkt verlassen und ihren neuen Lebensmittelpunkt an einen anderen Ort suchen, vereint sie ein Problem mit den Migranten: Die Suche nach einer neuen Heimat.
Sie alle – ob von fern oder nah, aus demselben oder einem anderen Kulturkreis, aus dem eigenen oder einem anderen Land stammend – müssen in einer fremden Gesellschaft heimisch werden, mit dem letztlichen Ziel, von dieser Gesellschaft akzeptiert und als jemand wahrgenommen zu werden, der zwar nicht eingeboren, aber eingewöhnt ist und dazu gehört.
Wir wollen von Entfremdung sprechen.
Das Gefühl der Entfremdung betrifft noch mehr Menschen: Neben den Migranten und den Landsleuten, die im eigenen Land ihren Lebensmittelpunkt wechseln, gibt es eine Reihe anderer Gründe, warum wir ein Fremdheitsgefühl zu unserem Wohnort oder auch unserem Land empfinden und uns nicht zuhause fühlen.
Dieses Vermischen von Verfolgten, Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen mit jenen, die aus vergleichsweise belanglosen Gründen mehr oder minder freiwillig innerhalb ihres Kulturkreises umziehen und dazu noch mit jenen, die sich aus ganz anderen Gründen von ihrem Heimatland entfremdet haben, mag Sie vielleicht irritieren. Doch tatsächlich ist unsere Epoche auch jenseits von Krieg, Vertreibung und Flucht zu einem Zeitalter der Heimatlosen geworden.
Die Erfahrung der Heimatlosigkeit müssen nicht wenige sogar schon in frühester Kindheit machen: Wenn die Eltern aus beruflichen oder privaten Gründen von einer Stadt in eine andere ziehen, wenn sie vielleicht auswandern – die Kinder müssen meist mit, sie haben kein Wahlrecht und können sich nicht dagegen wehren. Auch aus anderen Gründen kann das Elternhaus verloren gehen: Rund 50 Prozent aller Ehepaare lassen sich heutzutage scheiden, was ein Indiz für eine hohe Anzahl von Minderjährigen ist, die in der Folge mit einem neuen Lebensumfeld, oft genug einem Umzug, konfrontiert sind. Nach der Pressemitteilung Nr. 237 des Bundesamts für Statistik vom 11. Juli 2017 betrug die Anzahl der minderjährigen Kinder in Deutschland im Jahr 2016 ungefähr 13,31 Millionen. Davon waren allein in dem genannten Jahr 131.955 Kinder von einer Ehescheidung betroffen.
Die Globalisierung tut ein weiteres: Auf der Suche nach bestmöglicher Ausbildung wachsen Kinder in auswärtigen Internaten auf, studieren in fremden Städten, absolvieren ein Auslandsjahr oder Praktikum und stehen schließlich quasi weltweit als Arbeitskräfte zur Verfügung. Auch privat reisen wir alle viel, lernen die Welt – vielleicht sogar unseren Lebenspartner – im Ausland kennen.
Heimat kann jeder haben, der einen Anspruch darauf erhebt. Heimat taucht als Begriff vorzugsweise dann auf, wenn Heimat verschwunden ist. Die einzigen, die das Bedürfnis nach Heimat nach eigener Aussage nicht betrifft, sind die so genannten Kosmopoliten – Weltbürger, die überall zuhause sind und den gesamten Erdball oder zumindest die Länder und Landstriche als ihre Heimat betrachten, in denen sie gerade lebten.
Doch ist Heimat tatsächlich immer dort, wo man gerade lebt und arbeitet? Bedeutet Heimat nicht zwingend, in eine lang vertraute Gemeinschaft eingebunden zu sein? Kann man mehrere oder gar beliebig viele Heimaten(1) haben? Oder sind wir in den Zeiten der Globalisierung zu entwurzelten Wesen geworden, die keine Heimat benötigen, weil sie auf anderen Gebieten nach Gemeinschaft mit Gleichgesinnten suchen, die Geborgenheit vermitteln und Vertrauen bieten? Fühlen wir uns vielleicht bei der Abwesenheit von Heimat sogar wohl, weil wir den Begriff nur noch als überkommenes, unzeitgemäßes Schlagwort betrachten?
An dieser Stelle müssen wir Autoren gestehen, dass wir zum Heimatbegriff unterschiedlicher Meinung sind:
Roger Harrison, in Deutschland geborener Schotte mit deutschem Pass, der in den USA aufwuchs, in Malaysia, Großbritannien und den Niederlanden sein Berufsleben verbrachte und seit knapp 15 Jahren in Deutschland lebt, hält es mit der typisch britischen Maxime My home is my castle (wörtliche Übersetzung: Mein Heim ist meine Burg). Er versichert überzeugend, dass sein jeweiliger Wohnsitz Lebensmittelpunkt und sein persönliches Refugium – also seine Heimat – sei. Und dass er weder seinem Elternhaus noch dem Geburtsort nostalgische Heimatgefühle entgegenbringe – und diese auch nicht vermisse.
Bei dem oft zitierten Sprichwort handelt es sich übrigens ursprünglich um einen britischen Rechtsgrundsatz, wonach es den Behörden und ihren Organen untersagt war, willkürlich in Privatwohnungen einzudringen. Das Sprichwort selbst geht auf den englischen Juristen und Politiker Sir Edward Coke (1552–1634) zurück. Im 3. Band seiner Sammlung Institutes of the Lawes of England(2), einer Interpretation alter englischer Rechtsmeinungen, Gesetzestexte und Gerichtsbeschlüsse schrieb er, dass es einem Hausherrn gestattet sein müsse, sich gegen Diebe, Räuber und Angreifer zur Wehr zu setzen und zusammen mit Freunden und Nachbarn seinen Besitz mit Waffengewalt zu verteidigen, for a man‘s house is his castle (… denn eines Mannes Haus ist seine Burg). Der Satz wurde in der Form An Englishman‘s home is his castle populär und fand in der späteren Abwandlung My home is my castle auch im Deutschen Verbreitung, allerdings mit einer etwas anderen Bedeutung als im Original. Deutsche zitieren den Satz, um zum Ausdruck zu bringen, dass alles, was in den eigenen vier Wänden geschieht, niemanden etwas angehe, im Sinn von Daheim bin ich König. Die Briten drücken damit aber vorrangig aus, dass ihre Heimat dort ist, wo ihr Heim steht und dieses Heim für andere tabu sei, sie also alleiniges Verfügungsrecht beanspruchen.
Roswitha Casimir hingegen hat französisch-russische Wurzeln und ist im Rheinland geboren. Ihre Sichtweise zum Thema Heimat ist ganz anders. Die ersten neun Lebensjahre verbrachte sie in Koblenz und die weitere Schulzeit in Bayern. Dann studierte sie in München, wo sie auch ihren ersten Arbeitsplatz fand, bevor sie langjährig in der Türkei und den Niederlanden lebte und arbeitete. Sie erinnert sich bis heute an den für sie lange Zeit schmerzlich empfundenen Heimatverlust im Alter von neun Jahren, als die Mutter 1961 nach München zog und sie in ein oberbayerisches Internat kam. Sie war sich des Heimatverlusts besonders dann bewusst, wenn sie ihre Schulferien bei den Großeltern in ihrem Geburtsort oder den Onkeln und Tanten in Frankreich verbringen durfte. Für sie waren diese Orte Heimat und Sehnsuchtsorte. Heimweh begleitete sie bis ins frühe Erwachsenenalter.
Als Erwachsene, mit Ehemann, Tochter, Beruf und häufigem Wohnsitzwechsel lebte die Autorin tatsächlich quasi das Leben einer Globetrotterin; die Familie war ihr Lebensmittelpunkt, ein spezieller Heimatort fehlte nicht mehr. Ihre eigene kleine Familie war ihr Heimat, der jeweilige Wohnsitz ihr Nest, ihre Burg.
Im fortgeschrittenen Alter änderte sich ihr Heimatgefühl erneut: Immer stärker wurde ihr bewusst, dass sie bei jedem Wohnsitzwechsel stets einen Teil ihrer sozialen Beziehungen zurückgelassen hatte. Unwiederbringlich, wie ihr mittlerweile klargeworden ist. Wenn sie Berichte über ihre Heimatstadt sieht oder liest oder in der Nähe vorbeifährt, klopft ihr Herz und die Erinnerungen an ihre Kindheit werden lebendig. Doch die Großeltern sind längst verstorben, ihr Geburtshaus existiert nicht mehr, einen weiteren engen Bezugspunkt am Geburtsort gibt es nicht. Ähnlich verhält es sich mit den französischen Verwandten, zu denen der Kontakt mit der Zeit abbrach. Es wird ihr zunehmend bewusst, dass Freunde und Bekannte die Familie genauso wenig ersetzen können, wie die beste Freundin aus der Pubertät, und all die Schul- und Studienfreunde oder Arbeitskollegen. Und dass es mit den Jahren immer schwieriger wird, einen echten Freundeskreis aufzubauen, der Geborgenheit, Akzeptanz und gegenseitiges Verständnis vermittelt.
Heimat ist also kein Ort, sondern ein Gefühl?
Was müssen all die tun, die ihre Heimat verloren oder freiwillig aufgegeben haben und (trotzdem) auf der Suche nach einer neuen sind? Welche Voraussetzungen müssen sie erfüllen, um auf dem neuen Kontinent, in dem neuen Land, in der fremden Stadt, mit einem Wort an ihrem neuen dauerhaften Lebensmittelpunkt, als vollwertige Mitbürger anerkannt zu werden, um »dazuzugehören«?
Was also sind die Kriterien für nationale Zugehörigkeit und Identität? Was müssen Migranten leisten, um in Deutschland als Deutsche zu gelten, in den USA als Amerikaner, in Kanada als Kanadier, in der Schweiz als Schweizer…?
Welche Sicht haben Einheimische auf Zuwanderer, sei es aus dem Ausland, aber auch innerhalb Deutschlands? Welchen grundsätzlichen Blick hat Deutschland auf Zuwanderung?
Sie werden sich nun vielleicht – nach einem Blick auf das Inhaltsverzeichnis dieses Buchs – fragen, warum wir nicht bei diesen schon vielfältigen Themen bleiben, sondern auch noch der deutschen Geschichte, den Deutschen und den Migranten einen großen Raum geben, wenn es sich doch unter dem Schirm der Globalisierung um ein weltweites Phänomen handelt.
Dies geschieht ganz bewusst, weil wir uns mit unseren Gedanken vorrangig an ein deutsches beziehungsweise in Deutschland lebendes Publikum wenden. Entfremdet kann sich jeder fühlen, der seine Heimat aus welchen Gründen auch immer verlässt. Doch das individuelle Verhalten, die Einstellungen, Gedanken und Erwartungen der Menschen sind sehr unterschiedlich, genauso wie die Aufnahmeländer stark abweichende Voraussetzungen bieten. Dies wird unter anderem deutlich, wenn wir uns einige der – leider relativ seltenen – wissenschaftlichen Umfragen ansehen, die zu diesem Thema die Verhältnisse in verschiedenen Ländern untersuchen und vergleichen.
So hat das US-amerikanische Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center im Frühjahr 2015 eine internationale Studie über nationales Selbstverständnis vorgelegt. Die Forscher befragten über 14.000 Personen in vierzehn Ländern zu dem Zusammenhang von nationaler Identität mit den folgenden vier Aspekten: dem Geburtsort, dem Beherrschen der jeweiligen Landessprache, der Teilhabe an den landestypischen Sitten und Gebräuchen sowie der Religionszugehörigkeit.
Demnach ist eine Mehrheit der weltweit Befragten der Meinung, um als Einheimischer zu gelten, sei nicht Voraussetzung, in dem jeweiligen Land geboren zu sein. Nur 13 Prozent der befragten Deutschen äußerten die Meinung, dass der Geburtsort maßgeblich für die nationale Identität sei. Das ist deutlich weniger als der europäische Durchschnitt von 33 Prozent. Weltweit ist eine deutliche Mehrheit der Ansicht, die Sprache zu sprechen und sich an landestypischen Bräuchen und Traditionen zu beteiligen, sei maßgeblich für die nationale Identität, während sich bei der Frage nach der Religion ein differenzierteres Bild ergibt: Rund ein Drittel der Amerikaner setzt den christlichen Glauben voraus, 54 Prozent der Griechen meinen, ein echter Grieche müsse orthodoxen Glaubens sein, während in Schweden nur 7 und in Deutschland 11 Prozent die Religion mit der nationalen Identität verbinden.
Die Studie Deutschland postmigrantisch der Humboldt Universität Berlin von 2014, in Deutschland eine der bislang größten Umfragen zu Migration und Integration, bei der 8.270 Personen befragt wurden, kommt zu teilweise anderen Ergebnissen. Deutschsein ist aber auch bei dieser Befragung für die meisten Bundesbürger nicht unbedingt eine Frage der Abstammung und kann sogar »erlernt und erworben werden«. Dabei steht als Kriterium für das Deutsch-Sein die Sprache an erster Stelle: 97 Prozent der Befragten äußerten die Meinung, deutsch sei, wer deutsch sprechen könne. 40 Prozent verlangen sogar ein akzentfreies Deutsch. Am zweithäufigsten (79 Prozent) wurde der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit genannt.
Immerhin 37 Prozent meinten jedoch, ein Deutscher müsse zwingend deutsche Vorfahren haben. Das wird auch dadurch unterstrichen, dass im täglichen Leben Menschen mit ausländischem Namen oder anderer Hautfarbe regelmäßig und fast zwangsläufig nach ihrer Herkunft gefragt werden. Zugleich förderte die Untersuchung weitere Ressentiments zutage, besonders gegenüber Muslimen. So gaben 38 Prozent an, wer ein Kopftuch trage, könne nicht Deutsch sein.
Die Frage »Was macht jemanden zum Amerikaner, Briten, Deutschen?« wird also in den einzelnen Ländern durchaus unterschiedlich beantwortet. Doch die Studien brachten auch eine handfeste Überraschung: Ob jemand in einem Land geboren wurde oder nicht, spielt in der Debatte um nationale Identität für die Mehrheit der Befragten eine mehr oder minder nachgeordnete Rolle – und das unabhängig von den Nationalitäten der Befragten und von den unterschiedlichen Staatsbürgerschaftsgesetzen in den Vereinigten Staaten und Europa.
Speziell zur Sprachproblematik gibt es eine andere, noch aktuellere Studie von Pew Research aus dem Jahr 2017, die allerdings nur in den USA durchgeführt wurde. Die USA verzeichnen mehr Zuwanderer als jedes andere Land der Welt. Dort leben heute mehr als 43 Millionen Menschen, die in einem anderen Land geboren wurden. Von ihnen spricht nur etwas mehr als ein Drittel (35 Prozent) sehr gutes Englisch, während 49 Prozent über keine nennenswerte Sprachkenntnis verfügt. Da auch Migranten aus englischsprachigen Ländern, wie Kanada oder Großbritannien inbegriffen sind, haben noch weniger Menschen die englische Sprache tatsächlich erlernt.
In Deutschland wird die Wichtigkeit der Sprache deutlich höher eingeschätzt. Nach dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind gute Deutschkenntnisse unerlässlich für die Integration von Zuwanderern. Die Sprache bilde einen zentralen Aspekt und könne als Maßstab der Integration von Migranten in die Aufnahmegesellschaft betrachtet werden, Deutschkenntnisse seien sogar ein Kennzeichen für den Stand der Integration.
Erstaunlicherweise gibt es über die Deutschkenntnisse von erwachsenen Migranten trotzdem keine belastbaren Daten. In der amtlichen Statistik gibt es keine Datenquelle, die über Sprachkenntnisse der ausländischen Bevölkerung oder der Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland Auskunft geben könnte. So enthält beispielsweise der Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes keine Fragen und Angaben zu Sprachkenntnissen. Die wenigen erfolgten Studien beruhen zudem einzig auf Selbsteinschätzung der Befragten und sind oft veraltet.
Die letzte Repräsentativbefragung ausgewählter Migrantengruppen (RAM) ist über zehn Jahre alt. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) Nürnberg und das Sozioökonomische Panel (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) führen daneben gemeinsam mit TNS Infratest stichprobenartige Befragungen von Migranten und ihren Nachkommen in Deutschland durch. In der Umfrage von 2014 gaben nach dem IAB-Kurzbericht 21/2014 rund 12 Prozent der Teilnehmer an, dass sie bereits gut oder sehr gut Deutsch sprachen, als sie nach Deutschland gezogen sind. Von denjenigen, die bereits mehr als zehn Jahre in Deutschland leben, schätzten knapp 63 Prozent ihre Deutschkenntnisse als gut oder sehr gut ein.
Wie funktioniert es genau, sich als Zuwanderer von nah oder fern in die »neue Heimat« zu integrieren? Wenn nationaler Zusammenhalt, sprich: Integration des Einzelnen, auf gemeinsamen historischen Erfahrungen, auf kulturellen Orientierungen und hinsichtlich des Nationalstaats auf einer gemeinsamen Rechtsordnung beruht, wie können wir das von »neu Hinzugekommenen« erwarten? Sind nicht vielleicht erst spätere Generationen dazu in der Lage, wenn solche Wege gemeinsam gegangen und identische Erfahrungen gemacht worden sind?
Integration ist ein überaus differenzierter Prozess des Zusammenfügens und Zusammenwachsens, umfasst also nicht allein die Anpassung an die Werte der Gesellschaft durch die Migranten, sondern gleichermaßen die Einbeziehung in die Gesellschaft – und kann damit von den Einwanderern alleine gar nicht bewältigt werden. Ganz vereinfacht gesagt: Menschen, die von der Gesellschaft nicht als ihresgleichen akzeptiert und vorurteilsfrei aufgenommen werden, können sich gar nicht integrieren.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen wir uns intensiver mit Heimat beschäftigen, einem im Deutschen auch im Zusammenhang mit Integration gern und oft benutzten Begriff. Will man ihn in wenigen Worten definieren oder gar in eine andere Sprache übersetzen, gibt es Probleme. Ein Blick in diverse Wörterbücher zeigt, dass es eine Eins-zu-eins-Übersetzung in andere Sprachen nicht gibt. Das englische homeland oder home country trifft die deutsche Bedeutung genauso wenig wie das lateinische patria, das Ursprung der französischen, italienischen, spanischen und portugiesischen Bezeichnungen ist. Am ehesten beziehen sie sich auf das Vaterland, in dem man geboren wurde. Homeland lässt sich beispielsweise eher als Gegenbegriff zur Kolonie verstehen, was aus dem britischen Kolonialisierungszeitalter herrührt. Der deutsche Heimatbegriff indes beinhaltet eine Sinnvielfalt, die in all diesen Übersetzungen nicht enthalten ist.
Zur Klärung dieser Fragen gehört auch die Klarstellung, unter welchen Umständen ein Ort, eine Region, ein Land, zur Heimat wird. Was beispielsweise ist die Heimat einer Frau, die französisch-russische Wurzeln hat, in der Nachkriegszeit in Rheinland-Pfalz geboren wurde, in Bayern zur Schule ging, in Frankreich, der Türkei, den Niederlanden lebte, studierte und arbeitete und sich – nach ihrer Pensionierung – im niedersächsischen Nordwesten niedergelassen hat? Oder: Wird ein Schotte, der in Deutschland geboren wurde, aber fast sein ganzes Leben in den USA, England, Malaysia und den Niederlanden, lebte, mit dem Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft ein »echter Deutscher«?
Diese Fragen stellen wir uns hinsichtlich unserer eigenen Lebensgeschichten, aber auch angesichts der zahllosen Menschen, die einst nach Deutschland kamen, genauso wie jenen, die Deutsche sind, sich in Deutschland jedoch als heimatlos empfinden.
Wenn wir bei Diskussionen mit Freunden und Bekannten zu diesem Thema gelegentlich einwerfen: »Wir haben selbst einen Migrationshintergrund«, kommt regelmäßig der Einwurf: »Aber das ist doch etwas Anderes. Ihr seid doch gar nicht gemeint!« Dabei sind wir genauso auf der Suche nach einer Heimat wie die Gastarbeiter der Nachkriegszeit, die Migranten aus Russland oder Afrika, die Kriegsflüchtlinge aus Afghanistan oder Syrien oder die Asylbewerber aus Pakistan. Die Reaktion der Menschen zeigt die in dem Wort Migrationshintergrund enthaltene Wertung und deckt unser Anliegen auf, warum wir uns tiefer in dieses Thema eingearbeitet und schließlich dieses Buch geschrieben haben.
Suche nach Identität und Heimat ist keineswegs nur ein Problem von Migranten und Zugereisten aus anderen Kulturkreisen. Permanente Mobilität muss nicht, aber kann ebenfalls heimatlos machen. Dem realen Heimatverlust migrierender Massen steht der geistige Heimatverlust einer unbekannten Anzahl driftender Individuen gegenüber: Entwurzelt, entfremdet, entortet – und auf der Suche nach neuer Zugehörigkeit und Geborgenheit.
Sind wir, die wir von Flüchtlingen aus anderen Kulturkreisen lautstark schnelle Integration fordern, eigentlich selbst in unserem eigenen Land integriert? Und was bedeutet es überhaupt genau, integriert zu sein?
Wenn wir schon so viel von Entfremdung sprechen, wollen oder müssen wir uns auch die zunehmende Entfremdung zwischen Bürgern, Staat und Politik ansehen. Wir wollen versuchen, zu klären, warum es oft scheint, als würden Volk und Politik nicht mehr zusammenpassen. Kritik am politischen Establishment, Wahlverdrossenheit, Populismus: Das demokratische System und der Politikbetrieb scheinen viele Menschen nicht mehr zu erreichen. Wir haben eine Vertrauenskrise, und nicht nur im Wahljahr 2017 – sondern mindestens seit den 1970er Jahren. Aus einer Krise, dem Höhepunkt einer gefährlichen Lage, ist längst ein nicht weniger gefährlicher, immer mal wieder aufflammender Dauerzustand geworden.
Vertrauen ist die einzig konvertible Währung, die dem demokratischen Staatsbürger zur Verfügung steht – eine Art Kredit, den der Wähler den politischen Akteuren in den Wahlkabinen mit der Hoffnung verleiht, dass seine Investition politisch reife Früchte tragen wird. Doch das Vertrauen der Bürger ist erschüttert. Die Menschen entfremden sich. Von der Politik, von ihren Repräsentanten, ja von ihrem Land. Mehr als auf den ersten Blick ersichtlich, hat dieser Tiefpunkt zwar auch mit der Globalisierung und der Flüchtlingskrise, aber vor allem mit der persönlichen Stellung der Menschen in ihrem Land zu tun, von dem sie sich alleingelassen, ungerecht behandelt, heillos überfordert oder gar vergessen fühlen.
Wir hoffen, all dies sind auch für sie spannende Fragen, mit denen wir uns auf den folgenden Seiten tiefer beschäftigen. Wir haben das Buch in drei Abschnitte gegliedert:
Das
Kleine Glossar
führt die wichtigsten hier verwendeten Begriffe und Schlagworte auf und zeigt, wie der Duden als wichtigste Instanz für alle Fragen zur deutschen Sprache sie erklärt und wie sie im täglichen Leben, in der Fachliteratur und in der Behördensprache teilweise unterschiedlich verwendet werden.
Im Kapitel
Deutschland und die Deutschen
beschäftigen wir uns – aus den bereits erläuterten Gründen – zunächst und sogar ausführlich mit der Geschichte Deutschlands und seinen Bürgern und Einwohnern.
Im Kapitel
ent-
FREMD
-et
widmen wir uns der ursprünglichen Frage, die uns zu dem Thema führte: Stimmt unsere Vermutung, dass sich ungewöhnlich viele Menschen fremd im Land und heimatlos fühlen?
Wie genau kann ein Lebensmittelpunkt zur Heimat werden? Gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen Flüchtlingen und modernen Kosmopoliten?
P.S.:
Liebe Leser, bitte beachten Sie, dass dieses Buch kein wissenschaftliches Fachbuch ist, sondern ein Sachbuch von Laien für Laien. Von einem interessierten Ehepaar über 60 geschrieben, haben wir darauf Wert gelegt, uns so verständlich wie möglich auszudrücken und daher auf die Verwendung von Fachbegriffen weitgehend verzichtet. Wir legen unsere Quellen offen und zitieren halbwegs »ordentlich«, der Lesefluss war uns indes wichtiger als wissenschaftliche Korrektheit und Vollständigkeit. Das Buch soll informativ, ein wenig provokant und unbequem, vor allem aber gut lesbar sein und im Idealfall zu Reflektion und Dialog anregen.
1 Tatsächlich: Laut Duden gibt es diesen Plural von Heimat.
2 Edward Coke: Institutes of the Lawes of England. 3rd Institute, cap. 73
KLEINESGLOSSAR
Es kommt nicht selten vor, dass mündlich wie schriftlich Ausdrücke verwendet werden, ohne sich über die Bedeutung zuverlässig im Klaren zu sein. Das betrifft nicht nur Fremdwörter und Fachbegriffe, sondern auch Alltagswörter, die wir alle kennen, aber durchaus unterschiedlich, manchmal gegensätzlich oder gar unzutreffend benutzen.
So sind Missverständnisse vorprogrammiert, die gerade bei sensiblen Diskussionsthemen schnell zu Unstimmigkeiten, Streit und Ärger führen können, weil die Diskussionspartner aneinander vorbeireden und sich von ihrem Gegenüber unverstanden fühlen. Wir möchten das vermeiden, indem wir Ihnen nachfolgend zu den wichtigsten Begriffen Definitionen anbieten.
Von der Problematik der Begriffsverwirrung ist insbesondere die heutige Migrations- und Integrationsdebatte betroffen, die ja teilweise Thema dieses vorliegenden Buches ist.
»Die öffentliche Debatte und besonders die Alltagsdiskussion zu den Themen Ausländer, Aussiedler und Asyl in Deutschland gleicht seit Jahren einem argumentativen Gemischtwarenladen mit falsch aufgeklebten Etiketten: Begriffe verschwimmen, werden mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt, als politische Stichworte missbraucht. «
Das kritisierte der Historiker und Migrationsforscher Prof. Dr. Klaus J. Bade bereits 1994, als er sein Buch mit dem Titel Ausländer – Aussiedler – Asyl vorlegte. Seine Kritik ist heute so aktuell wie damals.
Es handelt sich also nicht um ein neues, sondern ein permanentes und gleichermaßen aktuelles Problem, so dass es sich schon aus dieser Sicht lohnt, dieses Buch mit einem Glossar der wichtigsten Schlagwörter zu beginnen.
Machen Sie doch bitte zur Einstimmung einen kleinen Test und versuchen Sie, folgende Fragen ganz spontan zu beantworten:
Was ist der Unterschied zwischen Zuwanderern, Einwanderern, Immigranten, Migranten, Flüchtlingen, Aussiedlern, Asylbewerbern und Asylanten? Oder bedeuten etwa alle Begriffe dasselbe?
Wie sieht es aus mit Patriotismus, Nationalstolz und Heimatliebe? Drücken diese Bezeichnungen alle dasselbe Nationalgefühl aus oder bedeuten sie Unterschiedliches?
Schlagen Sie die Begriffe auf den nachfolgenden Seiten auf, um nachzulesen, was wir dazu zusammengetragen haben. Bei unseren Erläuterungen haben wir bewusst Wert auf Verständnis und weniger auf wissenschaftliche Korrektheit oder Vollständigkeit gelegt. Jeder Bezeichnung vorangestellt haben wir, sofern nicht anders angegeben, die kurze Begriffserklärung aus dem Duden Wörterbuch der Deutschen Sprache. Oft genug mussten wir die Schlagwörter stark vereinfacht beschreiben, um nicht ausufernd zu werden. Vielleicht stimmen Sie nicht mit jeder unserer Erläuterungen überein. Aber zumindest wissen Sie, was wir unter dem Begriff verstehen und wie wir ihn in diesem Buch gebrauchen.
Sie müssen dieses Kapitel und die einzelnen Definitionen nicht sofort und der Reihe nach lesen, es reicht völlig aus, hin und wieder nachzuschlagen.
Ausländer
Ausländer
Substantiv, maskulin –
Angehöriger eines fremden Staates;
ausländischer Staatsangehöriger oder Staatenloser
Die Problematik fängt bereits bei diesem ganz alltäglichen Begriff an. Ausländer sind, so würden wir umgangssprachlich sagen, alle Menschen, die aus dem Ausland stammen, von Deutschland aus gesehen somit alle Nationen außer der deutschen. Doch in der immer wieder hochkochenden Ausländerdiskussion sind keineswegs alle Ausländer gemeint. Es geht dabei ja nicht um ausländische Touristen, Kurgäste oder Diplomaten. Bei den meisten Menschen geht es gewiss nicht um den österreichischen Geschäftsmann, die britische Sekretärin, den niederländischen Friseur oder den französischen Koch. Nein, es geht eindeutig um eine ganz bestimmte Gruppe von Ausländern. Aber welche? Will oder kann man sie nicht genau definieren? Man will meist nicht, behaupten wir.
Wie wir in der Einleitung bereits erklärten, sind wir Autoren zwar beide deutsche Staatsbürger, haben jedoch nicht einen Tropfen »deutsches Blut«. Bei Diskussionen zum Thema Flüchtlingskrise und Migration werfen wir daher gern ein, dass auch wir einen Migrationshintergrund haben. Wir können uns darauf verlassen, dass sich regelmäßig – oft nach einem Moment des Stutzens – Widerspruch regt: »Nein, nein, Du/Ihr seid doch gar nicht gemeint!« Bohren wir weiter und bestehen auf einer genauen Benennung, wer oder was mit diesen Ausländern gemeint ist, tritt eine gewisse Verlegenheit auf. Nur die Mutigen rücken schließlich damit heraus. Es ginge hauptsächlich um »Südländer«, sagen manche, »Islamisten« werfen andere ein, und hin und wieder kann man hören: »Also ich habe ja gar nichts gegen Ausländer, aber ich finde, verschleierte Frauen / Moslems / Schwarze /Farbige passen einfach nicht in unsere Gesellschaft.«
Hier erkennen wir, wie unklare Begriffe und falsche Bezeichnungen (die besonders oft falsch benutzten Begriffe »Moslems« und »Islamisten« besprechen wir in einem eigenen Abschnitt) zu unklaren Vorstellungen führen und Missverständnisse und Fehldeutungen fördern, die leider nicht selten sogar gewollt sind.
Lassen Sie uns bitte ehrlich zu uns selbst sein und eingestehen, dass es nicht um Ausländer allgemein, sondern vielmehr um ganz bestimmte Menschen und ganz bestimmte Kulturkreise geht – nämlich um Personen anderer Hautfarbe (»je dunkler, desto problematischer«) und Muslime. Dabei empfinden wir in der Regel gegenüber »gelben Asiaten« und »roten Indianern« kein oder ein weniger großes Problem, als bei Schwarzafrikanern und beispielsweise sehr dunklen Gruppen Indiens oder Aborigines. Da sie indes derzeit in Deutschland kaum angesiedelt sind, konzentriert sich die Ablehnung auf die erste Gruppe sowie mittlerweile auf alle Muslime, egal welchen Aussehens und welcher religiösen Ausprägung. Besonders sie werden als fremd angesehen.
Der Fremde – die Fremde – das Fremde
Fremd
Adjektiv –
Nicht dem eigenen Land oder Volk angehörend;
eine andere Herkunft aufweisend;
einem anderen gehörend;
unbekannt;
nicht vertraut, ungewohnt;
Fremd ist ein weiteres dieser »einfachen« Wörter. Weil es so interessant ist, können wir nicht widerstehen, mit Ihnen einen kleinen etymologischen Exkurs zu teilen, den wir von einer Tagung des Arbeitskreises Deutsch-Niederländische Geschichte (ADNG) aus dem Jahr 2014 mitgebracht haben:
Fremd ist alles, was anders und uns unbekannt ist. So weit so gut. Doch dieses Adjektiv (= Eigenschaftswort) verweist auf ein Nomen (= Substantiv, Namenwort), das alle drei Artikel (= Geschlechtswörter) annehmen kann und jedes Mal eine völlig andere Bedeutung hat:
»
Das
Fremde« bezeichnet etwas, das als abweichend von Vertrautem wahrgenommen wird, das heißt aus Sicht dessen, der diesen Begriff verwendet, als etwas (vermeintlich) Andersartiges oder weit Entferntes.
»
Der
Fremde« ist ein Mensch, der als fremd wahrgenommen wird, im Unterschied zu Bekannten und Vertrauten.
Als »
die
Fremde« schließlich werden fremd empfundene Örtlichkeiten bezeichnet; das Ausland, die ferne weite Welt, sozusagen als Gegenbegriff zu
Heimatland
.
Unseres Wissens gibt es übrigens außer einigen wenigen eingedeutschten Fremdwörtern, wie der/die/das Joghurt, nur ein weiteres Nomen, das mit allen drei Artikeln funktioniert:
Der Band (ein gebundenes Buch, Buchband) – die Band (Musikgruppe, englisch ausgesprochen) – das Band (Tonband).
So interessant Sprachwissenschaft auch ist, an diesen Beispielen zeigt sich die Komplexität unserer Sprache. Kein Wunder, dass selbst Muttersprachler bisweilen ihre Mühe haben.
Mentalität
Mentalität
Substantiv, feminin –
Geistes- und Gemütsart;
besondere Art des Denkens und Fühlens
Mentalität – das ist die Geisteshaltung eines Einzelnen oder einer Gruppe von Menschen, die das Verhältnis zur Wirklichkeit und das individuelle und kollektive Verhalten bestimmt. Es ist also die Art, wie wir als Einzelne oder soziale Gruppe (zum Beispiel Bevölkerungsgruppe) denken und fühlen.
Kulturwissenschaftler versuchen, die Mentalität durch sogenannte Kulturstandards beschreibbar zu machen. Darunter werden nach seinem Wortschöpfer, dem Psychologen Alexander Thomas (*1939), alle Arten des Wahrnehmens, Denkens, Wertens und Handelns verstanden, die von der Mehrzahl der Mitglieder einer bestimmten Kultur für sich persönlich und andere als normal, selbstverständlich, typisch und verbindlich angesehen werden.(3) Die Seriosität dieses Ansatzes jedoch umstritten, da sie zu Stereotypen und Vorurteilen führen kann.
Nation, Staat, Volk, Staatsvolk
Nation, Staat und Volk sind eng zusammengehörende Begriffe, die jedoch mitnichten eine identische Bedeutung haben. Und keineswegs schnell und problemlos zu definieren sind.
Nation
Substantiv, feminin –
große, meist geschlossen siedelnde Gemeinschaft von
Menschen mit gleicher Abstammung, Geschichte, Sprache, Kultur,
die ein politisches Staatswesen bilden
Staat, Staatswesen
(umgangssprachlich) Menschen, die zu einer Nation gehören; Volk
Nation (lat. nacio Volk, Sippschaft, Menschenschlag) ist nach dem Deutschen Wörterbuch der Gegenwartssprache ein Fremdwort, das um 1400 ins Deutsche übernommen wurde. Es bezeichnet Ethnien oder Gemeinschaften von Menschen, denen gemeinsame Merkmale, wie Sprache, Geschichte, Sitten und Gebräuche eigen sind, die sich als historisch gewachsene Gemeinschaft verstehen, innerhalb eines bestimmten Territoriums zusammenleben und ein politisches Staatswesen bilden. Daneben wird die Bezeichnung allgemeinsprachlich, aber nicht wissenschaftlich, als Synonym für Staat und Volk gebraucht.
Ernest Renan (1823–1892) sagte in seiner noch heute bedeutenden Rede Was ist eine Nation? vom 11. März 1882 an der Sorbonne: »Eine Nation ist ein geistiges Prinzip, das aus tiefgreifenden Verbindungen der Geschichte resultiert, eine spirituelle Verbindung.« Zweierlei sei wichtig, um jene große Solidargemeinschaft zu begründen: zum einen die Vergangenheit, der gemeinsame Besitz eines reichen Erbes an Erinnerungen, zum anderen die Gegenwart, der Wunsch, zusammenzuleben, der Wille, das Erbe hochzuhalten: »Die Existenz einer Nation ist ein Plebiszit (Volksentscheid), das sich jeden Tag wiederholt.« Renan verwirft damit alle Definitionsversuche, nach denen Rasse, Sprache, Konfessionen oder Territorialgrenzen als alleinige Kriterien für die Beschreibung einer Nation gelten sollen, weil sie nicht für alle Nationen verallgemeinerbar sind.
Nach dem Nationalstaats-Theoretiker unserer Tage Benedict Anderson (1936–2015)(4) handelt es sich bei Nationen um vorgestellte Gemeinschaften (imagined communities), »weil die Mitglieder die meisten anderen niemals kennen werden, aber im Kopf eines jeden die Vorstellung ihrer Gemeinschaft existiert«.
Renans Aspekt der Erinnerung und Benedict Andersons Konzept der vorgestellten Gemeinschaft gelten als die wesentlichen Komponenten zum Verständnis des Begriffs der nationalen Identität und werden von Jan Assmann pointiert zusammengeführt: »Gesellschaften imaginieren Selbstbilder und kontinuieren über die Generationenfolge hinweg eine Identität, indem sie eine Kultur der Erinnerung ausbilden; und sie tun das … auf ganz verschiedene Weise(5)«.
Werden die Besonderheiten einer Nation im Unterschied zu anderen Gruppierungen besonders betont und für machtpolitische Zwecke instrumentalisiert, kann die Identifikation mit der Nation in Nationalismus münden.
Staat
Substantiv, maskulin –
Gesamtheit der Institutionen, deren Zusammenwirken
das dauerhafte und geordnete Zusammenleben der in einem bestimmten
abgegrenzten Territorium lebenden Menschen gewährleisten soll
Territorium, auf das sich die Gebietshoheit eines Staates erstreckt; Staatsgebiet
Der Begriff Staat ist dem lateinischen status (Stand, Zustand, Stellung) entlehnt. Das italienische lo stato kam in der Renaissance auf und bezeichnete die mehr oder weniger stabile Verfassungsform einer Monarchie oder Republik. Der status regalis meinte Stellung, Macht und Einfluss des zur Herrschaft gelangten Königs oder Fürsten, später auch seines Anhangs, des Hofstaats. Die französische Übersetzung état bezog sich zunächst nur auf den ökonomischen Haushalt der Zentralmacht, später dazu auf die rechtliche und politische Einheit aller Staatsbürger (von der Ständeordnung hin zur bürgerlichen Gesellschaft) eines Staatsgebiets.
Erst eingangs des 19. Jahrhunderts erhielt der Staat seine moderne Bedeutung. Die persönliche Herrschaft des Monarchen, seine absolute Souveränität, wurde durch die Schriften der Vordenker und Staatstheoretiker John Locke (1632–1704) und Charles-Louis de Secondat (1689–1755, bekannt als Montesquieu) zu einem von mehreren funktionalen »Bausteinen des politischen Systems«. Mit dieser Ablösung der Herrschaft von der Person des Monarchen konnte der Staat als abstrakte Institution, als »Handlungssubjekt mit eigenem Willen«(6) gedacht werden.
Im weitesten Sinn bezeichnet Staat seither eine politische Ordnung, in der einer bestimmten Gruppe, Organisation oder Institution eine privilegierte Stellung zukommt. Aus staatsrechtlicher Sicht gibt es diese spezifische Form von Herrschaftsorganisation erst seit der europäischen Neuzeit.
Diese verkürzte und sehr allgemeine Definition ist dem Umstand geschuldet, dass der Begriff je nach Blickwinkel mit unterschiedlichen Inhalten besetzt ist. Da es für das Thema des vorliegenden Buches nicht erforderlich ist, diese Staatsbegriffe in allen Details zu kennen und zu verstehen, belassen wir es bei der Zusammenfassung, dass sich wegen der deutlich voneinander abweichenden Beschreibungen aus juristisch-völkerrechtlicher, politikwissenschaftlicher, soziologischer und sittlicher Sicht keine allgemein gültige Definition des Begriffs herausgebildet hat.
Der Unterschied zwischen Staat und Nation wird vielleicht klarer, wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, dass eine Reihe von Nationen über starke Identitäten, aber keinen eigenen Staat verfügt, wie etwa die Basken, die Inuit, die Roma, die Kurden. Nationale Identitäten existieren also unabhängig von Staaten.
Volk
Substantiv, Neutrum –
Durch gemeinsame Kultur und Geschichte [und Sprache]
verbundene große Gemeinschaft von Menschen;
Masse der Angehörigen einer Gesellschaft, der Bevölkerung
eines Landes, eines Staatsgebiets;
die [mittlere und] untere Schicht der Bevölkerung;
(umgangssprachlich) Menschenmenge; Menschen, Leute,
bestimmte Gruppe von Menschen
Wird es einfacher, wenn wir uns der Definition von Volk zuwenden? Ja, wenn wir uns darauf einigen, dass mit Volk ursprünglich nichts anderes als eine Menschenmenge, also viele Menschen, gemeint war, wie es bis im Englischen mit a lot of people ausgedrückt wird (Mit engl. people können sowohl Leute, Menschen, Personen als auch Volk und Völkerschaften bezeichnet werden). Das aus dem Althochdeutschen stammende Wort bedeutete ursprünglich Kriegerschaar, Menschenhaufen oder Ansammlung.
Später wandelte es sich in eine abgrenzende und abwertende Bezeichnung für das niedere gewöhnliche Volk im Gegensatz zu den höheren Ständen und wurde in diesem Sinn bis zum 18. Jahrhundert gebraucht. Seit Beginn der Neuzeit wird auch eine Gesellschaft oder Großgruppe von Menschen mit gleicher Sprache und Kultur als Volk bezeichnet und hat in dieser Hinsicht den negativen Mitklang verloren. Dieser Volksbegriff ist gleichwohl emotional und politikideologisch hoch aufgeladen, denn die Zugehörigkeit zu einem Volk beinhaltet neben objektiven Faktoren (wie kulturelle Verwandtschaft, gleiche Sprache, politische Schicksalsgemeinschaft) auch die subjektive Komponente im Sich-Bekennen zu diesem Volk.
Im Dritten Reich wurde Volk zu einem der meist gebrauchten Schlagwörter und metaphysisch verklärte Wesenheit als »erhabene Gemeinschaft einer langen Reihe von vergangenen, jetzt lebenden und noch kommenden Geschlechtern« beschrieben, »die sich als schicksalhafte Blutsgemeinschaft« ausdrücke. Erstere Aussage stammt von dem Staatstheoretiker Adam Müller von Nitterdorf (1779–1829), einem Hauptvertreter der politischen Romantik und die zweite Aussage von dem Philosophen und NSDAP-Mitglied Hermann Schwarz (1864–1951), dessen meiste Werke nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings postwendend auf die Liste der auszusondernden Literatur in der DDR gesetzt wurden.
Wissenschaftlich hat sich diese heutzutage folgende knappe und sachliche Definition durchgesetzt: »Eine Reihe verschiedener, sich teilweise überschneidender Gruppen von Menschen, die aufgrund bestimmter kultureller Gemeinsamkeiten und Beziehungen und zahlreicher Verwandtschaftsgruppen miteinander verbunden sind«.
Staatsvolk
Substantiv, Neutrum –
Bevölkerung des zu einem Staat gehörenden Gebiets;
Gesamtheit der Staatsangehörigen eines Staates
Unter Staatsvolk versteht man eine Gruppe von Menschen mit derselben Staatsbürgerschaft – unabhängig von der Nationalität (Ethnie, Herkunft) des einzelnen Bürgers.
Ausdrücklich erwähnt ist der Begriff Staatsvolk im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland nicht. Stattdessen ist nur von Volk die Rede. Es war daher lange strittig, wie die »Zugehörigkeit zum deutschen Volk« genau zu definieren ist.
Im Sinn des bundesdeutschen Grundgesetzes ist primär der rechtliche Status als Staatsbürger und nicht die Zugehörigkeit zu einem Volk oder Volksstamm im ethnischen oder soziologischen Sinn maßgeblich. Dies wurde 1990 im Zusammenhang mit der Frage des Ausländerwahlrechts vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Das Bundesverfassungsgericht rechnet zum Staatsvolk auch die in Art. 116 Abs. 1 GG (Definition des Begriffs des Deutschen im Sinne des Grundgesetzes) den deutschen Staatsangehörigen gleichgestellte Personen, die »als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiet des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden« haben.
Eingebürgerte Migranten nichtdeutscher Nationalität gehören somit mit allen Rechten und Pflichten zum bundesdeutschen Staatsvolk.
Rasse, Ethnie, Population
Dies sind weitere, miteinander eng verwandte Begriffe, die Gruppen von Menschen definieren.
Rasse
Substantiv, feminin –
(Biologie) Gesamtheit der auf eine Züchtung zurückgehenden Tiere,
seltener auch Pflanzen einer Art, die sich durch bestimmte gemeinsame
Merkmale von den übrigen derselben Art unterscheiden;
Zuchtrasse (Biologie), Unterart;
Bevölkerungsgruppe mit bestimmten
gemeinsamen biologischen Merkmalen
Rasse ist eine biologische Kategorie, die Lebewesen ganz allgemein anhand ihrer Verwandtschaft in Gruppen zusammenfasst. In früheren Jahrhunderten nur vage, dabei unschuldig-neutral auf allen möglichen Ebenen der Tierwelt und auch auf Menschen angewendet, wurde die Bezeichnung im 18. Jahrhundert sowohl von Völkerkundlern, wie dem Franzosen Joseph Arthur de Gobineau (1816–1882) und dem Briten Stewart Chamberlain (1855–1927) als auch von Philosophen wie beispielsweise Emanuel Kant (1724–1804) aufgegriffen.
Als die Nationalsozialisten Gobineaus alte Schrift Versuch über die Ungleichheit der Menschenrasse (Essai sur l‘inégalité des races humaines) entdeckten, in der er die Theorie einer »arischen Herrenrasse« aufstellt, und auf dessen Gedanken Houston Stewart Chamberlain (1855–1927) mit seiner Schrift Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts den zu seiner Zeit viel beachteten theoretischen Rassenantisemitismus schuf, führten diese kruden Thesen zu einem wahren Rassenwahn in Nazi-Deutschland. Richard und Cosima Wagner waren glühende Verehrer der Rassentheorien Gobineaus und ermunterten Chamberlain zu seiner Arbeit. Mit dieser so genannten Rassenlehre – die alsbald sogar als eigenes Fach an Schulen unterrichtet wurde – teilten die Nationalsozialisten Menschen nach Hautfarbe, Körper, Kopf- und Gesichtsform in unterschiedliche Gruppen ein, denen nicht nur bestimmte äußerliche Merkmale, sondern auch Wesenszüge und Charaktereigenschaften zugeschrieben wurden. Das Erbgut sollte entscheidend sein für den Wert eines Volkes. Hiermit war die Absicht verbunden, bestimmte Rassen für wertvoller als andere zu bestimmen. So war für die Nationalsozialisten die so genannte Nordische Rasse, der sie sich selbst zuordneten, die wertvollste. Angehörige dieser Rasse sollten als überlegene Herrenmenschen über die Welt herrschen.
Derartige Untergliederungen der Menschheit mögen ursprünglich analog zu Tierrassen oder Pflanzengattungen durchaus verständliche Versuche einer Klassifizierung gewesen sein; hinsichtlich der vorgeblichen rassenspezifischen Unterschiede wurden sie aber mit Wertungen verbunden, indem man angeblich höher- und minderwertige Menschenrassen auszumachen vorgab und Zusammenhänge zwischen rassisch bedingten Eigenschaften und der Kulturentwicklung behauptete. Das wiederum ist nichts Anderes als reinster Rassismus.
Dadurch gilt der Begriff der Rasse, soweit er auf Menschen angewandt wird, im deutschen Sprachgebrauch als hoch vergiftet. Und doch lesen wir in Artikel 3 des Grundgesetzes (Hervorhebung durch uns): »Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.«
Wie kann das sein? Wenn wir die Geschichte des Rassebegriffs kennen, ist die Verwendung in diesem Kontext nicht problematisch. Doch wird dieser Grundgesetz-Artikel gern als Begründung für einen herablassenden Blick auf andere »Menschentypen« und deren anderes Aussehen oder andere Kultur herangezogen (»Natürlich gibt es Menschenrassen, das steht doch sogar im Grundgesetz«). Solche törichten Rassentheorien fördern das eigene Überlegenheitsgefühl und erzeugen soziale Ausgrenzung, Vorurteile, Ablehnung und Feindseligkeit gegenüber Fremden.
Die Einteilung des Menschen in biologische Rassen entspricht längst nicht mehr dem Stand der Wissenschaft. Die Biologie teilt Homo sapiens schon seit geraumer Zeit nicht mehr in Rassen, Arten oder Unterarten ein. Molekularbiologische und populationsgenetische Forschungen ab den 1970er Jahren haben gezeigt, dass eine systematische Unterteilung der Menschen in Unterarten ihrer enormen Vielfalt und den fließenden Übergängen zwischen geographischen Populationen nicht gerecht wird. Zudem fand man heraus, dass der größte Teil genetischer Unterschiede beim Menschen innerhalb einer geographischen Population zu finden ist.
Nicht umsonst hat die UNESCO schon 1950 zur Sprachregelung gefordert, den Ausdruck Rasse durch Ethnie oder Ethnizität zu ersetzen.
Ethnie
Substantiv, feminin –
Menschengruppe (insbesondere Stamm oder Volk)
mit einheitlicher Kultur
Es ist wichtig zu wissen, dass in den Vereinigten Staaten der Rassebegriff eine vollkommen andere Rezeption findet als hierzulande, hat er doch einen Bedeutungswandel erlebt, den der deutsche Begriff wegen des bestehenden Tabus nicht mitmachte. Das englische Wort race mit Rasse zu übersetzen, geht nicht. In den Vereinigten Staaten gehört es in der Forensik und in der Medizin zum Alltag, zwischen Afroamerikanern, Hispaniern, Asiaten und Europäern zu unterscheiden. Spricht man dort also ganz unbefangen von race, so ist in der Wissenschaft Ethnie die gängige Übersetzung.
Eine Ethnie (altgriechisch éthnos fremdes Volk, Volkszugehörige) ist in den Sozialwissenschaften, insbesondere in der Ethnologie (Völkerkunde), eine abgrenzbare Menschengruppe, der aufgrund ihres intuitiven Selbstverständnisses und Gemeinschaftsgefühls eine eigenständige Identität als Volksgruppe zuerkannt wird. Da Wissenschaftler den Terminus Volk – siehe auch oben – eher vermeiden, werden die Begriffe nur umgangssprachlich nebeneinander verwendet.
Population
Substantiv, feminin –
(Biologie) Gesamtheit der an einem Ort vorhandenen Individuen einer Art;
(veraltend) Bevölkerung
Die Bezeichnung Population ist im Deutschen unbelastet, wird heute allerdings als überwiegend wissenschaftlicher Begriff aus der Biologie und Anthropolgie verstanden. So sagt der Duden folgerichtig, dass die Gleichbedeutung mit Bevölkerung veraltet ist.
Heimat
Im Lauf der Geschichte hat der Begriff Heimat nicht nur eine Reihe von inhaltlichen Bedeutungsunterschieden durchlebt, sondern wurde und wird bis heute teilweise instrumentalisiert. Er gehört daher wohl zu den »schwierigsten« Wörtern dieses kleinen Glossars, dessen Bedeutung und geschichtliche Hintergründe wir wegen der Komplexität hier nur stark vereinfacht wiedergeben können.
Heimat
Substantiv, feminin –
Land, Landesteil oder Ort, in dem man [geboren und]
aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt
zu Hause fühlt (oft als gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit
gegenüber einer bestimmten Gegend);
Ursprungs-, Herkunftsland eines Tiers, einer Pflanze, eines Erzeugnisses, einer Technik o.Ä.
Ursprünglich ein Neutrum, nämlich hämatli – »das Heimat«, bedeutete das Wort nichts weiter als »Wohnrecht mit Schlafstelle«. Im 13. Jahrhundert, so zeigen etwa Auszüge des Nibelungenliedes, war Heimat nichts Verortbares, sondern mit der Zugehörigkeit zu einem Personenverband definiert. Nur wer Verwandte hatte, hatte eine Heimat.
In der Folge wandelte sich die Bedeutung langsam in Richtung »Zugehörigkeit einer Person zu einer bestimmten Grundherrschaft«, und es kam eine rechtliche Bedeutung als Aufenthalts- oder Bleiberecht. Diese Organisationsform der Grundherrschaft war eine vom Mittelalter bis zur Bauernbefreiung von 1848 vorherrschende rechtliche, wirtschaftliche und soziale Besitzstruktur des ländlichen Raums. Erst danach entwickelten sich die Ortsgemeinden als unterste Verwaltungseinheiten.