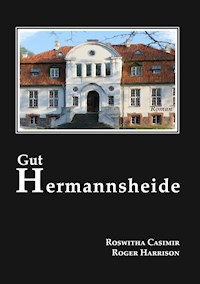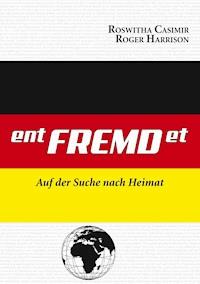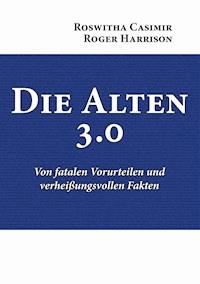
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Daten, Tatsachen und Befunde über das Altwerden und das Altsein in Vergangenheit und Gegenwart. Historischer Abriss über die Stellung alter Menschen und überraschende Erkenntnisse über das heutige dritte und vierte Lebensalter. Ketzerische Gedanken und neue Chancen für die Zukunft der Alten. Geschrieben von zweien, die sich aus dem Erwerbsleben verabschiedeten, unvorbereitet in die Seniorenwelt eintauchten und schlagartig merkten, wie ahnungslos sie waren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
P
ROLOG
E
INLEITUNG
G
ESTERN
- D
IE
A
LTEN
1.0
Die Stellung alter Menschen in der Gesellschaft
Respekt und Ablehnung
Alterslob und Altersschelte, Altersklage und Alterstrost
Altersgeschichten in alten Geschichten
Religiöse Grundlagen
Sozialgeschichte
Weimarer Zeit
Nationalsozialismus
Nachkriegszeit und Wiederaufbau
Bevölkerungsgeschichte
Bevölkerungsentwicklung
Historischer Altersaufbau und Durchschnittsalter
Lebenserwartung
H
EUTE
- D
IE
A
LTEN
2.0
Begriffsbestimmungen
Demografie
Demografische Revolution und demografischer Wandel
Altersaufbau
… und noch ein bisschen Weltuntergangsstimmung
Wir brauchen eine Alterskultur!
Altersphasen
Lebenswünsche
Altersbilder und Stereotype des Alter(n)s
Altersdiskriminierung
Altern ist anders
Alter ist nicht gleich Alter
Altern ist keine Krankheit
Ist Altern ein Frauenproblem?
H
EUTE
A
BEND
- D
IE
A
LTEN
2.5
Die negative Wahrnehmung des Alters
Die bösen Alten
Ein beinahe geschriebenes Buch und Fragen über Fragen
Antworten?
M
ORGEN
- D
IE
A
LTEN
3.0
Das Zeitalter der Alten
Bestandsaufnahme
Politik und Lobbyisten
Aufmerksamkeit der Gesellschaft
Was sagt die Trendforschung?
Jetzt werden wir aktiv!
Gemeinsam statt einsam
Dialog statt Differenz
Kooperation statt Komplott
Was wollen wir – was können wir?
Wirtschaftliche Lage
Wie wollen wir wohnen?
Gesellschaftliche Teilhabe, Ehrenamt, Soziale Kontakte
Wonach sehnen wir uns?
Gesundheit
Lebenslust und Lebensfreude
Wir bereuen nichts
L
ITERATUR
W
EBLINKS
A
NMERKUNGEN
PROLOG
Als ich den Wunsch verspürte, eine Schrift über das Alter zu verfassen, da kam mir der Gedanke, dass es das Passendste sei, sie dir zu schenken, auf dass wir uns beide daran halten könnten. Für mich jedenfalls bedeutete das Schreiben dieses Buches eine solche Freude, dass mir der Spaß, den ich daran fand, nicht nur alle Altersbeschwerden gleichsam wegblies, sondern mir mein Alter sogar behaglich und willkommen machte.1
Diese Zeilen von Marcus Tullius Cicero (106–43 v. Chr.) stammen aus seiner Schrift Cato Maior de senectute (Cato der Ältere über das Alter), die vor über 2.000 Jahren entstand. Cicero schrieb dieses Werk im Alter von 62 Jahren und im Jahr vor seinem Tod. Er widmete es seinem drei Jahre älteren Freund und Gefährten Atticus. Er war der Ansicht, ihm und Atticus tue es gut, über das Alter nachzudenken und sich zu fragen, wie man mit ihm umzugehen habe.
Unter Caesars Diktatur war Cicero, von der aktiven Teilnahme am politischen Geschehen ausgeschlossen, alt und einsam geworden. In dieser Lage verfasste der begnadete römische Redner und Denker diese Schrift, in der er die von ihm bewunderte historische Persönlichkeit des Cato Censorius als 83-jährige Hauptfigur seine philosophischen Ansichten über das Alter vortragen lässt.
Entstanden sind Gedanken von zeitloser Aktualität, die uns bedenkenswerte Orientierungshilfe bei der Suche nach einem sinnerfüllten Leben geben können: Der Grund, weshalb so viele Greise über ihr Alter klagen – so die Essenz dieser Rede und Gegenrede – liege einzig in ihrem Charakter. Der Mensch selbst sei es, der sich das Leben – in jedem Alter – schwer mache. Verdrießlichkeit und Todesfurcht seien Fehler des Charakters, nicht des Alters. Die Abnahme der Kräfte sei öfter eine Folge von Jugendsünden als von Gebrechen des Greisenalters.
Und Cicero sagte auch:
Das Alter ist nur geehrt unter der Bedingung, dass es sich selbst verteidigt, seine Rechte behält, sich niemandem unterordnet und bis zum letzten Atemzug die eigene Domäne beherrscht.
EINLEITUNG
Wir empfinden das Altsein als etwas Statisches. Wir teilen es in Generationen ein: Großvater und Großmutter sind uralt, Mutter und Vater sind alt, wir selbst, unsere Geschwister und unsere Freunde sind jung. Großvater war alt, so lange wir denken konnten und in unserer Vorstellung daher so lange er lebte. Unsere Eltern gehören »von Anfang an« (nämlich dem Moment, als wir geboren wurden) zur Generation der Erwachsenen. Natürlich wissen wir, dass alle Menschen, somit auch unsere Großeltern und Eltern, einmal Babys, Jugendliche und junge Erwachsene waren, dass sie in die Windeln machten, wie unsere eigenen Kinder oder in die Pubertät kamen, wie einst wir selbst. Wir wissen, dass unsere Eltern sich dazumal verliebten, miteinander Sex hatten und vielleicht ein ziemlich wildes, »jugendliches« Leben führten. Natürlich wissen wir das, allerdings wollen wir es nicht wissen.
Das Altsein ist uns selbstverständlich, ja vertraut, weil wir es bei anderen sehen und erleben, das Altwerden hingegen können wir nicht wirklich verstehen. Es ist in unserer intuitiven Vorstellung kein kontinuierlicher Prozess, sondern geschieht, wenn überhaupt, sprunghaft. »Mein Gott, was bin ich alt geworden«, erschrecken wir eines Morgens vor dem Spiegel. Obwohl wir täglich mehrfach hineinsehen, können wir doch den Alterungsprozess als solchen nicht nachvollziehen, weil wir ihn nicht erkennen.
Bemerkenswert ist, dass uns das Älterwerden und Altsein je nach Lebensabschnitt etwas anderes bedeutet:
»Wenn ich endlich sechs Jahre alt werde, dann darf ich zur Schule. Hurra!«
»Wenn ich endlich 18 bin, darf ich den Führerschein machen. Wurde auch Zeit, schließlich bin ich längst erwachsen!«
»Oje, ich werde schon 30. Jetzt werde ich alt!«
»50! Schrecklich! Soll das nun alles gewesen sein?«
»Wenn ich endlich 65 bin, dann …«
Wir fragen uns: Alt – was ist das, und wann beginnt das Altsein? Schauen wir nach bei Wikipedia: »Unter dem Alter versteht man den Lebensabschnitt rund um die mittlere Lebenserwartung des Menschen, also das Lebensalter zwischen dem mittleren Erwachsenenalter und dem Tod. Das Altern in diesem Lebensabschnitt ist meist mit einem Nachlassen der Aktivität und einem allgemeinen körperlichen Niedergang (Seneszenz) verbunden.«
Von diesen Grundtatsachen abgesehen sind Alter, Altern und Altsein keine leicht zu beschreibenden Begriffe.
Ein Blick in die Geburtsurkunde genügt, um das Alter eines Menschen zu erfahren. Mag sich vieles im Leben an diesem kalendarischen Lebensalter orientieren, Einschulung, Volljährigkeit, Wahlalter, Pensionierung, so ist es für den tatsächlichen Verlauf des Älterwerdens nicht von unmittelbarer Bedeutung. Da kommt vielmehr das »biologische Alter« ins Spiel, das die nachlassende Leistungsfähigkeit von Körper und Intellekt berücksichtigt. Diese biologischen Veränderungen treffen jeden, verlaufen bei den einzelnen Menschen allerdings höchst unterschiedlich.
Viele Philosophen haben sich Gedanken darüber gemacht, wann der Mensch alt ist. Dante war der Meinung, das Altsein beginne mit 45, nach Hippokrates war man mit 56 Jahren alt. Aristoteles (384–322 v. Chr.) befand, dass der »Körper mit 35, die Seele hingegen erst mit 50« alt sei.
Doch im Gegensatz zu heute setzte man in früheren Zeiten den Begriff »alt« mit »reif« gleich, was augenblicklich versöhnlicher klingt und auf die Aufgabe hindeutet, die im Leben erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen an die Jüngeren weiterzugeben, auf dass sie vom Wissen der Alten profitieren.
Auch was Altern genau ist, weiß die Wissenschaft im Grunde bis heute nicht. Seit Urzeiten ringen die Menschen darum, die biologische Funktionsweise des Alterns zu verstehen. Man kennt natürlich viele Teilaspekte. Man hat nachgewiesen, dass hohes Alter abhängig von der genetischen Disposition ist. Man beobachtet die allgemeine Verlangsamung des Stoffwechsels, was sich als träge Immunreaktion zeigen kann. Man weiß, dass die Degeneration der elastischen Fasern zur Austrocknung und Faltenbildung der Haut führt. Es scheint ein biologisches Wachstums- und Zerfallsmuster zu geben, das auf alle Menschen früher oder später zutrifft. So können sich bestimmte Zellen nicht beliebig oft teilen.
Hat sich eine beliebige Zelle 25 bis 50 Mal geteilt, ereilt sie ein permanenter Wachstumsstopp; sie wird in den Ruhestand versetzt, quasi in Rente geschickt. Mit der Folge, dass das entsprechende Organ altert. Das nennt die Wissenschaft – und die Kosmetikindustrie, wenn sie eine neue Anti-Falten-Wundercreme auf den Markt wirft – zelluläre Seneszenz. Obwohl es sich um einen überaus sinnvollen Schutzmechanismus des Organismus handelt (Die Seneszenz verhindert nämlich, dass sich im Zuge der Zellteilung und dem damit einher gehenden zellulären Stress genetische Fehler anhäufen), beschäftigt sich eine ganze Industrie damit, wie sich die Seneszenz stoppen oder wenigstens verlangsamen lässt. Bislang mit wenig Erfolg.
Und sonst? Man steht nach wie vor ziemlich am Anfang der Forschungen zum Thema Altern.
Fragen wir Mitmenschen im frühen oder mittleren Lebensalter, welches Lebensalter sie mit dem Altsein verbinden, wird gern das 60. oder 65. Lebensjahr genannt, zumindest als »Beginn des Altwerdens«. Fragen wir Personen dieser Altersgruppe, schätzen sie sich selten selbst als alt ein. Anderes ist lediglich zu beobachten, wenn eine krankheitsbedingte vorzeitige Gebrechlichkeit oder ernsthafte Erkrankung hinzukommt. Untersuchungen zufolge fühlen sich die Menschen ab 60 ansonsten viel später alt. In den höheren Altersklassen betrachten sich die meisten erst im Alter von über 70 Jahren selbst als »alt werdend« und über 80 Jahren als »alt«.
Die Altersstruktur der Bevölkerung hat sich durch die technologisch-industrielle Entwicklung ab dem 20. Jahrhundert radikal verändert; die demografische Wende ist einzigartig in der Geschichte. Zwar hat sich im Lauf der Menschheitsgeschichte die altersmäßige Verteilung der Bevölkerung langsam verschoben, da die Menschen gesünder und die Umwelt für sie gefahrloser wurde, doch erst in den letzten Jahrzehnten deutete sich die dramatische Veränderung in der Zusammensetzung der Bevölkerung an, die nun im vollen Gang ist und sich in den nächsten Jahrzehnten noch zuspitzen wird.
Das Zeitalter der Alten hat begonnen. Um das Jahr 2030 sollen mehr als ein Drittel der Deutschen im Seniorenalter stehen. Das wirft Fragen auf: Wird ein Generationenkonflikt ausbrechen, wird es zu einem gnadenlosen Verteilungskampf kommen? Werden die Alten (wieder!) zu Almosenempfängern verkommen, weil die Erwerbstätigen sie nicht mehr finanzieren können? Oder: Werden Alte und Junge lernen, besser zu beiderseitigem Nutzen miteinander zu leben, als je zuvor? Wird den Alten ihre kommende zahlenmäßige Überlegenheit helfen, die Anerkennung der Jüngeren (wieder) zu erlangen, indem sie ihren Wissens- und Erfahrungsschatz zum gemeinsamen Nutzen einbringen?
Alle Macht den Alten? Wir haben es in der Hand.
Jedenfalls, wenn das Erwerbsleben zu Ende geht, die Kinder uns längst nicht mehr brauchen, ja sogar die Enkelkinder bereits heranwachsen, befinden wir uns in einer Lebensphase, die uns geradezu herausfordert, das Vergangene aufzuarbeiten, die Gegenwart aktiv zu gestalten und die zukünftigen Möglichkeiten, Freiheiten und Grenzen zu planen. Vielleicht ist das vorliegende Buch dabei nützlich. Wobei wir selbst noch gar nicht genau wissen, wohin es uns führt. Wir sind noch dabei, die uns offen stehenden Möglichkeiten der Gestaltung unserer Gegenwart zu erkunden.
Wollen Sie uns auf dieser Reise begleiten?
P.S.: Liebe Leser, bitte beachten Sie, dass dieses Buch kein wissenschaftliches Fachbuch ist, sondern ein Sachbuch von Laien für Laien. Von einem interessierten Ehepaar über 60 geschrieben, haben wir Wert darauf gelegt, so verständlich wie möglich zu sein und daher auf die Verwendung von Fachbegriffen weitgehend verzichtet. Wir legen mit vielen Fußnoten und einer Literaturliste unsere Quellen offen und haben halbwegs »ordentlich« zitiert, der Lesefluss war uns indes wichtiger als wissenschaftliche Korrektheit und Vollständigkeit. Das Buch soll unterhaltsam und informativ, ein wenig provokant und unbequem, vor allem allerdings gut lesbar sein und im Idealfall zur Reflektion und zum Dialog anregen.
P.P.S. : Noch etwas müssen wir miteinander besprechen: Möglicherweise ist dieses Buch politisch schrecklich inkorrekt. Sie werden nämlich das Binnen-I, die »Erektion im Text«, wie die taz den phallischen Buchstaben so trefflich bezeichnete, hier nicht finden – und hoffentlich nicht vermissen. Es war stets hässlich, gilt mittlerweile als überholt. Andere Herausforderungen, wie der, die oder das Gender_gap oder das »neutrale X«, berühmt geworden durch Lann Hornscheid, Professx für Genderstudies und Spracheanalyse in Berlin, hatten erfreulicherweise noch weniger Aussicht auf Erfolg. So war einige Zeit Ruhe an der Gender-Neusprechfront.
Doch mitten im Schreiben dieses Buches schreckte uns diese Meldung von Ende November 2015 auf: »Die Politiker*innen der Grünen wollen künftig ein Gendersternchen setzen, um Diskriminierung zu vermeiden.«
Es ist schon eine Krux mit dem Gendern – welch Wortmonster im Übrigen! Doch über die Vergewaltigung der englischen Sprache zur Erfüllung niederer deutscher Bedürfnisse wollen wir hier nicht auch noch schreiben. Deswegen zurück zum Thema der Vergewaltigung der deutschen Sprache:
Gendern in deutscher Sprache ist umständlich, hässlich anzusehen, mündlich schwerlich zu vermitteln und bremst den Lesefluss ganz ungemein. Es trägt allerdings sich wandelnden Lebenswelten und mannigfaltigen wissenschaftlichen Studien Rechnung, die belegen, dass das generische Maskulinum der gleichberechtigen Wahrnehmung von Mann und Frau abträglich ist.
Was also tun? Wir haben die Verwendung des Sternchens mal testweise versucht, doch – sorry – nein, das können wir Ihnen nicht antun. Wir wollen nicht christlicher als der Papst sein. Wir haben uns stets um sprachliche Genauigkeit bemüht, wir werden es in dieser Arbeit wiederum tun. Bitte verzeihen Sie uns, wenn es nicht immer gelingt.
GESTERN
DIE ALTEN 1.0
DIE STELLUNG ALTER MENSCHEN IN DER GESELLSCHAFT
Die Jugend ist die Zeit, die Weisheit zu lernen. Das Alter ist die Zeit, sie auszuüben.
Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)
Das Thema des Altwerdens und Altseins beschäftigt die Menschen seit undenklichen Zeiten. Waren ewige Jugend und Unsterblichkeit Kennzeichen der Göttinnen und Götter der antiken Welt, so war es das Schicksal der Menschen, zu altern und zu sterben.
Die Geschichtsforschung hat sich dem Alter von drei Seiten genähert:
Die Kulturgeschichte des Alters analysiert Wahrnehmungen und Bewertungen des Alters, Altersrollen, Bilder und Stereotypen des Alterns.
Die Sozialgeschichte hingegen untersucht Lebensformen und Lebenslagen, Praktiken alter Menschen in Familie und Gesellschaft sowie Institutionen, die Rahmenbedingungen für das Leben im Alter schaffen. Dort geht es unter anderem um die Zusammenhänge zwischen Alter und Ruhestand sowie die Entstehung unserer Renten- und Pensionssysteme.
In enger Verbindung zu diesen beiden Perspektiven steht die historische Bevölkerungsgeschichte. Sie gibt Auskunft über Lebenserwartung, Sterblichkeit und Altenanteile während der einzelnen Epochen.
Aus diesen verschiedenen Blickrichtungen wollen wir unser Thema zunächst beleuchten, um uns eine gewisse Wissensgrundlage zu verschaffen. Möglicherweise geht es Ihnen ja wie uns: Dass wir uns über das Altwerden und Altsein, über die Geschichte des Alterns oder die Gründe für die soziale Stellung der Alten bislang nur oberflächlich Gedanken gemacht haben und teilweise erschreckend wenig wussten. Dabei geht es uns doch so direkt an.
RESPEKT UND ABLEHNUNG
Ansehen und gesellschaftliche Stellung des alten Menschen waren in der Geschichte häufigen Wandlungen unterworfen, so wie die persönliche Einstellung alten Menschen gegenüber stets von gegensätzlichen Gefühlen und Handlungen geprägt war und bis heute ist. Altersdiskriminierung ist kein modernes Problem. Hochachtung oder Verachtung, Verehrung oder Herabwürdigung, Respekt oder Geringschätzung wechselten je nach Anlass, Hintergrund, Epoche und Land. In der Antike grenzten beispielsweise die Athener alte Menschen systematisch aus, während sich die Römer zeitweise anders verhielten. In erster Linie traf und trifft es die Frauen. Nach dem Motto »Bei den Männern zählt die Reife, bei den Frauen die Jugend«, wurden sie fast durchgehend verhöhnt. Es gibt keine Epoche, die sich über einen längeren Zeitraum hinweg ausschließlich durch Altenverehrung ausgezeichnet hätte.
Moooment mal, werden Sie nun vielleicht einwerfen, das glaube ich nicht! Nein, nein, früher wurden die Alten geehrt und respektiert, man schätzte sie und hörte auf sie, man war rücksichtsvoll und pflegte sie, wenn sie gebrechlich wurden!
Viele Menschen sind dieser Überzeugung, dass der alte Mensch in früheren Zeiten grundsätzlich geschätzt und geehrt worden sei. »Früher« sei es den Alten noch gut gegangen, sie hätten einen sicheren Platz in ihrer Großfamilie gehabt und seien bis an ihr Lebensende versorgt worden. Es ist ein hartnäckiger Mythos, dass alten Menschen vor dem Industriezeitalter stets Hochachtung, ja Verehrung der Gesellschaft zuteil geworden sei und die Altersdiskriminierung erst in der Moderne begonnen habe. Diese Legende wurde maßgeblich von dem kanadischen Soziologen und Stadtentwickler Ernst W. Burgess (1886–1966) befeuert, der 1962 auf einem Gerontologen-Kongress folgende, schnell klassisch gewordene und vielfach zitierte Aussage machte:
»In allen historischen Gesellschaften vor der industriellen Revolution, fast ohne Ausnahme, erfreuten sich die alternden Menschen einer vorteilhaften Position. Ihre ökonomische Sicherheit und ihr sozialer Status wurden durch ihre Rolle und ihren Platz in der Großfamilie garantiert … Dieses Goldene Zeitalter des Lebens der älteren Personen wurde gestört und untergraben durch die industrielle Revolution.«
(In all historical societies before the Industrial Revolution, almost without exception, the aging enjoyed a favourable position. Their economic security and their social status were assured by their role and place in the extended family … This Golden Age of living for older persons was disturbed and undermined by the Industrial Revolution.)2
Burgess hatte mit dieser Aussage ungeprüft ein altes Vorurteil übernommen, ohne die tatsächlichen Verhältnisse zu untersuchen. Arbeiten, die den Realitätsgehalt dieser Aussage mittels wissenschaftlicher Untersuchungen in Frage stellten, entstanden erst in den 1970er Jahren. So trugen David Hackett Fischer (*1935), Peter N. Stearns (*1936), W. Andrew Achenbaum (*1947) und andere Historiker, Soziologen und Mediziner in den letzten Jahrzehnten dazu bei, dass dieser Mythos aufgedeckt wurde. Denn in Wirklichkeit war eher das Gegenteil der Fall, wie unser nachfolgender geschichtlicher Abriss von den Biblischen Zeiten und der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit zeigen wird.
Gemeinsam ist den Wissenschaftlern heute die Erkenntnis, dass gesellschaftliche Ideale und realer sozialer Status nicht zwangsläufig miteinander konform gehen müssen und, was die ältere Generation angeht, ihr gesellschaftliches Ansehen nicht nur großen Schwankungen unterlag, sondern insgesamt eher negativ verlaufen ist.
Auch wenn dem gealterten Menschen weder durchgehend noch gerecht Respekt entgegen gebracht wird und geäußerte Wertschätzung oft genug unaufrichtig ist, hat sich die Vermittlung einer grundsätzlichen Pflicht dazu bis in die Gegenwart erhalten. In jedem halbwegs »bürgerlichen« Elternhaus lernen die Kinder nach wie vor, dem Alter Respekt zu zollen, beispielsweise, indem sie »keine Widerworte« geben, Ältere höflich grüßen, in Bus und Bahn ihren Sitzplatz anbieten, der alten Nachbarin die Tür aufhalten und vielleicht die Einkaufstasche tragen. Das gehört sich so.
Auch wenn viele Menschen sich zeitlebens dieser Erziehung gemäß verhalten, mögen ihre Gedanken und Gefühle anders aussehen. Die Ablehnung altersgebeugter Menschen, die Verachtung, ja der Abscheu vor dem körperlichen und geistigen Verfall der späten Jahre und die Klage über die Belastung durch die Alten – das sind, vorzugsweise hinter dem Rücken der entsprechenden Personen, vielleicht verlegen, doch deutlich artikulierte Gedanken und Empfindungen.
In gewisser Weise wird von unserer Gesellschaft Alter als ein Wert an sich betrachtet. In entlarvender Weise zeigt sich das, wenn ein TV-Gast aufgefordert wird, sein augenscheinlich vorgerücktes Alter zu verraten, was er oder sie, meist nach einer effektvollen Kunstpause und mit umso stolzerem Lächeln tut. Je älter die Person ist, umso intensiver brandet postwendend anerkennend-begeisterter, doch gleichzeitig spürbar gönnerhaft-geheuchelter Applaus auf. Absurd.
Alter ist sicherlich weder etwas Belangloses noch Unwichtiges, doch worin soll der Selbstwert des Alters oder das Verdienst des Alten liegen? »Alter ist kein Verdienst, sondern eine Gnade«, meint der Volksmund. Es haben eine Reihe bekannter Persönlichkeiten, von Kurt Tucholsky über Willy Brandt bis Johannes Heesters, Variationen dieses Spruchs hinterlassen; nach ihnen ist das Alter mal ein Malheur, eine Zumutung, eine Belastung, fernerhin Gnade, Glück, Geschenk. Oder handelt es sich ganz profan um nichts weiter als einen Zustand und einen natürlichen Prozess?
Alter als solches kann doch nicht als eigener Verdienst angesehen werden, der Beifall verdient hätte. Es täte manch älterem Menschen gut, sich auf das zu konzentrieren, was er oder sie in ihrem Leben erreicht, geschaffen oder unternommen hat, worauf stolz zu sein viel sinnvoller ist.
Alte Menschen stießen und stoßen auf Ablehnung und waren und sind Spott und Feindseligkeiten ausgesetzt. Wann zu Recht und wann zu Unrecht, wollen wir in diesem Buch besprechen.
Hm … aber schon die Bibel mahnt doch, dass wir Vater und Mutter ehren...?
Das stimmt. In vielen Kulturen wurden und werden die Alten in der Tat respektiert und geehrt; im Judentum gilt das Altsein gar als fast idealer Lebensumstand. Sagt die Bibel »Du sollst Vater und Mutter ehren!«, so lehrt desgleichen der Islam, die Eltern und insbesondere die Mutter – im Gegensatz zu vorislamischen Zeiten, als den Müttern keine bedeutende Rolle zugeschrieben wurde – zu ehren und zu achten. Im Koran heißt es: »Dein Herr hat bestimmt, dass … ihr gegen eure Eltern gütig seid, auch wenn der eine von ihnen oder beide bei dir ins hohe Alter kommen.«3 Der Respekt gegenüber Älteren ist nicht nur den eigenen Eltern, sondern allen Menschen im fortgeschrittenen Alter zu zollen. Dies daneben zur Absicherung des eigenen Alters: »Wenn ein junger Mensch einem alten Menschen aufgrund seines Alters Respekt erweist, schickt ihm Allah Menschen, die ihm im Alter Respekt erweisen.«4
Unbestritten ist, dass der alte Mensch hunderttausende Jahre lang als Träger des kulturellen Gedächtnisses der Menschheit galt, jener »Tradition in uns, die über Generationen, in Jahrhunderte, ja teilweise Jahrtausende langer Wiederholung gehärteten Texte, Bilder und Riten, die unser Zeit- und Geschichtsbewusstsein, unser Selbst- und Weltbild prägen«, wie Jan Assmann in Das kulturelle Gedächtnis schrieb. Die Alten vermittelten historische, religiöse, mythische und philosophische Vorbilder und gaben ihr eigenes, in einem langen Leben erworbenes Wissen weiter. Ihre Kenntnisse und Erfahrungen waren von besonderer Bedeutung für die Familie und die jüngeren Mitmenschen.
Von den Alten wurde die Weitergabe dieses Wissens erwartet, sei es im Kreis der eigenen Sippe und Dorfgemeinschaft oder im öffentlichen Raum als Ratgeber des Herrschers beziehungsweise als Kenner der Gesetze. Daneben galt das Altwerden als göttlicher Segen und Belohnung für die Frömmigkeit eines Menschen. Hierin wurzelte die Autorität der Ältesten und verschaffte ihnen eine Sonderrolle. Starke familiäre und dörfliche Bindungen garantierten ihnen Respekt und Sicherheit sowie die Möglichkeit, angesehene und ihnen vorbehaltene Funktionen auszuüben.
Gleichzeitig bestand eine feindselige und abwertende Haltung gegenüber alten Menschen. In manchen Kulturen, zum Beispiel im antiken Athen, wurden alte Menschen systematisch ausgegrenzt. Die eigene Angst vor dem Sterben und dem Tod schien angesichts des körperlichen und geistigen Verfalls der Alten reichlich Nahrung zu finden, vor allem die Angst vor dem Verlust von Selbständigkeit und Selbstbestimmung. Die skeptische bis feindselige Haltung gegenüber dem alten Menschen nahm in Zeiten großer Armut – wie etwa den europäischen Pestepidemien der frühen Neuzeit – dramatisch zu. Nach Überwindung dieser Zeiten flachte sie ab und wurde überlagert von einem Diskurs, der die Besonnenheit und Reife des Alters hervorhob und zu würdigen verlangte.
Unsere Vorfahren lebten anders zusammen als es heute üblich ist. Familie hatte eine andere Bedeutung und einen anderen Zweck als heute, das Wort selbst wird sogar erst ab Ende des 17. Jahrhunderts allmählich in die deutsche Alltagssprache übernommen. Es stammt vom lateinischen Wort familia ab und bedeutet Hausgemeinschaft. Es bezeichnete keine Verwandtschafts- sondern eine Herrschaftsbezeichnung und umfasste ursprünglich nicht die heutige Familie (Eltern und deren Kinder), sondern den gesamten Besitz eines Mannes. Bis dahin war die Bezeichnung »Haus« üblich gewesen, das sämtliche Personen umfasste, die zusammen unter einem Dach lebten. Dies konnten neben Eltern und Kindern weitere Verwandte, Groß- und Urgroßeltern, Tanten und Onkel, Nichten und Neffen, daneben das Gesinde, die Dienstboten und Diener, Knechte und Mägde, Ammen sein. Das Gesinde war in den Sorgebereich und die Ehrbarkeit des Hauses lebenslang einbezogen. Dadurch wurden ihm Unterkunft und ein gewisser sozialer Schutz gewährt, es gab indes keine Regelungen bezüglich der Arbeitszeiten und des Lohnes. Das Interesse des Einzelnen war dem des Hauses untergeordnet. Es herrschte eine Rollenverteilung im patriarchal-autoritären Sinne vor; der Mann und Hausvater hatte traditionell die leitende Rolle in der Großfamilie inne.
Die Generationen lebten in diesen Gemeinschaften keineswegs harmonischer als in modernen Gesellschaften zusammen. Es bedurfte ebenfalls der Aufmerksamkeit und Pflege des Verhältnisses untereinander; Anerkennung und Annahme der einzelnen Rollen geschah nicht von selbst. Wäre Respekt den Älteren gegenüber generell selbstverständlich gewesen, wäre wohl das vierte Gebot der Bibel gar nicht entstanden: »Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat...«
Erst recht hätte es nicht den bevorzugten Stellenwert erhalten, den es innehat. An vierter Stelle stehend ist es das erste der sozialen Gebote (und steht somit vor den Geboten: Du sollst nicht töten – Du sollst nicht ehebrechen – Du sollst nicht stehlen – Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen – Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau – Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut). Es ist interessanterweise ansonsten das einzige Gebot, das für den Fall seiner Befolgung eine Art Belohnung verspricht (… auf dass du lange lebest und dir‘s wohl ergehe …), während die anderen Gebote ohne solch positive Aussichten auskommen müssen. Dass es trotzdem ständiger Ermahnung bedurfte, zeigt die Fülle teils drastischer alttestamentlicher Drohungen: »Ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen.«5
Kulturelle Erzählungen über das Alter und das Altern sind genauso kontrovers: Das Alter erscheint gleichermaßen als Reife wie Last und ist sowohl als Erfolgs- wie Verfallsgeschichte konstruiert. Obwohl in historischen Quellen allenthalben das Hohelied der Altersweisheit erklingt, lagen Altersverehrung und Angst vor dem Alter immerzu nah beieinander. So kennt schon die griechische Literatur des 7. vorchristlichen Jahrhunderts Formulierungen wie das »schlimme«, das »kränkliche«, das »hässliche« oder gar das »verhasste« Alter.
Alter wurde gleichgesetzt mit Gebrechlichkeit und Hilflosigkeit. Oft wurde das Alter als Krankheit beschrieben und mit den Symptomen der Arthritis, der Blindheit, der Demenz und der Impotenz verknüpft. Die Missachtung der Alten beruhte möglicherweise zu allen Zeiten auf eigener blanker Zukunftsangst. Vom Altern blieb niemand verschont, der nicht in jungen Jahren starb. Darüber waren sich die Menschen natürlich im Klaren. »So werden auch wir einmal sein, so werden auch wir einmal aussehen …«
Ein eindrucksvolles Beispiel ist eine Kohlezeichnung Albrecht Dürers aus dem Jahr 1514. Sie zeigt Dürers Mutter Barbara im Alter von 63 Jahren, eine ausgemergelte, todkranke Frau, zwei Monate vor ihrem Tod in fast quälend realistischen Kohlestrichen gezeichnet. »Diese meine fromme Mutter«, schrieb Dürer auf dem Blatt, »hat 18 Kinder tragen und erzogen, hat oft Pestilenz gehabt, viel andrer schwerer und merklicher Krankheit, hat große Armut gelitten, Verspottung, Verachtung, höhnische Wort, Schrecken und große Widerwärtigkeit.« Aus seinen Worten spricht gleichermaßen Fürsorge und Mitleid mit der Mutter, wie Angst vor dem eigenen Verfall.
Zweifellos konnten nicht alle Alten auf Einfühlsamkeit der Nachkommen rechnen. Zu viel Angst vor der Zukunft lösten die hinfälligen und oft kränklichen Alten bei jenen aus, die in ihnen eine Vorschau auf ihren eigenen Lebensabend erkannten. Ihnen stecke »im Arsch das Schindermesser«, schrieb Sebastian Brant (1457–1521) in seinem Narrenschiff, einer spätmittelalterlichen Moralsatire, die sich zum erfolgreichsten deutschsprachigen Buch vor der Reformation entwickelte. Die Angst vor dem Tod schien in den gespensterhaften Alten jener Zeit reichlich Nahrung zu finden.
Einen Einwand habe ich trotzdem noch: Wie sieht es außerhalb von Europa aus? In Asien – in China, Japan, Indien…?
Asien wird allgemein gern zugesprochen, dem Alter hohen Respekt entgegenzubringen. Vor allem China und Japan seien Gesellschaften, die das Alter mehr ehrten als andere, so lautet eine weit verbreitete Annahme. Hier werde der Rat der Weisen geschätzt, die Verehrung der Eltern als Verpflichtung empfunden, die bereitwillig und aus vollster Überzeugung erfüllt werde. Dies wird ähnlich für die indischen und malaysischen Kulturkreise berichtet.
In der Überlieferung altindischer Schriften gilt der Greis, der sich zum Sterben in die Einsamkeit der Wälder zurückzieht, als verehrungswürdig. Wegen seiner Lebenserfahrung suchte man ihn als Lehrer auf, bevor er seine letzten Atemzüge tat. Bildliche Darstellungen zeigen traditionsgemäß Rauschebart und andere Insignien des Alters als Zeichen von Würde und Ansehen.
In den Ländern, die vom disziplinierenden Geist des chinesischen Philosophen Konfuzius (vermutlich 551–479 v. Chr.) geprägt waren, herrschten strenge Regeln im Umgang der Generationen. Von oben nach unten, mit Rangordnung und Prestigegefälle ausgerichtet, wiesen sie einem jeden seinen Platz im Gesellschaftsgefüge zu: Der König stand über seinen Untertanen, der Vater über dem Sohn, der Ehemann über der Ehefrau, der Bruder über der Schwester, das Alter über der Jugend. In der Ehrfurcht vor dem Alter manifestierte sich diese alles überragende Hierarchie.
Die Rangordnungen waren Instrumente der Macht – und zugleich des Machtmissbrauchs. Bedürfnislosigkeit und Unterordnung wurden von den Menschen als Tugenden erwartet. Gemeinwohl hatte vor dem Wohl des Einzelnen zu stehen.
Mit dem Aufstieg einer neuen Mittelschicht innerhalb der letzten Generationen veränderten sich weltweit Verhaltensweisen, Wünsche und Werte radikaler als es zuvor über Jahrhunderte der Fall war. Diese Entwicklungen führten in asiatischen Ländern gleichfalls zur Überforderung junger Familien und trugen zum Ansehensverlust der Alten bei. Bis in die 1990er Jahre war in China niemand außer der eigenen Familie für die älteren Verwandten zuständig. Eine Sozialpolitik, wie wir sie kennen und die den Greisen einen angemessenen, abgesicherten Lebensabend ermöglichen könnte, gibt es mit Ausnahme von Japan bislang in keinem asiatischen Land. Als Überbleibsel aus den Zeiten der Planwirtschaft ergeben sich heute Rentenansprüche nur aus den staatlich verordneten und von den Arbeitgebern zu finanzierenden Sozialfonds, die indes an einer dramatischen Unterfinanzierung leiden. Wegen der ebenfalls mehr als 30 Jahre andauernden Ein-Kind-Politik (die erst Mitte 2015 in eine Zwei-Kind-Politik geändert wurde), ist nicht nur die Anzahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter im Vergleich zum großen Rest der Bevölkerung zu niedrig, sondern sind auch die einzelnen Kleinfamilien mit der Versorgung ihrer Alten heillos überfordert. Zahllose Menschen werden auf ihre alten Tage zu Bettlern, wenn die Verwandten nicht helfen können – oder nicht wollen.
Spitzenreiter bei der Überalterung ist Japan. Die durchschnittliche Lebenserwartung der japanischen Bevölkerung ist mit über 82 Jahren nach der ehemaligen portugiesischen Kolonie Macau und dem Kleinstaat Andorra die dritthöchste weltweit6. Die Volksreligion des Shinto lehrt die Ahnenverehrung und Pflichterfüllung gegenüber den Eltern, was den japanischen Buddhismus geprägt hat. Dies fand ihren Ausdruck in speziellen Altersfeiern, die gesetzlich vorgeschrieben waren. So heißt es in einem 833 n. Chr. erschienenen Gesetzeskommentar: »Am Tag des Feldfestes im Frühling sind die Alten des Dorfbezirks einzuladen und mit einem Festmahl zu bewirten, um den Menschen den Grundsatz, das Alter zu verehren und für die Alten zu sorgen, bewusst zu machen…«
Parallel dazu betrachteten die Menschen ihre Alten stets pragmatisch-ablehnend als »unproduktive Belastung«. Ein Beispiel sind die seit dem 13. Jahrhundert nachgewiesenen Obatsuteyama-Sagen, vom Berg, auf dem man die Alten aussetzt. Dies war wohl nur im übertragenen Sinn gemeint, die Sagen berichten, dass es in früheren Zeiten zwar Sitte gewesen sei, Personen, die das sechzigste Lebensjahr erreicht hatten, auf einem Berg auszusetzen, es sich jedoch immer ein gutes Kind oder eine sonst weichherzige Person geweigert habe, dieser Sitte nachzukommen.7
In der traditionellen ländlichen Familie und Gemeinde waren alte Menschen natürliche Autoritäten, übten allerdings nach der gewöhnlich im 60. Lebensjahr erfolgten Hofübergabe keinen formalen Einfluss mehr aus. Inzwischen ist das Miteinander mehrerer Generationen unter einem Dach nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land ungleich schwieriger geworden. Dies hat zur Vereinzelung vieler alter Menschen geführt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte Japan eine hohe Selbstmordrate vorwiegend bei Greisinnen. Dies mag wohl (auch) daher rühren, was Susanne Formanek in ihrer Dissertation Die ›böse Alte‹ als Standardfigur der japanischen Populärkultur der Edo Zeit8 zusammengetragen hat: Obwohl Japan als ein Land des besonderen Respekts für die alten Menschen gelte, seien diese positiveren Altenbilder oft männlich kodiert, während für alte Frauen vielfach verunglimpfende Bilder anzutreffen seien. Dies habe sich in der japanischen Populärkultur in der Darstellung alter Frauen als bösartige, seelisch wie körperlich hässliche, despotisch-egoistische, hexerische und sogar mörderische Gestalten zugespitzt.
Der in Japan von staatlicher Seite 1966 eingeführte »Tag der Alten« (keiro no hi), der jährlich am 15. September als Nationalfeiertag begangen wird, sollte das öffentliche Bewusstsein der Japaner für die Probleme älterer Menschen sensibilisieren und Verantwortung für ihr Wohlergehen wecken.
Zusammenfassend herrscht in asiatischen Ländern bis heute eine merklich engere Familienbindung als in der westlichen Welt und spielen Traditionen gegenüber individuellen Ansichten eine deutlich größere Rolle. Aber: Der Großvater, der nichts mehr zum Lebensunterhalt beisteuern kann und »nur noch in der Ecke sitzt«, wird zur Bürde – in früheren wie in heutigen Zeiten, in asiatischen Gesellschaften genauso wie im Rest der Welt. Wobei dies heutzutage zunehmend häufiger als früher offen ausgesprochen wird.
Und Afrika? Welche Stellung genießen dort die Alten?
Dort gibt es doch einen besonderen Altenkult…
Auch die afrikanischen Kulturen haben traditionell ein positives Altersbild. In den meisten afrikanischen Ländern ist ein kulturelles Gebot verankert, das die Achtung und Pflege von alten Menschen als Pflicht der Familienmitglieder ansieht.
Die Shona, eine Sprachgruppe, der 80 Prozent der Bevölkerung Simbabwes angehören, tradieren sogar die Vorstellung, dass die Kinder, die ihre Eltern im Falle der Pflegebedürftigkeit in ein Heim geben, einem Fluch ausgesetzt seien.
Der nigerianische Schriftsteller Chinua Achebe beschrieb in seinem ersten, 1958 erschienenen Roman Things Fall Apart (In der deutschen Fassung Okonkwo oder Das Alte stürzt) die Geschichte eines Dorfes, in dem der Häuptling jeweils die Erlaubnis zum Ernten der Knollenfrucht Yams geben musste. Erst wenn er es erlaubte, durfte geerntet werden. In einem Jahr tat er es nicht; er war altersschwach und senil geworden. Die Menschen warteten und warteten. Da keine Erlaubnis zur Yamsernte kam, wagte niemand ein Zuwiderhandeln. So entstand eine Hungersnot. Achebe illustriert hier die absolute Autorität eines Alten in der ehemaligen Ibo-Gesellschaft und den Anbruch einer neuen Zeit, für die es noch keine Regeln gibt.
Trotz der wichtigen Rolle, die ältere Menschen in vorchristlichen afrikanischen Gesellschaften spielten, wurden oftmals drastische Methoden angewandt, sich ihrer zu entledigen. Formen des Verlassens, der Aussetzung und der Altentötung gab es in der afrikanischen Geschichte häufiger. Die Buschmänner in der südafrikanischen Kalahari ließen ihre Altvorderen einsam in der Wüste zurück. Man opferte mit den Schwachen und Gebrechlichen die unproduktivsten Mitglieder, um die Gemeinschaft nicht zu gefährden. Das Schicksal der Alten hing hauptsächlich davon ab, wie nützlich sie waren.9
Trotzdem: Alte Menschen gelten in Afrika als weise. Deswegen genießen sie in der Regel einen hohen Status im Kreis ihrer Großfamilie und der dörflichen Gemeinschaft. Dies geht bei den Männern mit sozialen Rollen einher, wie Dorfältester, Berater der Herrschenden, Presbyter, Priester, Geschichtenerzähler, Schlichter von Streitigkeiten oder Medizinmann, Schamane, Heiler, Regenmacher, Wettermagier, Geisterbeschwörer.
Diese öffentlichen Funktionen sind fast ausschließlich Männern vorbehalten; die Frauen genießen deutlich weniger Ansehen, dominieren allerdings innerhalb der Familie und einzelnen Gebieten der Dorfgemeinschaft, wo sie sich vielleicht auf Kräutermedizin oder Geburtshilfe spezialisieren oder für Weissagungen und Liebesmagie zuständig sind.
Hier liegt gleichzeitig eine weitere große Gefahr für die Alten im traditionellen Afrika: Der Glaube an okkulte Kräfte, Hexerei und das Übersinnliche ist bis heute weit verbreitet. Einer Untersuchung der Association for Secular Humanism (ASH) von 2012 zufolge fallen immer noch jährlich zehntausende Menschen, vor allem ältere Frauen, diesem Hexenglauben in Afrika zum Opfer. Denn das vorherrschende Stereotyp einer Person, die Hexerei betreibt, ist das einer alten Frau, obwohl zugleich Männer und in jüngerer Zeit sogar vermehrt Kinder der Hexerei beschuldigt werden. Der Philosoph Valentin Yves Mudimbe zählt diesen hartnäckigen, bis heute so lebendigen Hexenglauben (esprit sorcier) zu den größten Entwicklungsblockaden Afrikas.
Seit 1960 sind vermutlich mehr Menschen wegen Hexerei getötet worden, als während der gesamten europäischen Hexenverfolgung. Die Kräuterfrau, die Geburtshelferin, die Kupplerin gelten so lange als »gute Hexe«, wie ihre Bemühungen Erfolg zeitigen. Doch bei Missernten, Unfruchtbarkeit, tödlich verlaufenden Krankheiten oder jeglichen Schicksalsschlägen wird der Misserfolg schnell den Zauberern und Hexen zugeschrieben. Es kann sogar vorkommen, dass ihr Tod gefordert wird, um den Zustand zu bessern. Obwohl (oder weil …?) Afrika von der Globalisierung nicht unberührt bleibt, scheint der Hexenglaube weiter ein großes Problem zu sein.
Gleichzeitig verändert die zunehmende Migration von jungen Menschen in die Städte das traditionelle Senioritätsprinzip und birgt eine weitere Gefahr für die Alten. Die Großfamilie als wichtigste Versorgungsinstanz alter Menschen ist weltweit einem Auflösungsprozess ausgesetzt. Dies hat gravierende Folgen für das Generationenverhältnis. Die Mehrheit der Kinder in den Entwicklungsländern ist nach einschlägigen Untersuchungen nicht in der Lage, ihre Eltern finanziell zu unterstützen, zumal die Großfamilie aufgrund ihres Auseinanderfallens als wichtigste Versorgungsinstanz an Bedeutung verliert. Der nigerianische Menschenrechtsaktivist Leo Igwe berichtete in einem Interview von 2011: »Wenn junge Menschen sterben und es alte Mitglieder in einer armen Familie gibt, wird behauptet, die Alten verweigern sich, zu sterben und würden ihre Seelen mit den Jüngeren tauschen10«.
Das Verhältnis der Afrikaner zu ihren Ahnen beruht auf der Überzeugung, dass sie nach ihrem Hinscheiden aus diesem Leben in unsichtbarer Weise weiterleben, mit den Lebenden Verbindung halten und entscheidenden Einfluss auf das weitere Schicksal ihrer Angehörigen ausüben. Ein Schutz vor Unheil wird nach diesem Glauben nur gewahrt, wenn die Toten geliebt werden und ein gutes Verhältnis zu ihnen gepflegt wird.
Die Ahnen üben also aus dem Jenseits Einfluss auf das Dasein der Lebenden aus. Entsprechend groß ist der Respekt der Jüngeren. Wer will es sich schon mit einem zukünftigen Geist verderben?
Insgesamt können wir feststellen, dass die älteren Menschen weltweit gleichermaßen Respekt wie Ablehnung erfahren. Aufgrund der Tatsache, dass die Mehrheit der Alten außerhalb Westeuropas keine oder viel zu schmale Renten bezieht und oft bis an ihr Lebensende gezwungen ist, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, sind sie einer steigenden Verarmung und aufgrund von Traditionen oder Überlieferungen teilweise sogar der Lebensgefahr ausgeliefert, selbst wenn ihre Anverwandten grundsätzlich willig wären, sie zu unterstützen.
ALTERSLOB UND ALTERSSCHELTE, ALTERSKLAGE UND ALTERSTROST
Als Grundproblem des Menschen wird das Alter seit der griechischen Antike in der Philosophie, Kunst und Literatur diskutiert. Dabei haben sich vier unterschiedliche Diskursstrategien herausgebildet, die zwischen Verklärung und der weitaus häufiger auftretenden Klage über den körperlichen und geistigen Verfall schwanken: Alterslob und Altersschelte, Altersklage und Alterstrost.
ALTERSLOB
Das antike Alterslob betont den Erfahrungsschatz und die daraus entstehende gesellschaftliche Autorität der Alten. Gelobt werden die Fähigkeit zum erinnernden Überblick und die Bereitschaft, sich in den Dienst der Bewahrung altbewährter Traditionen zu stellen. Der Fleischeslust zu entsagen und tugendhaft zu leben, garantiere die Freiheit der Seele.
Exemplarisch für das Alterslob steht der Text Cato der Ältere über das Alter des römischen Politikers und Philosophen Marcus Tullius Cicero (106–43 v. Chr.), den wir im Prolog angesprochen haben. Das Werk steht gleichzeitig für den Alterstrost, da es alle Vorwürfe, die man dem Alter gegenüber erhebt, zu widerlegen weiß.
Für das Alterslob steht daneben Platon (428–347 v.Chr.), besonders mit seinem Text Nomoi. Die Alten, sagt er, sind erfahren, tugendsam, ehrwürdig und weise. Sie sind die idealen Hüter der Gesetze und die natürlichen Oberhäupter der Staaten. Daher fordert er für die Bekleidung wichtiger politischer Ämter ein Mindestalter von 50 Jahren, fixiert allerdings gleichzeitig ein für die einzelnen Ämter unterschiedliches Höchstalter, was das Wissen des Philosophen um die potentiellen Vorzüge wie die unausweichlichen Defizite des höheren Lebensalters unterstreicht.
Das Motiv des Alterslobs, speziell des alten Mannes und weitaus seltener der alten Frau, hält sich bis heute und bezieht sich auf unterschiedliche gesellschaftliche Funktionen: als kluger Staatsmann, großmütiges Familienoberhaupt, gütiger Großvater, platonischer Liebhaber oder altersweiser Gelehrter und Künstler.
ALTERSSCHELTE
Aristoteles (384–322 v. Chr.), ein Schüler Platons, setzt einen deutlichen Kontrapunkt zu den Ansichten Platons. Seine Rhetorik ist mit der Altersschelte verknüpft. Für den wohl vielseitigsten und produktivsten Philosophen der Antike bildet das mittlere Lebensalter das Ideal, während er die Altersgruppen der Jugend und des Greisenalters mit spezifischen Nachteilen behaftet sieht. Wo Platon die geistigen Qualitäten des Alters gegenüber den nachlassenden, nachrangigen physischen Gegebenheiten betont, sieht Aristoteles das Greisenalter von körperlichen Nachteilen dominiert und beklagt gleichzeitig charakterliche Schwächen: »Alte sehen schlecht, ihnen fallen die Zähne aus, sie zittern. Mehr noch, ihr Wesen und ihre Stimmungen entsprechen diesen physischen Defiziten: Alte sind meist schlecht gelaunt, sie sind argwöhnisch und mutlos, kleinherzig und knickerig, egoistisch und schamlos.«11 Außerdem beurteilt Aristoteles die Alten als bösartig, misstrauisch, ängstlich, feige und geschwätzig.
Die Altersschelte mit dem Altersspott verband Aristophanes (um 450 – um 380 v. Chr.), dessen Werk stets darauf abzielte, zeitgenössische Personen und Ereignisse der Lächerlichkeit preiszugeben. In seiner Komödie Die Wespen widmete er sich den Lastern, Anmaßungen und sinnlichen Ausschweifungen im Alter.
Auch in späterer Zeit war der oder die »kindische Alte« als groteske Figur ein gern gewähltes Thema. Lüsternheit, Geschwätzigkeit, Geiz, Gier, Trunk- und Streitsucht der Alten ziehen sich als Spott und Schelte durch die Literaturgeschichte. Molières Stücke Der Geizige oder Die Schule der Frauen gehören dazu, daneben Goethes Der Mann von funfzig (sic!) Jahren, spielen mit der gesellschaftlichen Erwartungshaltung an ein »altersgemäßes« Verhalten. Was bei Jüngeren anstandslos toleriert oder sogar gefördert wird, wird bei Älteren Anlass zum Spott.
ALTERSKLAGE
Die Altersklage beschreibt das Alter als scharfen Verlust und bitteren Verfallsprozess und betont die Vergänglichkeit und Vergeblichkeit. So im klassischen Text des Lyrikers Mimnermos (um 600 v. Chr.): »Wenn einmal das schmerzliche Alter da ist, das den Menschen hässlich und unnütz macht, so verlassen die bösen Sorgen sein Herz nicht mehr, und die Strahlen der Sonne spenden ihm keinen Trost. Er ist den Kindern widerwärtig, und die Frauen verachten ihn. So ist uns das Alter von Zeus gegeben, voller Leid.« Für die Altersklage, die besonders den körperlichen und geistigen Verfall beschreibt, steht der altgriechische Lyriker Anakreon (um 575–495 v. Chr.). Er beklagt den Verlust der Lebensfreude, die beginnende Gebrechlichkeit und die Angst vor dem Tod.
Die Altersklage findet sich in allen späteren literarischen Epochen, ob in den Minneliedern Walthers von der Vogelweide (um 1170–1230), im Vanitas-Motiv12 des Barock oder in der Jammerballade einer schönen Frau aus dem Goldenen Helm von François Villon (1431–1463), in der Marie – »ein Prachtweib einst!« –, in freier Übersetzung von Paul Zech, klagt: