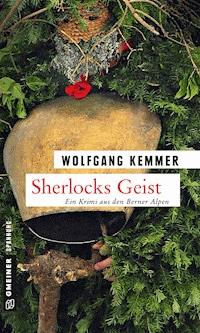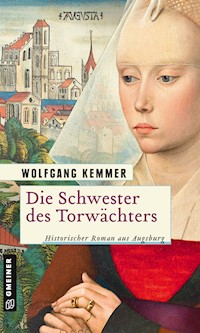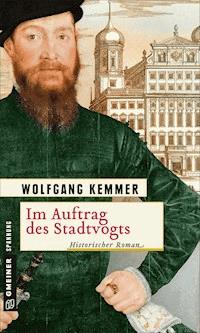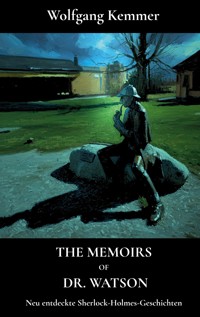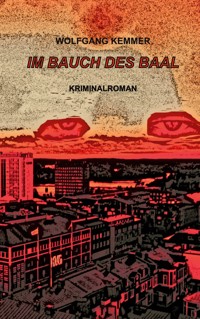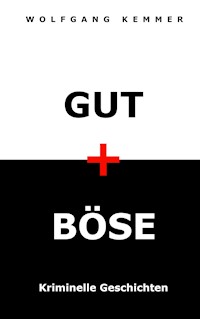
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Kemmer veröffentlicht seit fünfunzwanzig Jahren Kriminalromane und Kurzgeschichten. Dieser Band vereint erstmals sechzehn seiner besten Kurzkrimis, die alle bereits erfolgreich in verschiedenen Anthologien bzw. als Hörkrimis erschienen sind. Der Autorenanteil aus dem Buchverkauf geht in voller Höhe an den Verein "einsmehr" - Initiative Downsyndrom Augsburg und Umgebung e.V.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Kemmer, 1966 in Simmern/Hunsrück geboren, studierte Germanistik, Anglistik und Angloamerikanische Geschichte in Köln und arbeitete anschließend als Lektor in einer Literaturagentur. Heute lebt er als freiberuflicher Autor, Lektor und Dozent mit seiner Familie in Augsburg. Er schreibt Romane und Kurzgeschichten, gibt Anthologien heraus und betreute viele Jahre den Krimi-Podcast von Jokers-Weltbild. 2011 war er nominiert für den Agatha-Christie-Preis.
www.wolfgang-kemmer.de
»Ich glaube in der Tat, mit den Kirchenvätern dieser Literatur; dass der Kriminalroman die letzte noch mögliche literarische Form ist, in der die Frage von Gut und Böse verhandelt wird.«
Jörg Fauser
Inhalt
Katzenglück
Unrecht Gut ...
Schwarzer Peter
Temperantia
Tod auf dem Stabuff
Rosalie geht um
Der schwarze König
BERTOLT BRICHT
Schacher-Masoch
Das höchste Gut
Alex im Wunderland
Abgetaucht
Mauerblümchen
Große Freiheit
Warten auf Komarowski
Blutsschwestern
Katzenglück
Samuel Hellwarth, von allen meist nur Semmel genannt, stieg wie immer mit dem rechten Fuß zuerst aus dem Bett. Es war ein Ritual, das ihm in Fleisch und Blut übergegangen war, aber an diesem Morgen geschah es ganz bewusst. Er achtete sorgfältig darauf, denn es war ein besonderer Tag, und das nicht nur, weil er das Grab für seine Mutter ausheben musste.
Er ging im Schlafanzug in die Küche und machte sich ein Frühstück, bestehend aus einer großen Kanne Kaffee, zwei dicken Scheiben Weißbrot, vier Eiern und einer großen Portion Speck. Eier leistete er sich sonntags immer, aber den Speck nur deshalb, weil es heute sein großer Tag werden sollte. Und außerdem musste er stark sein. Bei seiner Mutter hatte es nur dann Eier mit Speck für ihn gegeben, wenn er wieder einmal die schweren Arbeiten übernehmen musste, die früher sein Vater erledigt hatte.
Als er fertig war, stellte er das schmutzige Geschirr zu dem übrigen Berg in die Spüle und ging wieder ins Schlafzimmer, um seine Arbeitskleidung anzuziehen, das grobe, gewürfelte Flanellhemd und die dunkelblaue Latzhose mit dem Stadtwappen darauf. Genau genommen besaß er gar keine andere Kleidung, lediglich noch einen abgetragenen, schwarzen Mantel, den Burger ihm geschenkt hatte, damit er ihn anzog, wenn er einmal als Sargträger aushelfen musste.
Burger sah es zwar nicht gerne, wenn er am Sonntag arbeitete, aber in diesem besonderen Fall würde er es nicht wagen etwas zu sagen. Schließlich hatte er ihm zunächst sogar angeboten, das Grab von einem anderen ausheben zu lassen, war dann aber wegen der zusätzlichen Unkosten doch froh gewesen, als Hellwarth dankend abgelehnt hatte.
Trotzdem rechnete Samuel mit jeder Menge Ärger. Es gab genügend Leute, die sonntags auf den Friedhof kamen, um ihre Toten zu besuchen. Wenn sie das offene Grab sahen, würde ihnen die alte Regel einfallen, die besagte, dass es bald einen weiteren Toten gab, wenn sonntags ein Grab offenstand. Und sie würden ihn dafür verantwortlich machen.
Hellwarth grinste vor sich hin. Er wusste, dass die Regel stimmte. Seitdem er Friedhofswärter war, hatte er sich daran gehalten. Als Friedhofswärter war es wichtig auf solche Dinge zu achten. Und außerdem hatte seine Mutter ihm den Respekt vor diesen »tiefen unergründlichen Weisheiten«, wie sie es genannt hatte, nur allzu schmerzhaft eingebläut.
Samuel Hellwarth ging in den Geräteschuppen und lud sich Spitzhacke und Schaufel auf die Schulter. Dann vergewisserte er sich, dass er auch den Zollstock eingesteckt hatte. Gewöhnlich brauchte er ihn nicht. Nach all den Jahren hatte er es im Gefühl, wie tief das Grab werden musste. Aber diesmal war es wichtig, das Grab tiefer zu machen, und er wollte nicht, dass irgend jemand Verdacht schöpfte. Also musste er darauf achten, dass es auch auf keinen Fall zu tief wurde.
Er ging zu dem armseligen Fleckchen Erde in der hintersten Ecke neben dem riesigen, stinkenden Komposthaufen, wo die Gräber derjenigen lagen, die sich keine normale Grabstätte leisten konnten und von der Stadt hier einen Platz zugewiesen bekamen.
»Tut mir leid Semmel«, hatte Burger gesagt, als er ihn wegen der Grabstelle gefragt hatte, und bedauernd die Achseln gezuckt. »Auch wenn du hier ja ... äh ... quasi daheim bist ... äh..., können wir da keine Ausnahme machen.«
Und damit war die Sache für ihn abgetan. An sich war Burger ja ganz in Ordnung, aber er konnte natürlich auch nicht, wie er wollte. Zumindest nicht mehr, seit dieser eingebildete Lackaffe von einem Bauunternehmer den Stadtrat samt Oberbürgermeister in die Tasche gesteckt hatte.
Mit seinem großkotzigen Freizeitbad-Projekt, dem die Sozialbauten am Stadtgraben weichen mussten, hatte er es schon geschafft, Hellwarths Mutter aus ihrer armseligen Wohnung zu vertreiben, nun gönnte er ihr nicht einmal einen ordentlichen Platz auf dem Friedhof. Dabei war das kleine Wärterhäuschen neben der Leichenhalle, in dem Hellwarth die glücklichste Zeit seines Lebens verbracht hatte, im letzten Jahr auch für sie schon fast zum Zuhause geworden. Sie hatte es abgelehnt, in ein Altenheim zu gehen und darauf bestanden, zu ihrem Sohn auf den Friedhof zu ziehen, obwohl sie nach dem Vorfall mit Rufus in all den Jahren kaum noch miteinander gesprochen hatten.
Samuel hatte sie schlecht zurückweisen können, obwohl er heilfroh gewesen war, aus der beengten Wohnung zu entkommen, in der sie nach dem Tod seines Vaters hatten hausen müssen. Nur deshalb hatte er schließlich sogar den Friedhofswärterjob angenommen, den Tom ihm verschafft hatte. Es war eines von Toms üblichen Späßchen gewesen, aber Hellwarth hatte ihn beim Wort genommen und dann war der Friedhof tatsächlich so etwas wie ein Zuhause für ihn geworden.
Und irgendwie hatte er das Gefühl, dass er im Grunde schon damals, in jener Nacht vor mehr als fünfundzwanzig Jahren, hier hängengeblieben war. Irgendwie war ihm damals schon klar geworden, dass der Friedhof einmal sein Schicksal sein würde.
Es war der heiße Sommer gewesen, in dem der alte Hutwelker endlich gestorben war. Keiner wusste genau woran, und keiner wusste genau, wie alt er eigentlich war, aber Lästermäuler sagten ihm nach, er wäre nur deshalb so alt geworden, weil er mit dem Teufel im Bunde gestanden hätte. Jedenfalls hatte Tom es zu der Gelegenheit schlechthin erklärt, endlich das Experiment mit der Katze auszuprobieren. Er hatte davon in diesem dicken Buch gelesen, in dem er immer herumschmökerte. Es handelte von zwei Jungs, Huck und Tom, die ungefähr so alt waren wie sie und unglaublich viele Abenteuer erlebten.
Tom, der eigentlich Thomas Bessen hieß, hatte das Buch in der Schule gelesen und so ein Gefallen daran gefunden, dass er sich fortan nur noch Tom nannte. Besonders fasziniert war er von der Episode, als die beiden Jungs nachts auf den Friedhof gehen, um ihre Warzen loszuwerden. Es war eine Geschichte, die er Semmel immer wieder erzählt hatte.
Angeblich brauchte man dazu eine tote Katze und das frische Grab eines alten Schurken, den garantiert der Teufel holen würde. Kam dann nachts der Teufel, um den alten Sünder zu holen, musste man ihm die Katze hinterherwerfen und eine Beschwörungsformel murmeln, die bewirkte, dass die Warzen samt Katze, Teufel und Leiche verschwanden.
Bei Tom und Huck hatte es leider nicht geklappt, weil statt des Teufels nur drei Leichenräuber gekommen waren, der junge Doc Robinson mit seinen Helfern Indianer-Joe und Muff Potter. Die waren sich dann in die Haare geraten, wobei der schurkische Indianer-Joe den jungen Doktor hinterrücks erstochen und es anschließend dem betrunkenen Muff Potter in die Schuhe geschoben hatte.
Was weiter geschah, daran konnte Semmel sich nicht mehr genau erinnern, aber die Namen und auch den Zauberspruch hatte er behalten, weil Tom Bessen ihm den Kram oft genug vorgebetet hatte:
»Teufel hinterm Leichnam her,
Katze hinterm Teufel her,
Warze hinter der Katze her,
Seh euch alle drei nicht mehr!«
Tom fand es ziemlich enttäuschend, dass der Teufel in der Geschichte nicht aufgetaucht war und wollte es daher nun selbst einmal probieren. Und Semmel wollte er mitnehmen. Tom hatte ihm das Buch gezeigt und sogar großspurig angeboten, es ihm einmal zu leihen, aber – wie Semmel insgeheim vermutetete – nur deshalb, weil er genau wusste, dass sein Freund heilfroh war, wenn er mit der blöden Buchstabiererei in der Schule zurechtkam und sich nicht auch noch zu Hause damit abplacken musste.
Sie hatten sich also für die Nacht nach der Beerdigung des alten Hutwelkers auf dem Friedhof verabredet. Tom hatte ihm genau erklärt, wie er es anstellen musste, um von zu Hause wegzukommen, ohne dass seine Mutter Wind davon bekam. Sein Vater war kein Problem mehr, seit er, von einer rätselhaften Krankheit gelähmt, nur noch im Bett lag.
Mittlerweile hatte Samuel Hellwarth zu graben begonnen und stand schon bis zu den Knien in der Grube, die am nächsten Tag den billigen Fichtenholzsarg seiner Mutter aufnehmen sollte. Die Erde war in dieser Ecke nicht allzu hart. Es war nicht viel Platz vorhanden, aber die Gräber wurden ja auch nicht wie auf dem übrigen Friedhof auf längere Zeit verkauft, sondern sollten schnellstmöglich wieder neu genutzt werden.
Hellwarth erinnerte sich daran, wie er damals Schlag halb zwölf leicht fröstelnd aus dem Bett gestiegen war. Schon damals mit dem rechten Fuß zuerst.
Er war aus dem Fenster geklettert, über das Garagendach gerobbt und die Regenrinne hinabgerutscht, genau wie Tom es ihm empfohlen hatte. Auf dem Weg zum Friedhof fiel ihm plötzlich ein, dass er selbst überhaupt keine Warzen hatte, die er zum Teufel wünschen konnte. Sicher hatte Tom welche. Tom dachte gewöhnlich an alles. Er hatte auch versprochen, eine tote Katze zu besorgen.
Vor dem Eingang wollten sie sich treffen. Es war zehn vor zwölf. Tom war noch nicht da. Vielleicht war er nicht von zu Hause fortgekommen. Oder der alte Klugscheißer hatte am Ende gar Schiss!
Als Semmel zögernd das ächzende alte Holztor zum Friedhof aufzog, um nachzusehen, ob er vielleicht schon zum Grab des alten Hutwelkers vorgegangen war, packten ihn zwei Hände von hinten an der Kehle und drückten zu. Semmel schlug wild um sich und versuchte nach hinten zu treten. Er traf etwas. Der Griff an seiner Kehle lockerte sich. Semmel schnappte nach Luft und riss sich los.
»Sachte, sachte«, beschwichtigte Tom. »War doch nur ein Spaß!«
»Schöner Spaß, verdammter Scheiß!« Semmel fasste sich an die Kehle. »Haste wenigstens die Katze?«
»Klaro, die liegt schon am Grab. Komm schnell, sonst ist der Teufel noch vor uns da!«
Irgendwie schien Tom die Sache mit dem Teufel nicht allzu ernst zu nehmen. Zumindest schien er keine Angst zu haben, wie Semmel erstaunt feststellte. Er selbst zitterte immer noch am ganzen Körper nach der unerwarteten Attacke von hinten. Trotzdem folgte er Tom zum Grab des alten Hutwelkers. Es lag in der hintersten Ecke neben dem Komposthaufen. Der alte Hutwelker war ein armer Schlucker gewesen, der sicher mehr als die Hälfte seines Lebens im Knast verbracht hatte. Er hatte keine Verwandten, die sich um ihn oder sein Grab gekümmert hätten, obwohl es angeblich einen Sohn gab, der aber, dem Vernehmen nach, genauso ein Taugenichts wie sein Vater geworden war und sich irgendwo im Ausland herumtrieb.
Samuel Hellwarth war mit seiner Arbeit gut vorangekommen und stand nun schon bis zum Scheitel in der Grube. Dabei schwitzte er wie ein Schwein, arbeitete aber verbissen weiter, bis er glaubte tief genug zu sein. Dann zog er den Zollstock aus der eigens dafür bestimmten Seitentasche seiner Arbeitshose und maß nach. Es war tief genug. Er schwang sich aus dem Grab, setzte sich auf den frischen Erdhügel daneben und drehte sich eine Zigarette.
Auf dem schmucklosen, frischen Erdhügel unter dem damals der alte Hutwelker auf den Teufel wartete, lag Rufus, der schwarze Kater seiner Mutter, mit eingeschlagenem Schädel. Semmel erkannte ihn nur noch daran, dass ihm das linke Auge fehlte. Der kleine weiße Flecken an seinem Hals war dunkel von verkrustetem Blut.
»Hab das Vieh von seinem Leiden erlöst«, sagte Tom schnell, bevor Semmel sich von seinem Entsetzen erholt hatte. »Hat doch eh nichts mehr gesehen und keine Mäuse mehr fangen können.«
Semmel ballte die Fäuste und stöhnte.
»Ging auch ganz kurz und schmerzlos. Ist gar nichts dran an dem Spruch, dass Katzen angeblich neun Leben haben. Ich hab ihn einfach an den Hinterläufen gepackt und ein paarmal mit dem Kopf gegen die Garagenwand gedonnert.«
»Meine Mutter ...«, stammelte Semmel. »Meine Mutter ....«
»Ach was, deine Mutter, hast du nicht selbst immer gesagt, dass sie eine alte Hexe ist! Und ist sie nicht auch immer zum ollen Hutwelker gelaufen? Und jetzt ist auch noch dein Papa krank. Und das mit dem Auge warst schließlich du, wenn ich dich daran erinnern darf.«
»Aber ... aber das war doch 'n Unfall!«
»Schluss jetzt, es ist gleich zwölf, wir müssen uns verstecken, sonst nimmt uns der Teufel gleich mit!« Tom zog ihn kurzerhand hinter die niedrigen Büsche, die den Komposthaufen einfassten. Es stank nach Fäulnis und Verwesung.
Nachdem die Turmuhr der nahen Liebfrauenkirche Mitternacht geschlagen hatte, harrten sie beklommen der Dinge, die da kommen sollten. Semmel wagte es nicht mehr, den Mund aufzumachen. Das leise Rascheln der Bäume und Büsche im Wind, das ferne Bellen der Hunde, das Miauen einer Katze, das alles schien ihm das Nahen des Teufels anzukündigen, und jedes noch so kleine Geräusch jagte ihm immer wieder eine höllische Angst ein.
Tom dagegen schien sich mehr und mehr zu entspannen, je länger der Teufel ausblieb. Ja, Semmel schien es fast, als ob er die Situation außerordentlich genoss. Vor allem Semmels Angst. Aber auch Tom schwieg. Erst als die Turmuhr zwei schlug, gähnte er herzhaft und sagte dann seelenruhig, aber so laut, dass es Semmel förmlich durch die Nacht zu hallen schien: »Ich glaube, ich muss jetzt doch mal wieder nach Hause. Ich schreib nämlich morgen eine Lateinklausur.«
Tom ging damals schon in die sechste Klasse des Gymnasiums, während es bei Semmel nur knapp für die Hauptschule reichte. Bis zur dritten Klasse hatten sie gemeinsam die Grundschule besucht, dann war Semmel hängengeblieben. Es war von Anfang an eine ungleiche Freundschaft zwischen ihnen gewesen, die sich – wie viele Freundschaften – mehr aus Gelegenheit und einer gewissen Gewohnheit ergeben hatte, denn aus echter Sympathie füreinander.
Samuel Hellwarth seufzte und warf die Kippe ins Grab. Gleich darauf durchzuckte es ihn. War das nicht auch ein schlechtes Omen? Hatte seine Mutter ihm nicht immer eingeschärft, nie etwas in ein Grab fallen zu lassen? Hieß es nicht, wenn einem etwas in ein Grab fiel, dass man selbst bald nachfolgte? Dann schüttelte er entschieden den Kopf. Schließlich war ihm die Kippe nicht hineingefallen, sondern er hatte sie reingeworfen. Hellwarth wusste, dass es in diesen Dingen auf solch feine Unterschiede ankam. Er stand auf, maß dabei mit Kennerblick noch einmal die Tiefe des Grabes, schulterte Schaufel und Spitzhacke und ging zurück zum Geräteschuppen.
Tom war damals tatsächlich einfach nach Hause gegangen. Ohne ein weiteres Wort hatte er Rufus auf den stinkenden Kompost geworfen und war nach Hause gegangen. Und Semmel hatte immer noch keinen Ton herausgebracht, sondern ihm nur mit weit offenem Mund hinterhergestarrt.
Erst als er Toms Schritte nicht mehr in der Ferne auf dem Straßenpflaster hören konnte, hatte auch er sich hinter den Büschen erhoben und Rufus aus der Mistgrube herausgeholt. Er mochte den Kater nicht sonderlich, vor allem deshalb nicht, weil seine Mutter mit einer ihm völlig unverständlichen Affenliebe an ihm hing. Er schlief sogar in ihrem Bett, während sein Vater auf die schmale Couch im Wohnzimmer ausquartiert worden war. Er hatte darauf bestanden, tagsüber nicht im Bett liegen zu wollen, und so musste er nun nicht jeden Morgen und Abend die steile Treppe hoch- und runtergeschleppt werden.
Als Semmel mit der toten Katze nach Hause kam und sich vor der Haustür hinabbeugte, um sie niederzulegen, als sei sie vielleicht von einem Auto angefahren worden und habe sich gerade noch so weit schleppen können, traf ihn etwas Hartes am Kopf. Er taumelte, ließ die Katze fallen und fiel vornüber auf sie. Gleich darauf ergoss sich eine stinkende Flüssigkeit über ihn. Im Rahmen der geöffneten Tür stand seine Mutter und hielt den Nachttopf seines Vaters in der Hand.
»Du Schwein«, sagte sie kalt. »Du gottverfluchter kleiner unnützer Saukerl! Der Teufel soll dich holen!« Dann drehte sie sich um und schlug ihm die Tür vor der Nase zu.
Er hätte versuchen können, auf dem gleichen Weg wieder in sein Zimmer zu kommen, auf dem er auch herausgekommen war, ließ es aber bleiben. Er ließ die Katze liegen, setzte sich auf der anderen Straßenseite in den Rinnstein und wartete.
Als es Tag wurde, öffnete seine Mutter kurz die Tür und holte die Katze herein. Wenig später kam sie wieder heraus und grub mühevoll, nur mit dem Spaten, ein kleines Loch in den schmalen Streifen festgestampften, steinigen Bodens zwischen Türschwelle und Bürgersteig. Als sie fertig war, holte sie etwas aus dem Haus, legte es hinein und machte das Loch wieder zu. Semmel hatte zwar nicht genau erkennen können, was es war, wusste aber, dass es der Schwanz des toten Rufus sein musste. Ein Katzenschwanz vor der Haustür eingegraben hielt Krankheiten fern.
Als sie fertig war, winkte sie ihn heran. »Ich weiß, dass du es nicht allein warst«, sagte sie. »Dieser Bessen-Taugenichts war dabei, nicht wahr? Er hat dich angestiftet, ich weiß es.«
Sie nahm ihn mit hinein. Im Flur hörte er seinen Vater durch die halb geöffnete Wohnzimmertür stöhnen. Sie gingen in die Küche. Auf dem Tisch lag, an einem dünnen Lederbändchen befestigt, ein kleines schwarzes Etwas, das Semmel erst auf den zweiten Blick als eine sorgsam präparierte Pfote der toten Katze ausmachen konnte. Semmel wandte sich ab.
»Schau her«, sagte sie. »Dieses Bändchen mit der Pfote wirst du deinem feinen Freund schenken. Du wirst es ihm eigenhändig um den Hals hängen und ihm sagen, es sei ein Glücksbringer, ähnlich wie eine Hasenpfote, nur mit viel stärkerer Wirkung. Hast du mich verstanden?«
Semmel nickte.
»Sag ihm auf keinen Fall, dass ich dir die Pfote gegeben habe!«
Samuel Hellwarth bekreuzigte sich, als er kurz am Grab seines Vaters stehenblieb. Für ihn hatte es noch zu einer ordentlichen Grabstätte gelangt. Samuel hatte sich oft gefragt, woher seine Mutter ihre Weisheiten bezogen hatte, die für ihren seltsamen Ruf in der kleinen Stadt verantwortlich gewesen waren. Ab und an waren Leute zu ihr gekommen, damit sie für sie betete oder ihnen oder ihren Tieren die Hand auflegte, aber die Zahl derer, die steif und fest behauptet hatten, sie stehe, ebenso wie der alte Hutwelker, mit dem Teufel im Bunde, hatte immer überwogen.
Zwei Tage später hatte er Tom Bessen das Band mit der Pfote gegeben.
»Na, du hast das Ding von deiner Mutter, was?«, sagte der spöttisch. »Sicher hat sie die Pfote verflucht und glaubt nun, mich damit ins Unglück zu stürzen, die alte Hexe. Und weißt du was? Ich werde das Halsband sogar tragen. Spätestens seitdem der Teufel nicht erschienen ist, glaube ich nämlich nicht mehr an so einen Quatsch. Und soll ich dir noch was sagen?« Seine Stimme nahm einen triumphierenden Ton an. »Ich habe überhaupt keine Warzen!«
»Wie .. wieso?«
»Es war nur so eine Art Test, das auf dem Friedhof.«
»Du hast gar nicht wirklich dran geglaubt, dass der Teufel kommt? Du hast Rufus nur wegen eines blöden Tests getötet?«
Bessen grinste verächtlich. »Ach, ihr Hellwarths seid doch einfach zu einfältig. Und deine Mutter ist tatsächlich eine alte Hexe, wie die Leute immer sagen. Aber ich hab keine Angst vor ihr. Der Hokuspokus wirkt nämlich nicht, wenn man nicht an ihn glaubt, sagt mein Religionslehrer. Jetzt weiß ich, dass er Recht hat. Und ich werd dir noch was sagen: Ich bin jetzt sogar fest überzeugt, dass die Pfote mir Glück bringt, nur weil ich es so will.«
Fünfundzwanzig Jahre später war Thomas Bessen der reichste Mann der Stadt und trug die Pfote immer noch am Hals. Er zeigte sie gerne in der Öffentlichkeit, wenn man ihn nach dem Geheimnis seines Erfolges fragte. Und er hatte sie auch Hellwarth noch einmal gezeigt, nachdem er ihm den Job auf dem Friedhof verschafft hatte, quasi als Dank für den »Glücksbringer«, den dieser ihm einst gegeben hatte.
Samuel Hellwarth spuckte aus. Dann öffnete er die Tür zum Schuppen und stellte Hacke und Schaufel in die Ecke zu den übrigen Gerätschaften. Auf der Schubkarre lag das schwere Brecheisen, mit dem er schon einmal, kurz vor der Beerdigung, in der Leichenhalle einen Sarg hatte öffnen müssen, weil der Tochter der Toten im letzten Augenblick eingefallen war, dass ihre Mutter ihr einen Diamantring versprochen hatte, den sie immer noch am Finger trug.
Hellwarth nahm das Brecheisen und wog es in der Hand. Dann spuckte er wieder aus. Allein schon der Gedanke, Bessen könnte glauben, er, Samuel Hellwarth, schulde ihm was, verursachte ihm einen schlechten Geschmack im Mund. Er legte das Brecheisen zurück auf die Schubkarre. Nichts schuldete er ihm, rein gar nichts. Im Gegenteil. Er würde die Sache richtigstellen.
Hellwarth schloss den Schuppen ab und ging in das kleine Wärterhäuschen. Dass er hier wohnen durfte, verdankte er nicht Bessen, sondern der Wiederbelebung einer alten Tradition. Es hatte früher immer einen Custos hier gegeben, der die Ruhe der Toten bewachte. Dann hatte das Häuschen neben der Friedhofspforte jedoch jahrzehntelang leergestanden, weil sich niemand mehr dazu bereitgefunden hatte, dort einzuziehen.
Auf einer Bürgerversammlung, bei der auch die jüngsten Grabschändungen durch betrunkene Jugendliche diskutiert worden waren, hatte Burger mehr im Scherz den Vorschlag gemacht, die Custos-Stelle wieder zu besetzen, und Bessen war sofort darauf angesprungen. Er hatte Hellwarth kurz zuvor unter den Zuhörern entdeckt und ihn für den Posten vorgeschlagen. Hellwarth ging zu allen Bürgerversammlungen, seit Thomas Bessen dort das große Wort führte. Er wartete auf eine Chance. Und hinter diesem wohl eigentlich nur als Demütigung gedachten Angebot hatte er eine Chance gewittert.
Hellwarth wärmte sich einen Eintopf auf, den er dann direkt aus der Dose löffelte. Das Bier, das er sich sonst sonntags gönnte, versagte er sich heute. Er musste nüchtern bleiben. Nach dem Essen legte er sich in Kleidern und Schuhen aufs Bett und schloss die Augen. Er hatte noch jede Menge Zeit, bis es so weit war, aber er schlief nicht, sondern grübelte, ob wohl tatsächlich alles glattgehen würde.
Wenn Bessen vielleicht gar nicht kam? Oder noch jemanden mitbrachte? Er lief ja meist mit einem Bodyguard durch die Gegend, denn er hatte nicht nur Freunde in der Stadt. Aber nein, die Blöße würde er sich wohl nicht geben. Das ließ sein Hochmut nicht zu. Wenn er überhaupt kommen würde, dann kam er auch allein. Und Hellwarth war sicher, dass er kommen würde. Aber vielleicht hatte er eine Waffe dabei. Vielleicht ahnte er ja, dass es Samuel nicht nur um einen simplen Erpressungsversuch ging, sondern dass es diesmal um alles ging, dass es ihm ans Leder gehen sollte.
Als es allmählich Zeit wurde, sich fertigzumachen, ging Samuel Hellwarth noch einmal in die Leichenhalle zum Sarg seiner Mutter und klopfte dreimal darauf. Es war eines der Rituale, denen er nicht allzuviel Bedeutung beimaß, weil sie durch ständigen Missbrauch praktisch entwertet waren. Heutzutage klopfte jeder Blödmann wegen jeder Kleinigkeit auf Holz und ärgerte sich dann, dass die erhoffte Wirkung ausblieb. Trotzdem war es ihm wichtig, noch einmal den Sarg zu berühren, bevor es losging.
Die Turmuhr schlug Mitternacht, als er an der frischausgehobenen Grube neben dem stinkenden Komposthaufen anlangte. Thomas Bessen wartete schon auf ihn. Er war allein.
»Da wären wir also wieder«, sagte er. »Lang, lang ist's her.«
Hellwarth schwieg.
»Was starrst du mich so feindselig an? Das war doch ein Scherz mit dem Brief oder? Ein Vorwand um mich hierher zu locken? Um der alten Zeiten willen, was!«
Hellwarth schwieg weiter.
Bessen runzelte die Stirn. »Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, mich damit erpressen zu können, dass ich vor mehr als zwanzig Jahren die Katze deiner Mutter getötet habe!«
Hellwarth zog die Brechstange aus dem Stiefelschaft, in den er sie hineingesteckt hatte, weil Bessen sie nicht sofort hatte sehen sollen. »Ich bring dich um!«
»Was?«
»Ich bring dich um!«
»Du bist verrückt, Semmel! Du mochtest deine Mutter nicht, und du mochtest auch damals die verdammte Katze nicht. Warum in drei Teufels Namen also willst du mich nun umbringen?«
»Du hast Recht«, sagte Hellwarth. »Ich mochte meine Mutter nicht, und ich mochte auch die Katze nicht. Aber dich mag ich noch viel weniger. Du mieses Schwein, du!«
»Immerhin waren wir mal so was wie Freunde.«
»Freunde? Ein Scheißdreck waren wir. Du hast dich doch immer nur lustig gemacht über mich und auf meine Kosten geglänzt. Neben 'nem Dummkopf wie mir, war das ja nicht schwer für dich. Aber auch 'n Dummkopf hat mal seinen großen Tag. Und der is heute.«
»Es wäre wirklich eine große Dummheit, wenn du mich umbringst, Semmel.« Bessen tat amüsiert. »Wie willst du es denn anstellen?«
»Ich werd dich hier im Grab meiner Mutter verscharren. Unter ihrem Sarg wird niemand nach dir suchen. Sie war's, die mich auf die Idee gebracht hat. Kurz vor ihrem Tod, sagte sie noch, jetzt muss ich sterben und das Schwein, das meinen Rufus getötet, mich Zeit meines Lebens verhöhnt und auf meine alten Tage noch aus meiner Wohnung gejagt hat, lebt weiter. Aber ich versprech dir mein Sohn, ich werd ihm noch im Grab das Leben zur Hölle machen! Genau so hat se gesagt.«
»Sehr apart, ich muss schon sagen. Die Alte war wirklich noch verrückter als ich immer gedacht habe. Aber ich hätte nie vermutet, dass sie so einen Hass auf mich hatte. Nur wegen dieser blöden Katze!«
»Du hattst Recht damals«, sagte Hellwarth. »Sie hat die Pfote verflucht. Und dann hattst du die Frechheit, überall damit als Glücksbringer rumzuprotzen. Und dann noch das mit der Wohnung ...«
Bessen schüttelte den Kopf. »Man sollte es wirklich nicht glauben, aber in diesem Hinterwäldlerkaff regiert der Aberglaube fast noch wie im Mittelalter.« Er grinste. »Naja, immerhin habe mir das schließlich ja auch ein wenig zu Nutze gemacht. Es ist schon erstaunlich, wie sehr die Idee, die Pfote als Glücksbringer herumzuzeigen, zu meiner Popularität in diesem Nest hier beigetragen hat. Aber um so was zu verstehen, bist du ja zu blöd.«
Im nächsten Augenblick stürzte Hellwarth mit der Brechstange auf ihn los. Bessen wich aus. Der Schlag ging ins Leere, und die Wucht ließ Hellwarth taumeln. Bessen stellte ihm ein Bein. Hellwarth verlor die Brechstange, die mit einem dumpfen Ton ins Grab fiel. Er selbst landete auf der ausgehobenen Erde daneben.
Bessen kicherte. »Semmel, Semmel, du warst schon immer so dumm wie ein Brot.«
Hellwarth rappelte sich auf. Mit bloßen Händen ging er erneut auf Bessen los und fuhr ihm an die Kehle. Eine Weile rangen sie verbissen und bewegten sich dabei wie in einem stummen, geisterhaften Tanz um das Grab. Dann verlor Bessen plötzlich den Halt auf dem frisch ausgehobenen Erdhügel. Er rutschte ab, taumelte und drohte ins Grab zu fallen. Hellwarth, der ihn immer noch an der Kehle gepackt hielt, merkte es und ließ los. Bessen klammerte dafür um so fester. Einen Augenblick sah es aus, als sollten beide hineinfallen. Dann stürzte nur Hellwarth, von Bessens Schwung getragen, an diesem vorbei in die Grube, während Bessen sich noch rechtzeitig gelöst hatte.
Es gab ein ähnlich dumpfes Geräusch wie beim Fall des Brecheisens, nur ungleich lauter.
»Armer Irrer!« sagte Bessen und warf seinem Kontrahenten eine Handvoll Erde hinterher. »Aus dem Verkehr ziehen sollte man dich. Ich werde dafür sorgen, dass man dich einsperrt.« Ohne auch nur noch einen Blick ins Grab zu werfen, drehte er sich auf dem Absatz um und ging davon.
Am nächsten Tag fand man die Leiche Samuel Hellwarths im Grab seiner Mutter. Er war so unglücklich gestürzt, dass er sich das Genick gebrochen hatte. Unter der Leiche lag ein Brecheisen. Mit seiner rechten Hand hielt er das allseits bekannte Lederbändchen mit der Katzenpfote umklammert. Thomas Bessen wurde wegen des dringenden Verdachts auf Totschlag an seinem einstigen Schulfreund festgenommen.
In der U-Haft geriet er beim Hofgang mit einem älteren Mithäftling aneinander. Der Mann war ein Gewohnheitsverbrecher und fackelte nicht lange. Er schnitt Bessen mit einer Spiegelscherbe die Kehle durch. Der Mann hieß Rufus Hutwelker.
Unrecht Gut ...
Das Kloster hatte sich ganz schön herausgemacht, seitdem Georg Paulmann das letzte Mal hier gewesen war. Mehr als zwanzig Jahre war das jetzt schon her.
Damals hatte alles reichlich heruntergekommen gewirkt und der Zahn der Zeit sichtlich an den Gebäuden genagt, seit den Tagen, da der heilige Leonhard mit seinem Wanderstab in der Erde hängen geblieben war und dabei eine Quelle entdeckt hatte, mit deren Wasser man angeblich allerlei Viehseuchen kurieren konnte. Zu dem Kuhkaff, aus dem Paulmann stammte, passte es, die jährliche Wallfahrt ausgerechnet hierher zu veranstalten.
In neuerer Zeit waren Wunder an wahnsinnigen Rindviechern und verpesteten Schweinen zwar gefragt, trotzdem staunte Paulmann, wo der Wohlstand des Klosters wohl herrühren mochte. Das Gerücht, das Wasser schaffe auch Abhilfe bei menschlichen Potenzbeschwerden und wirke fast so gut wie Viagra, wurde von Abt Reginald in den Medien immer wieder voller Entrüstung höchst werbewirksam dementiert, dennoch bezweifelte Paulmann, ob dies allein schon für das erstaunliche Aufblühen des Klosters verantwortlich sein konnte. Seiner Erfahrung nach folgten Wallfahrer, so wie andere Menschen, auch dem Herdentrieb und pilgerten lieber zu den Wundern von Fatima und Lourdes als zum Kloster von St. Leonhard, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagten und es außer einem mickrigen Devotionalienlädchen und einem in einfachstem Brauhausstil gehaltenen Gasthaus rein gar nichts gab.
Fakt war dennoch, dass die Kirche einen frischen Anstrich hatte, die Wirtschaftsgebäude saniert und erweitert worden waren und eine neue Pilgerhalle samt Beichtkapelle an die