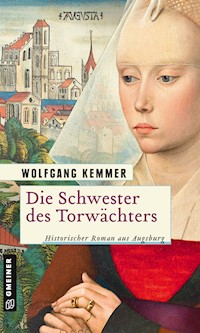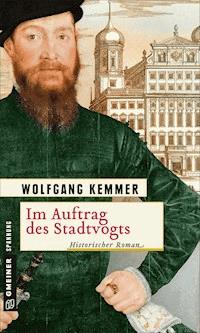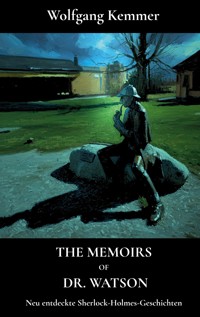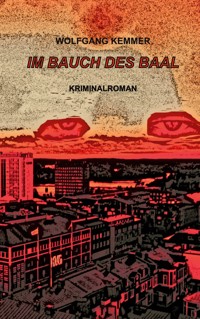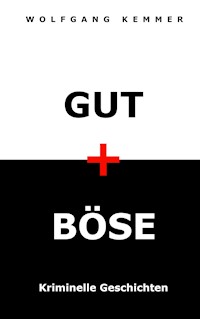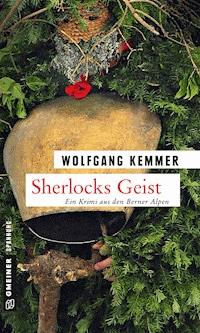
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Denise Hostettler
- Sprache: Deutsch
Kurz vor Silvester treibt in Meiringen ein Serienmörder sein Unwesen. Seine Opfer wurden alle mit Mordwaffen aus Sherlock-Holmes-Geschichten getötet und seltsamerweise tragen sie alle den Namen eines italienischen Geheimbündlers aus dem 19. Jahrhundert. Als auch noch ein mysteriöses Sherlock-Holmes-Double auftaucht, steht Denise Hostettler von der Kantonspolizei Bern vor einem rätselhaften Geflecht aus historischen Fakten, Fiktion und gegenwärtigem Entsetzen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Kemmer
Sherlocks Geist
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2015
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Fulcanelli – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4768-6
Widmung
Für Dorothee
Prolog
Beim Anblick des Alpenstockes überlief es mich eiskalt. Er war also nicht nach Rosenlaui gegangen. Er war auf dem drei Fuß breiten Pfade geblieben, links die himmelhohe Felswand, rechts den gähnenden Abgrund neben sich, bis sein Feind ihn eingeholt hatte. Der junge Schweizer war gleichfalls verschwunden. Dieser stand vermutlich in Moriartys Solde und hatte die beiden miteinander allein gelassen. Und was war dann geschehen? Wer sollte uns das sagen? Einige Augenblicke hielt ich an, denn ich war vor Schreck völlig betäubt.
Der Mann im grau-karierten Inverness-Mantel machte eine effektvolle Pause und hob den Blick von dem abgegriffenen Buch in seinen Händen. Trotz der Hitze schien er in seiner Kleidung nicht zu schwitzen, sondern trug sogar noch eine dazu passende karierte Deerstalker-Mütze. Immerhin hatte er die Ohrenwärmer und den Nackenschutz oben auf dem Kopf zusammengebunden. Er war etwa Mitte 40, groß und schlank, fast hager und seine scharfen Augen in dem eckigen, raubvogelhaften Gesicht blitzten, als er nacheinander die wenigen Zuhörer, die ihn umstanden, fest ansah.
Es waren ein sommersprossiger Bub von vielleicht neun oder zehn Jahren, der gebannt gelauscht hatte und den Fremden nun mit aufgesperrtem Mund anstarrte, eine ältere Dame, die auf dem Sitz ihres Gehwägelchens saß, sich von Zeit zu Zeit mit dem verknoteten Taschentuch, das sie als Sonnenschutz auf dem Kopf trug, den Schweiß abwischte und ihrem geistesabwesenden Gesichtsausdruck nach zu urteilen gar nicht verstand, um was es ging, und ein junger Mann in korrekt gebügelter Bundfaltenhose und einem bis an den Hals zugeknöpften kanariengelben Polo-Shirt, der aufmerksam zugehört hatte, dessen finstere Miene jedoch nicht gerade ungeteilte Freude an dem Vortrag signalisierte.
Ansonsten war der Platz vor der kleinen Englischen Kirche in Meiringen leer. Die Bänke, welche die halb vertrocknete Grünfläche mit der Sherlock-Holmes-Statue umstanden, waren verwaist, und auch an den Kaffeehaustischen des benachbarten Parkhotels du Sauvage saßen um diese Zeit nur wenige Gäste, die sich ebenso wie die gelegentlichen Passanten nicht an dem merkwürdig angezogenen Mann mit dem stark ausgeprägten englischen Akzent störten.
Den schien die geringe Zuhörerzahl nicht weiter zu kümmern, denn er fuhr mit seinem Vortrag sogleich fort, wobei er recht mühelos die auf der Bahnhofstraße vorbeifahrenden Autos übertönte:
Dann kam mir allmählich die Erinnerung wieder an die Methode, nach der Holmes in solchen Fällen zu verfahren pflegte, und mit Hilfe derselben wollte ich nun den Versuch machen, mir über den erschütternden Vorfall Klarheit zu verschaffen. Es war – ach! – nur zu leicht.
»Ach!«, echote die alte Frau mit dem Rollator, was den Vortragenden erneut kurz aufblicken ließ. Sie setzte gleich noch ein aus tiefstem Herzen kommendes »Ach Gott, ach Gott!« hinzu, was ihr einen verärgerten Blick des Buben eintrug, der gerne weiterhören wollte. Der Engländer mit dem auffälligen Äußeren tat ihm den Gefallen.
Holmes’ Gebirgsstock lehnte noch an derselben Stelle, wo wir auf dem schmalen Pfade im Gespräch Halt gemacht hatten. Der unaufhörlich heraufsprühende Wasserstand erhält den schwärzlichen Grund des Pfades stets weich, so dass sich jede leiseste Spur darin abdrückt. Eine doppelte Reihe von Fußstapfen lief auf dem Pfade ganz deutlich wahrnehmbar in der Richtung gegen dessen hinteres Ende hin. Zurück führte keine Fußspur. Wenige Meter vor dem Ausgang des Pfades war dieser gänzlich aufgewühlt und in eine Schmutzlache verwandelt, und die Brombeersträucher und Farne am Saume des Abgrundes waren zertreten und beschmutzt.
»Jaja«, klagte die alte Frau betrübt. »Immer ist alles so dreckig heutzutage. Keiner gibt mehr richtig acht.«
Während der Vortragende nun zu wissen schien, woran er mit der Alten war und unbeeindruckt weiterlas, hatte sich das Unbehagen im Gesicht des jungen Mannes während der letzten beiden Unterbrechungen verstärkt und er war zwei Schritte näher an die sitzende Sherlock-Holmes-Statue und sein daneben stehendes lebendiges Abbild herangetreten. Er wollte gerade den Mund aufmachen, um etwas zu sagen, als der Rezitator ihm zuvorkam:
Auf dem Gesichte liegend, spähte ich hinab in den Wasserstaub, der mich von allen Seiten umsprühte. Es war seit meinem Aufbruch allmählich dunkel geworden, und so war ich jetzt nur noch imstande, den Schimmer der Feuchtigkeit auf den schwarzen Felswänden und weit unten am Ausgang der Schlucht das Aufspritzen der Sturzwellen zu unterscheiden. Abermals rief ich; aber nichts traf mein Ohr, als wiederum jener einem menschlichen Schrei ähnelnde Klang des Wasserfalles.
Wieder hielt der Lesende inne. Diesmal offenbar eine bewusste Kunstpause, die der junge Mann nutzte, um nun endlich dazwischenzugehen: »Was soll denn das?«, rief er verärgert. »Was bezwecken Sie eigentlich mit dieser jämmerlichen Vorstellung?«
Der Vortragende zog die Brauen hoch und musterte den Störenfried erstaunt. »Ich erweise dem Meisterdetektiv meine Reminiszenz, indem ich aus dem Kanon vortrage«, erwiderte er würdevoll.
»Und warum lesen Sie dann nicht mal was anderes? Eine Geschichte, in welcher die wahre Leistung Conan Doyles deutlich wird?«
»Und worin liegt die Ihrer geschätzten Meinung nach?«, fragte der Engländer höflich.
»Darin, dass er seinen Protagonisten mit der deduktiven Methode arbeiten lässt, die bis dato von Poe in dessen Detektivgeschichten ja lediglich angedacht war.« Der Mann winkte verächtlich ab. »Aber Sie lesen natürlich lieber aus diesem unsäglichen ›Letzten Problem‹, einer fast reinen Spannungsgeschichte, die dem Titel eigentlich gar nicht gerecht wird, weil es überhaupt nicht um eine logische Problemlösung geht.«
»Ach ja«, seufzte die alte Dame. »Immer nur Probleme und keine Gerechtigkeit!«
»Junger Mann«, sagte der Engländer, der sich davon nicht beirren ließ. Wenn er sprach, war sein Akzent sogar ausgeprägter als beim Lesen, wirkte fast schon gekünstelt. »Sie scheinen ein ausgesprochener Holmes-Experte zu sein. Welche Story würden Sie denn bevorzugen?«
»Ich würde es ehrlich gesagt bevorzugen, wenn Sie gar nichts lesen würden, denn ich kann dem Chaschperli-Theater, das Sie hier aufführen, nicht viel abgewinnen. Holmes hin und Reminiszenz her – haben Sie überhaupt eine Genehmigung? Haben Sie die Lesung angemeldet? Wo kommen wir denn hin, wenn hier jeder überall einfach so vorliest, wenn’s ihm gerade in den Sinn kommt?«
»Gerade so ein Unsinn!«, echote die alte Dame. »Wo kommen wir denn hin?«
Der kleine Junge starrte sie wütend an. »Weiterlesen!«, rief er trotzig.
Ein paar Passanten blieben stehen. Der schrullige Mann im Inverness-Mantel, der seit Tagen neben der Sherlock-Holmes-Statue immer denselben Text las, war ihnen vertraut, neu war nur, dass sich jemand mit ihm anlegte. Der Engländer lächelte und schien das plötzliche Interesse zu genießen, was den jungen Mann im kanariengelben Shirt nur noch mehr in Rage versetzte.
»Wo sonst, wenn nicht hier, soll denn Ihrer Meinung nach diese Geschichte vorgelesen werden? Gibt es einen besseren Platz?«, fragte der Engländer.
»Ha, da wüsste ich schon was!«, versetzte der junge Mann. »Warum gehen Sie nicht gleich zum Ort des Geschehens, hoch zu den Reichenbachfällen? Da stören Sie zumindest niemanden, und die wenigen Spaziergänger, die sich hinverirren, kommen wahrscheinlich sowieso nur wegen Holmes und freuen sich über Ihre lächerliche Vorstellung.«
»Ja, ja, die Spaziergänger verirren sich!« Die alte Dame nickte.
»Pah«, sagte der Engländer, und in seinen bisher so höflich unterkühlten Ton mischten sich nun eine Spur Bedauern und eine leicht spöttische Note, »die Reichenbachfälle sind leider auch nicht mehr das, was sie einmal waren, als Sir Arthur den Schurken Moriarty hineinstürzen ließ. Seit der Bach zur Energiegewinnung herhalten muss, tröpfelt er doch nur noch. Ich kenne eine ganze Menge Holmes-Fans, die diese elende Staumauer liebend gerne in die Luft sprengen würden.«
»Hilfe!«, schrie die alte Dame. »Die Elenden wollen die Stadtmauer sprengen! Hilfe, Polizei!«
»Terrible nonsense!«, zischte der Engländer. »Are you deaf? You better open your lugs, you silly old fool!«
Der junge Mann grinste schadenfroh. Ein Grinsen, das sich noch verstärkte, als er sah, wie ein Uniformierter, der ohnehin durch die immer dichter gewordene Menge der Schaulustigen aufmerksam geworden war, nun aufs Höchste alarmiert herbeieilte.
»Was ist hier los?«, brüllte der Polizist mit Donnerstimme.
»Terroristen!«, rief die alte Dame, blieb dabei aber in einer Seelenruhe auf ihrem Rollator sitzen, als hätte sie gerade eine Tasse Tee geordert.
Die Umstehenden lachten.
»Der Mann mit der ulkigen Mütze da liest eine Geschichte vor«, sagte der kleine Junge. »Und er soll jetzt endlich weiterlesen.«
»Ich trage vor aus ›The Final Problem‹«, erklärte der Engländer betont würdevoll. »Das wird doch wohl an dieser weihevollen Stätte erlaubt sein.«
»Dieser weihevollen Stätte!«, äffte der junge Mann ihn nach. »Ich habe diese Witzfigur aufgefordert, doch gefälligst an den Reichenbachfällen zu lesen, damit er hier nicht die Ordnung stört. Daraufhin hat er über die hiesige Energiepolitik geschimpft und angedroht, die Staumauer in die Luft zu jagen!«
»Ja, mein Eduard war auch Jäger«, meldete sich die Alte.
»Stimmt gar nicht!«, maulte der kleine Junge.
Der Polizist stöhnte auf. Ballte die Fäuste. Dann schloss er für einen Moment die Augen, atmete zweimal tief durch. »Und wer hat hier um Hilfe gerufen?«
»Die ältere Dame dort!«, rief einer der Zuhörer lachend.
»Gute Frau«, wandte sich der Polizist an die Alte, »wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Überall nur Schmutz und Probleme«, brummelte die Alte und lüpfte ihr Taschentuch, als wolle sie damit die eben genannten Unliebsamkeiten hinwegwischen. »Ungerechtigkeit und Terroristen!« Sie hielt dem Polizisten das Taschentuch hin. »Sprengen alles in die Luft! So ein Unsinn! Gut, dass mein Edi das nicht mehr erlebt hat!«
Einige der Umstehenden lachten. Der Polizist schüttelte den Kopf. »Ich denke, es ist das Beste, Sie gehen jetzt alle wieder schön artig Ihrer Wege. Hiermit erkläre ich die Versammlung für beendet.« Er bedachte den hageren Engländer und seinen kanariengelben Kontrahenten mit einem besonders scharfen Blick. »Das gilt auch für Sie!«
Der Engländer nickte, steckte das Buch in die Manteltasche, schenkte dem Buben noch ein bedauerndes Achselzucken und schickte sich an zu gehen, wobei das triumphierende Grinsen des Kanariengelben an ihm abperlte wie saure Regentropfen an seinem Inverness-Mantel. Die Menge zerstreute sich rasch, schon nach kurzer Zeit war nur noch der Polizist übrig, verzweifelt darum bemüht, aus der alten Dame herauszubringen, wo sie wohnte, damit er sie sicher nach Hause bringen konnte.
Am nächsten Tag zur gleichen Zeit fanden sich der Bub und der junge Mann im kanariengelben Polo-Shirt wieder vor dem Sherlock-Holmes-Denkmal ein. Ersterer mit dem Wunsch, die Geschichte vielleicht doch noch zu Ende hören zu können, letzterer in der Hoffnung, dass dieser zu heiß gebadete englische Selbstdarsteller die Unverfrorenheit besitzen würde, noch einmal aufzukreuzen, damit er ihm endgültig klarmachen könnte, dass seine Schmierenkomödie nichts, aber auch gar nichts mit echter Sherlock-Holmes-Verehrung zu tun hatte. Sollte der Kerl sich doch ein Theater mieten, wenn er sich unbedingt öffentlich lächerlich machen wollte!
Seine Hoffnung ging ebenso wenig in Erfüllung wie der Wunsch des Jungen, denn der Engländer tauchte nicht mehr auf.
1 Der Tote im Hochmoor
Lange hat es gedauert, bis ich mich auf Drängen meiner geneigten und an den denkwürdigen Fällen meines genialen Freundes Mr. Sherlock Holmes so überaus interessiert Anteil nehmenden Leserschaft nun doch endlich dazu entschlossen habe, auch jene Begebenheiten aus seiner langjährigen Praxis als beratender Detektiv niederzuschreiben, bei denen ich nicht persönlich Zeuge sein durfte, sondern die ich nur aus seinen eigenen Erzählungen und etwaig vorhandenen Dokumenten rekonstruieren konnte.
Ich greife also nun zur Feder, um darüber zu berichten, was unmittelbar auf jene schrecklichen Ereignisse folgte, welche der so glanzvollen Karriere meines Freundes mit dem Sturz in die Reichenbach-Fälle ein allzu frühes Ende gesetzt zu haben schienen.
Den aufmerksamen Lesern meines Berichts über den Fall des »Leeren Hauses« ist sicher noch im Gedächtnis, dass Holmes nach Professor Moriartys Tod …
»Was soll das?«, fragte Denise Hostettler. »Was soll ich mit diesem gestelzten Schwachsinn?«
»Den Papierfetzen hat Polizist Rickli in der Hand des Toten gefunden«, sagte Melchior Salvisberg.
Denise kniff die Augen zusammen und musterte den jungen Polizisten von der Meiringer Wache, der neben Salvisberg stand.
Der Kriminaltechniker nahm den Klarsichtbeutel mit dem Papierfetzen, den sie ihm achtlos wieder hinhielt, und reichte ihr dafür wortlos einen anderen, dessen Inhalt ihre Verwirrung nur noch verstärkte.
»Orangenkerne«, fühlte Rickli sich bemüßigt zu erklären. »Die hatte er auch noch in der Hand.«
Denise schüttelte den Kopf, gab Salvisberg das Tütchen zurück und besah sich noch einmal den Toten, der unter dem kleinen bodenfreien Zelt der Kriminaltechniker vor ihnen im Schnee lag. Der Mann war etwa 50 Jahre alt, stämmig, aber nicht dick und glatt rasiert. Er trug den Temperaturen und der Umgebung angemessene Outdoor-Kleidung und moderne Schneeschuhe aus Hartplastik. Die Skibrille hatte er hoch in die Stirn geschoben, sodass er Denise aus den gebrochenen Augen immer noch anzustarren schien. Sein Schal hing in den niedrigen Ästen einer der direkt neben ihm stehenden verkrüppelten Bergföhren, die hier die Randbereiche des Hochmoors säumten. Vor dem Bäumchen waren seine zwei Skistöcke ordentlich in den Boden gerammt. Die Handschuhe waren daraufgestülpt. Im Nacken des Mannes steckte ein kurzer gedrungener Pfeil.
»Verrückt!«, murmelte sie. »Sieht fast so aus, als hätte er hier angehalten, um sich den Zettel anzusehen und dabei den Schal abgelegt, sodass ihm einer von hinten zielsicher und in aller Seelenruhe den Dartpfeil ins Genick stoßen konnte.«
»Entschuldigung«, meldete Rickli sich zu Wort, »wenn ich dazu vielleicht etwas bemerken dürfte.«
Denise sah den jungen Mann von der Meiringer Polizeiwache aufmunternd an. Nach der Meldung des Leichenfunds war sie sofort zusammen mit den Kollegen der kriminaltechnischen Abteilung nach Meiringen beordert worden. Ein Wanderer hatte den Toten im Hochmoor gefunden und mit dem Handy die Polizeiwache verständigt. Polizist Rickli hatte sich gerade in der Nähe befunden und war daher als Erster am Tatort gewesen. Er hatte dann sogleich Verstärkung angefordert und zusammen mit dem Wanderer in der eisigen Kälte bei der Leiche ausgeharrt. Offenbar hatte es ihm nichts ausgemacht. Er wirkte zwar ein wenig steif, machte aber sonst einen noch ganz munteren Eindruck, und die rosigen Wangen standen ihm gar nicht schlecht.
»Sie scheinen nicht unbedingt eine Kennerin der Sherlock-Holmes-Geschichten zu sein«, sagte er, »deshalb darf ich Ihnen da vielleicht ein wenig mit meinem Wissen zur Hand gehen.«
Denise Hostettler kniff die Augen zusammen. Sie wusste von dem Kult, der in Meiringen um die Figur des berühmten Detektivs getrieben wurde, hatte selbst aber nicht viel übrig dafür. Einer ihrer Verflossenen hatte ihr einmal einen der Kurzgeschichtenbände aufgenötigt, aber schon nach drei Stories hatte sie kapituliert. Für ihren Geschmack mangelte es den Geschichten an interessanten Frauenfiguren und einem Schuss Erotik. Selbst die von respektlosen Zeitgenossen geäußerte Theorie, Holmes und Watson seien schwul gewesen, schien ihr zu weit zu gehen. Auch wenn die beiden Kerls beim Bestehen ihrer Abenteuer noch so viel Arsch in der Hose zeigten, wirkten die beiden auf sie dennoch wie Männer ohne Unterleib.
Ricklis Räuspern riss sie aus ihren Gedanken. Sie besah ihn sich näher. Wenn der Bursche nicht so eine stocksteife Amtswürde zur Schau getragen hätte, wäre er ihr in seiner feschen blauen Uniform vielleicht sogar ganz attraktiv erschienen. Sie rief sich zur Ordnung. Es war einfach schon zu lange, dass sie allein hauste.
»Der Text auf dem Papierfetzen und die Orangenkerne stammen eindeutig aus einer Sherlock-Holmes-Geschichte«, erklärte Rickli. ›Die fünf Orangenkerne‹, darin geht es um ein abtrünniges Ku-Klux-Clan-Mitglied, das seine ehemaligen Spießgesellen mit geheimen Dokumenten erpressen will. Die Clansmänner schicken ihm als Warnung fünf Orangenkerne. Kurz darauf ist er tot.«
Denise sah Melchior Salvisberg an. Der grinste.
Aber Rickli war noch nicht fertig. »Und der Pfeil«, fuhr er fort, »das ist natürlich kein Dartpfeil, denn sonst müsste er ja Flügel oder Federn haben. Der hier stammt meiner Meinung nach aus einem Blasrohr, und so was gibt es auch im Fall des Vampirs von Sussex.«
Denise stöhnte. Dabei wusste sie eigentlich gar nicht so recht, worüber. Über diesen dienstbeflissenen Burschen, der frisch von der Polizeischule gekommen zu sein schien, oder über das unausgegorene Zeug, das er da von sich gab.
»In der Geschichte versucht einer, mit dem Blasrohr seinen ungeliebten Stiefbruder loszuwerden.«
»Nein«, sagte Denise. Das fehlte ihr noch. Ein Irrer, der im Chaltenbrunner Hochmoor Leute mit Pfeilen umbrachte, während unten im Tal die Trychler dazu rüsteten, mit Trommeln und Schellen beim Übersitz die bösen Geister zu vertreiben …
»Doch«, sagte Rickli, »und zwar sind die Pfeilspitzen mit Curare vergiftet.«
… und dazu noch ein Jüngling von der Meiringer Polizei, der sich als Sherlock-Holmes-Fan entpuppte und in dessen hübschem Oberstübchen auch sonst nicht alles zum Besten zu stehen schien. »Schluss mit dem Blödsinn!«, sagte sie scharf.
Rickli zuckte zusammen. Dann zog er einen Schmollmund.
Süß der Kleine.
»Wie sieht es mit Fußspuren aus?« Sie betrachtete skeptisch den rund um den Toten herum völlig zertrampelten Schnee. Salvisberg und seine Leute hatten ganze Arbeit geleistet, während Denise herumtelefoniert hatte, um in Erfahrung zu bringen, wo eigentlich Eva Mathys steckte, mit der sie sonst bei ihren größeren Fällen ein Gespann bildete. Wie sich herausstellte, war Eva ein Opfer der gerade in Bern grassierenden Grippewelle geworden, sodass Denise die Anweisung erhalten hatte, erst einmal mit den Meiringer Kollegen vorliebzunehmen. Eine Nachricht, die nicht dazu beigetragen hatte, ihre Laune zu heben. Sie sah den jungen Polizisten scharf an. »Hier muss doch mal etwas erkennbar gewesen sein, bevor offenbar eine ganze Elefantenherde samt Bullen drüber hingezogen ist.« Im gleichen Moment ärgerte sie sich über den Blödsinn, den sie verzapfte. Der Bursche machte sie nervös.
»Wir haben Fotos gemacht«, sagte Salvisberg. »Die Spuren deuten darauf hin, dass der Tote mit einem Begleiter unterwegs war, der ihm bei einer günstigen Gelegenheit den Pfeil aus nächster Nähe in den Nacken gerammt hat.«
»Das also zum Thema Blasrohr«, sagte die Kommissarin spöttisch, bemühte sich aber angesichts Ricklis beleidigter Miene, etwas milder nachzufragen: »Wissen wir etwas über den Toten?«
»Dino Mazzini.« Salvisberg schwenkte einen Ausweis in einem weiteren Plastikbeutel. »53 Jahre alt. Wohnhaft in Lausanne. Schweizer Staatsbürger italienischer Abstammung.«
»Na, das ist doch was.« Sie wandte sich an Rickli. »Stellen Sie bitte fest, ob er in einem Meiringer Hotel abgestiegen ist und sorgen Sie dafür, dass ich möglichst schnell Ihren Bericht bekomme. Ich will Fakten, keine Hirngespinste. Und dann möchte ich mit dem Wanderer sprechen, der die Leiche gefunden hat.«
»Sehr wohl, Frau Kommissarin«, sagte Rickli und stiefelte sichtlich eingeschnappt davon.
»Hübsches Bürschchen«, sagte Salvisberg zu Denise, als er außer Hörweite war. »Du solltest nicht zu streng mit ihm sein. Dann taut er sicher bald auf und frisst dir aus der Hand. Halt ihn dir warm. Wer weiß, was der Junge außer Conan Doyles gesammelten Werken noch alles drauf hat.«
*
Auf der Wandelalp oberhalb von Meiringen befand sich auf einer weitläufigen Hangterrasse das Chaltenbrunner Moor. Die Terrasse wurde von einer Reihe Felsrippen treppenartig unterteilt. Auf der untersten Stufe lag das über 20 Hektar große Hochmoor, das sich auf wasserundurchlässigen Schichten gebildet hatte und, weil es nie abgetorft wurde, immer noch in seinem ursprünglichen Zustand erhalten war. Die klimatischen Bedingungen hatten verhindert, dass sich über dem ganzen Gebiet eine regelmäßige Torfschicht ausbilden konnte. So hoben sich kleine Torfhügel, so genannte Bulten, deutlich zwischen nassen, flachen Rinnen heraus wie Inselchen in einem See. Der Wechsel von trockenen Torfhügeln und versumpften Senken war charakteristisch für Chaltenbrunnen. Auf den Inselchen thronten oft verkrüppelte, schlecht wachsende Bergföhren. Die Ränder des Hochmoors bestanden daher zum großen Teil aus Bergföhrenwald, dessen Wurzeln von Torfmoos-Polstern umgeben sind. Das Zentrum dagegen war völlig baumfrei und verlieh dem Ganzen einen Eindruck von Offenheit und Weite, besonders im Winter, wenn den stillen Schneeflächen ein sehr eigener, fast unheimlicher Zauber innewohnte.
Im Sommer wurde die Moorlandschaft alpwirtschaftlich genutzt, allerdings nur im Bereich der Chaltenbrunnenalp, deren Weiden durch eine lange Weidemauer von den zum Teil eingezäunten und unter strengem Naturschutz stehenden eigentlichen Moorflächen der Wandelalp getrennt waren. Lediglich einige Alphütten lagen am Rand des Gebiets, das ansonsten noch fast unberührte Natur bot. Im Winter verirrten sich nur wenige Wanderer dorthin in die Einsamkeit, waren doch eine gute Ortskenntnis und die richtige Ausrüstung unerlässlich, um die Tour durch das höchstgelegene Moor Europas bis zum 1889 Meter hohen Gyrensprung mit seiner fantastischen Rundsicht genießen zu können.
Denise Hostettler hatte wenig Sinn für die prächtige Kulisse mit den Gipfeln der Engelhörner und den tief verschneiten Bergketten rundum. Bei der Ankunft in Meiringen war sie zunächst zur Wache gefahren, von wo sie mit einem der Beamten sofort weiter bis zur Haltestelle der Rosenlaui-Postautolinie am Restaurant Chaltenbrunnen-Säge gefahren und von dort westwärts auf dem Alpweg zum Oberen Stafel der Alp Chaltenbrunnen am Eingang zum Naturschutzgebiet marschiert war.
Die Kriminaltechniker hatten eine Art Basislager aufgeschlagen, in dem der Wanderer, der die Leiche gefunden hatte, bei einer heißen Tasse Tee unverdrossen auf die Kommissarin wartete. Denise staunte über die Geduld, die er dabei an den Tag legte. Im Gegensatz zu ihr selbst war er allerdings auch bestens ausgerüstet, sodass er es schon ein Weilchen aushalten konnte, ohne zu frieren. Er hieß Samuel Schwarzer und sah aus wie eine Mischung aus Reinhold Messner und Alm-Öhi. Sein von Wind und Wetter gegerbtes Gesicht, eingerahmt von einem dichten dunklen, mit Graufäden durchsetzten Bart, machte es schwer, sein Alter zu schätzen. Sein Körper war durchtrainiert, so viel konnte man trotz der dicken Winterkleidung an der Art seiner Bewegungen erkennen, als er von seinem Klappstuhl aufstand, um ihr zur Begrüßung fest die Hand zu drücken.
»Ist es nicht gefährlich im Winter, so allein hier oben in der Einöde herumzuspazieren?«, fragte Denise, um sich und ihm eine lange Einleitung zu ersparen.
Er nahm die Skibrille ab – aus Höflichkeit oder vielleicht auch nur, um ihr seine strahlend blauen Augen, deren Blick ständig in die Ferne zu schweifen schien, zu zeigen. »Für mich nicht. Ich bin oft hier oben.«
Denise nickte. Das passte, ein Einheimischer, ein richtiger Naturbursche, knorrig wie die Bergföhren – kein Tourist wie dieser Mazzini aus Lausanne.
»Kannten Sie den Toten? Was glauben Sie, wieso er sich allein hier oben rumgetrieben hat?«
»War er denn allein? Seitdem es diese verdammten Handys gibt, meint doch jeder, es kann ihm nichts mehr passieren. Aber wenn man sich nicht auskennt, hilft auch die beste Ausrüstung nix.«
»Und Sie? Haben Sie etwa kein Handy?«, fragte Denise erstaunt. »Sie haben doch die Kollegen damit alarmiert?«
»Ja, habe ich. Ein uraltes Modell, nur für den Notfall.« Es schien ihm wichtig zu sein, dies zu betonen. »Der Rickli war dann als Erster da und hat sofort Verstärkung angefordert.«
»Und Sie haben den Toten vorher noch nie gesehen?«
Der Mann schüttelte den Kopf.
»Was halten Sie von dem Pfeil in seinem Genick? Ist Ihnen so etwas schon mal untergekommen?«
Er zuckte die Achseln. »Sieht aus wie ein Blasrohrpfeil, meint der Rickli.«
»Und Sie?«, fragte Denise etwas schärfer. »Was sagen Sie? Es interessiert mich nämlich eigentlich nicht die Bohne, was der Rickli meint, sondern was Sie meinen.«
Schwarzer zog die buschigen Brauen zusammen.
»Hatten Sie denn gar keine Angst, als Sie den Pfeil gesehen haben?«
Der Mann lachte. »Warum sollte mich einer umbringen?«
»Verrückte gibt es überall«, sagte Denise.
»Pah, so verrückt kann gar keiner sein, dass er sich hier oben rumtreibt, um wahllos Leuten Pfeile ins Genick zu schießen.« Der Mann schüttelte den Kopf. »So etwas wie Psychopathen und Amokläufer gibt es nur in den großen Städten, nicht in der Natur.«
»Den Fußspuren nach zu urteilen, war der Tote tatsächlich nicht allein hier oben, sondern zusammen mit seinem Mörder. Ist Ihnen heute vielleicht zufällig noch jemand auf dem Weg hierher begegnet?«
»Nein, ab Chaltenbrunnen-Säge gewiss niemand mehr.«
»Vielleicht hatte er ja sogar einen professionellen Führer dabei. Kennen Sie jemanden, der seine Dienste als Führer anbietet?«
»Sicher, da kämen schon einige in Frage.« Er überlegte. »Es gibt ja die Haslitaler Bergführer-Vermittlung. Aber das weiß der Rickli auch, fragen Sie besser den!«
»Na schön«, seufzte Denise. Aus dem Mann war wohl nicht mehr viel herauszuholen. Er wollte offenbar niemanden denunzieren. Dann fiel ihr doch noch etwas ein: »Kennen Sie den Rickli eigentlich gut?«
Er stutzte einen Moment. »Na, ja, wie man sich halt so kennt in Meiringen.«
»Und wie ist das? Wie kennt man sich hier?«
»Na, immerhin ist er ja Polizist.« Er grinste.
»Ach, haben Sie denn öfter mit der Polizei zu tun?«
Er schüttelte den Kopf, nun bei aller Geduld doch allmählich ein wenig unwillig. »Ein Polizist ist schließlich so was wie eine öffentliche Person«, brummte er.
Denise nickte.
*
Als sie später mit Rickli zusammen hinunter ins Tal fuhr, fragte sie ihn noch einmal nach dem Wanderer.
»Der Samuel Schwarzer«, erzählte der Polizist, »der kennt die Berge hier wie seine Westentasche.«
»Könnte er nicht Mazzinis Führer gewesen sein?«
Rickli schüttelte den Kopf. »Der Schwarzer ist ein Eigenbrötler. Seit dem Tod seiner Frau vor drei Jahren geht der immer nur allein herum.«
»Und wovon lebt er?«
»Die beiden hatten ein kleines Geschäft, Antiquitäten, ein bisschen Kunsthandwerk, Sachen, die der Samuel selbst geschnitzt hat. Den Laden hat vor allem die Christina geführt, und es war daher auch keine große Überraschung, als er ihn nach ihrem Ableben verkauft hat.«
»Glauben Sie, er kann von den Rücklagen leben?«
»Keine Ahnung. Sie hatten ein eigenes Häuschen. Er muss also keine Miete zahlen. Und ich glaube nicht, dass er sehr viel zum Leben braucht. Vielleicht verkauft er ja ab und zu noch was von seinen Schnitzereien.«
»An Touristen wie Mazzini?«
Rickli sah sie missbilligend an. »Der Schwarzer mag vielleicht ein Eigenbrötler sein, aber gewiss kein Mörder. Außerdem ist Mazzini auch nicht ausgeraubt worden.« Er fügte hinzu und vermied es, sie dabei anzusehen: »Wollten wir uns nicht erst einmal an den Fakten orientieren?«
Denise biss sich auf die Zunge, um die Antwort, die ihr darauf lag, nicht herauszulassen. »Der Erste am Tatort ist immer verdächtig«, sagte sie ein wenig süffisant. »Und Sie? Warum waren Sie denn eigentlich so schnell da oben?«
»Ich?« Obwohl er überrascht tat, schien er auf die Frage vorbereitet zu sein. »Ich war zufällig gerade in der Chaltenbrunner-Säge zum Znüni.«
»Ich nehme an, Sie fahren öfter mal schnell da rauf zum Znüni?«
»Nein. Ich hatte auch noch etwas Privates zu erledigen«, sagte er steif. »Da ließ sich das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden.«
Denise sah ihn neugierig an. Sie fragte sich, was es in Ricklis Privatleben wohl Angenehmes geben mochte. Es entzog sich ihrer Vorstellungskraft.
*
Die kleine Polizeiwache lag in der Amthausgasse am äußersten Rand des Dörfchens, umgeben von Sportanlagen und dem Pfadfinderheim und nach Norden hin von dem fast unmittelbar angrenzenden Schäriwald. Tatsächlich brauchte es nur wenige Schritte und man stand mitten im Grünen. Insgesamt schien die Dienststelle mit neun Polizisten und Polizistinnen auf den ersten Blick sehr gut versorgt, allerdings waren diese zusammen mit drei weiteren Mitarbeitern der Wache in Brienz auch für die gesamte Region Oberhasli/ Oberer Brienzer See zuständig. Der Posten war daher auch nicht durchgängig, sondern nur zu den normalen Büro-Öffnungszeiten besetzt. Außerhalb dieser Zeiten konnten die Bürger sich in Notfällen über eine Gegensprechanlage an die regionale Einsatzzentrale in Thun wenden. Eine Ausnahme wurde jedoch in der Altjahrswoche gemacht, wenn rund um die Uhr immer mindestens ein Mitarbeiter direkt in Meiringen im Einsatz war.
Während Denise sich im Waschraum frischmachte, richtete Rickli ihr auf Anordnung von Wachtchef Hungerbühler im Besprechungszimmer eine provisorische Einsatzzentrale her. Die Kriminaltechniker waren noch am Tatort und würden anschließend zurück nach Bern fahren, um ihre Ergebnisse auszuwerten. Denise sollte vor Ort bleiben und, um keine Zeit zu verlieren, mit den Kollegen von der Meiringer Gemeindepolizei die Ermittlungen aufnehmen. Emil Stocker höchstpersönlich, der Chef der Kriminalabteilung, hatte ihr versprochen, sich um die Sache zu kümmern und so schnell wie möglich Verstärkung aus den Reihen des Dezernats Leib und Leben zu schicken.
Sie kam in den Raum, als Rickli vor dem für sie eingerichteten Schreibtisch gerade einen harten Holzstuhl gegen einen bequem gepolsterten Schreibtischstuhl austauschte.
»Meinen Sie, das wird nötig sein?«, fragte sie, obwohl sie seine Fürsorge fast ein wenig rührte. »Ich habe gar nicht vor, mich hier häuslich niederzulassen, sondern hoffe, wir erwischen den Kerl möglichst noch vor dem Übersitz.«
Sie wusste, dass dies wahrscheinlich Wunschdenken bleiben würde, auch wenn die Aussichten, einen Mörder zu fangen, direkt nach der Tat immer am größten waren. Ein Großteil aller Morde wurde in den ersten 24 Stunden danach geklärt. Anschließend wurde es mit jeder verstrichenen Stunde schwieriger. In ihrem Fall kam erschwerend hinzu, dass der Rummel in Meiringen in den nächsten Stunden seinen Höhepunkt erreichen würde. Stocker hatte eindringlich darauf hingewiesen, dass die Ermittlungen während des Übersitzes schwierig würden.
»Ich wollte, Ihre Hoffnung ginge in Erfüllung.« Ricklis Gesicht strafte das, was er sagte, Lügen. Er schien seine Rolle als Mordermittler zu genießen und sie so lange wie möglich auskosten zu wollen. »Ich halte eine schnelle Ergreifung des Täters nicht für sehr wahrscheinlich.«
»Ach ja und wieso?«
»Ich fürchte, es wird nicht bei einem Mord bleiben. Wissen Sie, mich beschäftigen immer noch die Orangenkerne und der Papierschnipsel aus der Hand des Toten. Ich habe noch einmal gründlich darüber nachgedacht: Der Text auf dem Zettel stammt nicht aus der Erzählung ›Die fünf Orangenkerne‹. Was hat es aber dann mit den Orangenkernen auf sich? Der Tote ist italienischer Abstammung. Das tönt nicht nach Ku-Klux-Clan, eher nach Mafia. Was die Sache sicher nicht besser macht. Im Gegenteil. Der Klan ist weit weg, in Amerika, die Mafia ist überall. Ich finde das sehr beunruhigend, denn eines weiß ich gewiss: In der Geschichte mit den fünf Orangenkernen ist es nicht bei einem Toten geblieben.«
Denise stöhnte innerlich auf. Der Kerl sollte seine Berufswahl noch einmal gründlich überdenken und lieber Krimi-Autor werden. Sie zwang sich, seine Hirngespinste unkommentiert zu lassen und ihm klare Anweisungen zu erteilen: »Wenn Sie herausgefunden haben, in welchem Hotel dieser Mazzini abgestiegen ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit den Kollegen in Lausanne auf und versuchen die Verhältnisse des Opfers zu klären. Aber vorher hätte ich gerne noch die Adresse der hiesigen Bergführervermittlung.«
»Sie glauben, er hatte einen Führer, der ihn umgebracht hat?« Rickli schien überrascht. »Das wäre zu einfach. So dumm kann keiner sein!«
»Ich verdächtige erst mal gar niemanden, sondern mache meine Arbeit. Und dazu gehört, dass ich alle Möglichkeiten in Erwägung ziehe. Den Fußspuren nach zu schließen war Mazzini nicht allein dort oben. Also müssen wir herausfinden, wer sein Begleiter war. Ach ja, und bei Fußspuren fällt mir auch noch ein, dass wir unbedingt klären sollten, woher er diese tollen Schneeschuhe hatte, ob es seine eigenen waren, ob er sie womöglich erst hier gekauft oder vielleicht sogar nur irgendwo ausgeliehen hat.«
Rickli nickte. »Es gibt hier in Meiringen zwei Intersport-Läden, die Schneeschuhe vermieten.«
»Na also. Das könnte uns einen wichtigen Anhaltspunkt dafür liefern, wann und mit wem er die Tour ins Hochmoor geplant hat.«
Sie nahm den Schreibtischstuhl in Beschlag, während Rickli sich entfernte, kurz darauf aber auch schon wiederkam und ihr wortlos eine Broschüre neben das Telefon legte. Das Schwarz-Weiß-Foto auf dem Titelblatt zeigte zwei in altmodische Anzüge und Bergstiefel gekleidete Männer mit steifen Hüten, die neben ein paar antiken Holzskiern, mindestens genauso alten Schneeschuhen und noch älteren Rucksäcken vor einer in einem Fotostudio aufgebauten Bergkulisse posierten. Die Broschüre warb mit der großen Tradition der Haslitaler Mountain Guides für Bergtouren jeder Art und jeglichen Schwierigkeitsgrads. Denise blätterte das Heftchen durch, fand aber kein spezielles Tourenangebot für das winterliche Chaltenbrunner Hochmoor. Sie wählte die auf der Rückseite des Heftes angegebene Nummer der Bergführervermittlung. Eine fröhliche Frauenstimme meldete sich und gab bereitwillig Auskunft darüber, dass in den letzten Tagen niemand nach einem Führer für das Hochmoor gefragt habe und ihr nicht bekannt sei, dass einer der Guides solche Touren privat anbiete.
Denise hatte gerade aufgelegt, als Rickli wieder bei ihr hereinschneite. Er war fleißig gewesen und hatte im Gegensatz zu ihr schon einiges in Erfahrung gebracht: Der tote Dino Mazzini war im Hotel Victoria abgestiegen, wo er erst am Tag vor seiner Ermordung spätabends angekommen war und ein Einzelzimmer mit Frühstück bis über den Jahreswechsel hinaus gebucht hatte. Das Zimmer war im Juni reserviert und im Voraus bezahlt worden. Der Portier, mit dem Rickli telefoniert hatte, war bei Mazzinis Ankunft nicht mehr im Dienst gewesen. Er hatte ihn erst am Morgen gesehen, und obwohl Mazzini den Zimmerschlüssel bei ihm an der Rezeption abgegeben hatte, konnte der Portier sich nicht daran erinnern, wann und mit wem er das Hotel am Morgen verlassen hatte.
»Konnte oder wollte er sich nicht erinnern?«, fragte Denise.
Rickli sah sie verblüfft an. »Sie verdächtigen ja tatsächlich jeden.«
»Das bringt der Beruf so mit sich.«
»Ich habe schließlich nur mit ihm telefoniert und deshalb sein Gesicht nicht gesehen, aber für mich klang er glaubwürdig.«
»Na schön, wir sollten sowieso erst mal ins Hotel Victoria fahren und uns das Zimmer des Toten genauer ansehen. Dann können wir den Portier gleich noch mal befragen. Vielleicht ist ihm inzwischen was eingefallen.«
*
Obwohl sie es nicht weit hatten, war Denise froh, dass sie mit dem Dienstwagen fuhren, denn es fegte ein eisiger Wind durch die Straßen.
Sie hatten sich kaum angeschnallt und die Sportplätze hinter sich gelassen, als ein Ruf über die Sprechanlage einging. Rickli meldete sich, während Denise sich den Ortsplan von Meiringen ansah, den der junge Polizist ihr gegeben hatte. Sie hörte nur halb hin, und obwohl der Sprecher gar nicht weit von ihnen sein konnte, war der Empfang miserabel. Sie verstand nur »Kinder … spielen … Ruine … gefunden …« und wurde erst hellhörig bei dem Wort »Toter«.
»Die zweite Leiche«, erklärte ihr Rickli. »Im Resti. Abgestürzt. Ein Junge. Zwei Kinder haben ihn beim Spielen gefunden. Ihr Vater hat die Rettung verständigt und meint, es sei wohl ein Unfall, wollte aber …«
»Im Resti? Was ist das?«
»Das ist eine alte Burgruine am Ortsrand.« Er zeigte es ihr auf dem Plan. »Ich sagte ja, dass es nicht bei einem Toten bleiben würde.«
Denise blickte ihn zweifelnd an. Ein in einer Burgruine abgestürzter Junge? Von Kindern beim Spielen gefunden. War das überhaupt etwas für sie? Sie schüttelte den Kopf. »Sie fahren allein hin. Unterwegs können Sie mich im Hotel Victoria abladen. Wenn es tatsächlich mehr als ein Unfall sein sollte, wissen Sie, wie Sie mich erreichen.«
Rickli nickte nur.
Als er sie vor dem Hotel absetzte, war es schwer für sie zu deuten, was seine Miene ausdrückte. Stolz darüber, dass sie ihn allein zu einem Leichenfundort schickte oder Verärgerung, dass sie seine Theorien nicht ernst nahm. Auf jeden Fall hatte er es eilig davonzukommen.
*
Das Hotel Victoria lag im Dorfzentrum, ganz in der Nähe des Bahnhofs. Denise betrat das Gebäude über die im Sommer sicherlich angenehm schattige Terrasse. Die wuchtigen Sessel und die dezente Beleuchtung in der Lobby vermittelten den Eindruck von schlichter Eleganz gepaart mit modernem Luxus. Ein wenig störend fand sie allerdings die offenbar obligatorische Kuckucksuhr und das Hirschgeweih an den Wänden.
Der junge Mann am Empfang wirkte sehr gepflegt und würdevoll, von seiner eigenen Wichtigkeit überzeugt, war dabei aber die Freundlichkeit in Person. Letzteres reduzierte sich ein wenig, als Denise ihm klargemacht hatte, worum es ging. Das für zahlende Gäste bestimmte frische Lächeln machte einer geschäftsmäßigen Höflichkeit Platz. Ein müder Zug grub sich um seine Mundwinkel.
Er hatte dem, was er Rickli am Telefon mitgeteilt hatte, nichts mehr hinzuzufügen. Als er Denise den Schlüssel für Mazzinis Zimmer geben wollte, meldete sich ihr Handy. Das Gespräch mit dem Portier hatte keine zehn Minuten in Anspruch genommen. Rickli konnte den Fundort der Leiche allenfalls erreicht, aber kaum gründlich untersucht haben. Der Bursche war zu schnell, um nicht zu sagen zu voreilig.
»Ich fürchte, Sie werden sich doch herbemühen müssen«, sagte er.
»Was ist los?«
»Das erkläre ich Ihnen lieber vor Ort.«
»Sind Sie sicher, dass es kein Unfall war?«
»Absolut.«
»Na schön. Haben Sie jemanden da, den Sie bei der Leiche lassen können?«
»Ja, es ist ja auch nicht für lange. Ich komme und hol Sie ab.«
»Okay.« Denise gab dem Portier den Schlüssel zurück. »Das müssen wir verschieben.« Sie ging nach draußen. Während sie auf Rickli wartete, verständigte sie die Kollegen von der Kriminaltechnik, die gerade dabei waren, ihre Zelte im Chaltenbrunner Hochmoor abzuschlagen.
»Mann«, stöhnte Melchior Salvisberg, »vielleicht sollten wir ernsthaft überlegen, in Meiringen eine Filiale zu eröffnen.«
In der Ferne glaubte Denise einen Mann mit einem langen karierten Mantel und einer Sherlock-Holmes-Mütze vorbeigehen zu sehen. Offenbar waren in Meiringen nicht nur Plätze, Hotels und Bars nach dem Krimi-Helden benannt, sondern gab es auch Verrückte, die sich wie ihr Idol kleideten. Vielleicht machte Rickli das in seiner Freizeit auch. »Ja, sieht fast so aus, Melchior«, sagte Denise wenig begeistert. Auch wenn sie den Gedanken nicht mochte, beschlich sie allmählich die Befürchtung, der junge Kollege könne mit seinen kruden Theorien nicht ganz unrecht haben.
2 Der Tote im Resti
Nachdem Holmes beobachtet hatte, wie ich mit meinen Helfern nach unseren fruchtlos gebliebenen Versuchen, ihn und Moriarty oder wenigstens ihre Leichen aus den reißenden Wassern der Reichenbachfälle zu bergen, nach Meiringen zurückgekehrt war, hatte er bekanntlich noch einen zweiten mörderischen Angriff in Form eines von Moriartys Komplizen verursachten Steinschlags zu überstehen.
Holmes wusste, dass es keinen Sinn hatte, nach London zurückzukehren, bevor er nicht den Attentäter gefasst und unschädlich gemacht hatte. Er beschloss, zunächst nach dem Jungen zu suchen, der mir die von Professor Moriarty fingierte Botschaft unseres Wirts Peter Steiler gebracht hatte, welche mich an den Reichenbachfällen zur Umkehr nach Meiringen bewogen und somit Holmes und mich getrennt hatte.