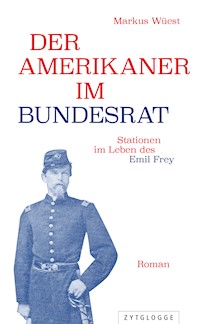Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Seltsames trägt sich in Basel zum Jahresende zu: Der Postbote Eddie Fontanella fühlt sich nachts von einem Hund verfolgt, den er hört, aber nicht sieht. Der Coiffeur David Friedrich wird in der Dämmerung von einer alten Dame angesprochen, die, wie er tags darauf in der Zeitung liest, soeben verstorben ist. Zudem macht er bei einer seiner neuen Kundinnen eine Beobachtung, die ihm zu denken gibt. Und dann beginnen David und Eddie auch noch, sich für ein Haus im noblen Gellertquartier zu interessieren. Obwohl dieses seit Jahren leer zu stehen scheint, dringt regelmässig Licht aus einem der Fenster. Am Stephanstag, einem nasskalten Abend, verschaffen sie sich, schon reichlich angetrunken, widerrechtlich Zutritt – und werden mit etwas konfrontiert, das ihre Vorstellungskraft sprengt. Als ihnen die Rechtsabteilung eines führenden Pharmaunternehmens wegen Hausfriedensbruch Ärger macht, wird der Fall persönlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Titel
Prolog
Erster Teil
Heimweg
Siri
Post
Rheinblick
Guinness
Spinnen
Verlassen
Geisterhaus
Nachtgestalt
Frau Abächerli
Zweiter Teil
Nebel
Regen
Schnee
Staub
Futter
Eingesperrt
Securitas
Versteckt
Dritter Teil
Catherine Laverrieres Aufzeichnungen
6. Januar 1985
19. Februar 1985
7. August 1985
25. Oktober 1985
23. Februar 1986
15. April 1986
8. Mai 1986
17. Mai 1986
23. Juni 1986
11. März 1997
4. April 1997
6. April 1997
11. April 1997
1. Mai 1997
19. Mai 1997
5. Juni 1997
13. Juli 1997
19. Juli 1997
3. August 1997
4. August 1997
6. August 1997
7. August 1997
9. August 1997
Vierter Teil
Vertrauen
Verdächtigt
Vereinbarung
Vergangenheit
Verschlagen
Versuch
Verstorben
Epilog
Über den Autor
Über das Buch
Markus Wüest
Haarsträubend
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
© 2024 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Thomas Gierl
Markus Wüest
Haarsträubend
Der Coiffeur bekommt Angst
Roman
Prolog
«Mardos! Mardos? Komm. Geht es dir gut? Hattest du einen ruhigen Tag, ma chérie?»
Der Mann, er könnte fünfzig oder sechzig Jahre alt sein, hat seinen Regenmantel auf die blitzblanke Chromstahlablage in der Küche gelegt. Er nimmt die Brille vom Gesicht, weil noch ein paar störende Regentropfen darauf sind, die seine Sicht etwas trüben, trocknet sie, setzt sie wieder auf.
Seine Handgriffe sind routiniert, alles, was er in dieser großzügigen Küche, die aber merkwürdig leer wirkt, macht, entspringt tausendfacher Wiederholung. Er holt aus einem der Ablagefächer oberhalb der Spüle eine Metallschüssel mit etwa fünfzehn Zentimeter Durchmesser. Er öffnet eine der Schranktüren und zieht eine Packung Haselnüsse heraus, die halbleer ist. Eine gute Portion dieser Nüsse kippt er in die Schüssel.
«Heute gibt es wieder einmal ein paar Nüsse, Mardos. Meine alte, treue Freundin. Das freut dich garantiert.» Dann holt er aus einem anderen Schrank einen großen Sack voll Trockenfutter, wie es Katzen gernhaben. Und schließlich mischt er noch Maiskörner unter das Ganze.
Die Schüssel klappert auf der metallenen Unterlage eigentümlich und, weil die Küche so leer ist, viel lauter als unter normaleren Umständen.
Per Knopfdruck lässt sich eine Durchreiche öffnen, die in einen großen, ebenfalls leeren Raum führt. Auf der anderen Seite der Durchreiche ragt eine Holzkonstruktion etwa anderthalb Meter in das, was früher einmal ein Salon war. Dort stellt der Mann den Fressnapf hin und fügt kurz drauf noch einen zweiten mit frischem Wasser hinzu.
«Mardos. Komm. Es gibt frisches Futter», säuselt er. Er singt ein Liedchen, sieht sich noch einmal kurz in der Küche um, sein prüfender Blick geht zu den beiden Fenstern. Dann zieht er den Mantel wieder an, geht durch die seltsame Tür aus Milchglas in die Eingangshalle des Hauses. Er schließt diese Glastür sorgfältig. Links neben der Tür befindet sich ein Schalter, den er nun drückt. Drei Mal kurz erhellt grelles, rotes Licht, das einem in die Augen sticht, die Räume im Parterre des Hauses und auch im Keller.
Der Mann öffnet ein Guckloch, das ihm erlaubt, einen Blick in die Küche zu werfen. Und es dauert nicht lange, bis er Mardos sehen kann. Alles wie gehabt. Alles funktioniert tadellos. Er ist sichtlich zufrieden.
«Voilà, ma chérie. À demain!» Und leise, mehr zu sich selbst als zu Mardos, sagt er: «Ich bin immer wieder froh, dass es bei mir besser gelungen ist als bei dir.»
Erster Teil
Heimweg
Eddie Fontanella würde am liebsten in seiner Wohnung in der Breite bleiben, an diesem Abend. Aber seine letzte frisch gewaschene Uniform hängt oben, im eigentlichen Daheim an der Angensteinerstraße. Und er hat keine Lust, am Morgen noch früher aufzustehen, als es ohnehin nötig ist, um pünktlich seine Tour zu beginnen.
Schon kurz nach dem Abendessen ist ihm das eingefallen. Aber weil es nieselt und sogar so aussieht, als könnte daraus Schnee werden, nach einem langen Sommer, der fast nicht enden wollte, hat er nicht sofort in die Tat umgesetzt, was unerlässlich ist. Stattdessen hat er einen guten Grund nach dem anderen gefunden, um weiter in der Wärme zu bleiben.
Ungemütlich ist sie nicht, seine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung an der Froburgstraße. Und hin und wieder muss er sich dort im Haus blicken lassen, sonst läuft er Gefahr, dass ihm die Nachbarn auf die Schliche kommen. Die alte Frau Gallacchi, deren Wohnungstür fast genau vis-à-vis der seinen liegt, hat ihn vor einer Woche missbilligend von Kopf bis Fuß gemustert. Mit ihrer kratzigen, leisen Stimme sagte sie: «Aha, es gibt Sie also doch noch, Herr Fontanes. Ich dachte, Sie seien vom Erdboden verschwunden.»
Sie ist italienischer Abstammung wie Eddie. Dass er Fontanella heißt und nicht Fontanes, weiß sie ganz genau. Aber sie macht sich eigentlich seit Beginn einen Spaß daraus, ihn mit dem falschen Namen anzusprechen. Herr Wirz, der ewige Junggeselle im Parterre, ausgetrocknet wie ein alter Baumstamm ohne Äste, hat ihm kürzlich einmal gesagt – im ähnlichen Tonfall wie die alte Hexe –, er müsse ja ein ausschweifendes Liebesleben haben, so wenig, wie er zu Hause sei.
Die Alarmglocken haben so oder so bei Eddie geläutet. Er muss vorsichtig sein. Sein kleines Doppelleben darf nicht auffliegen. Dass er David eingeweiht hat, ist möglicherweise ein Fehler gewesen. Aber der Herr Coiffeur hält bestimmt dicht. Wenn er über ein halbes Jahr nichts verraten hat, wird er kaum plötzlich ausplaudern, was verschwiegen gehört.
Es ist nun kurz vor halb elf, und er legt sich meist um halb zwölf schlafen. Lange darf er nicht mehr trödeln. Und es gibt auch keinen Grund mehr dafür. Die Küche ist aufgeräumt, seine paar Kleider, die er in dieser Wohnung hat, sind gewaschen und versorgt. Im Fernsehen läuft nur Schrott und den letzten Schluck Wein hat er sich vor einer halben Stunde gegönnt. Flasche leer. Glas leer.
Was hält ihn noch? Trägheit. Sonst nichts. Eddie hat schon zwei Mal auf seiner Wetter-App den Radar gecheckt: Es macht keinen großen Unterschied, ob er jetzt losgeht oder in einer Viertelstunde. Trocken wird er es nicht an die Angensteinerstraße schaffen. So viel steht fest.
Er seufzt. Nimmt das Weinglas vom Clubtisch und unterlässt es, die Hausschuhe anzuziehen – der direkte Grund für das Missgeschick, das ihm nun widerfährt: Er rutscht auf den dünnen Socken aus, verliert ganz kurz das Gleichgewicht und lässt dabei das Glas fallen. Es zersplittert auf dem Steinboden im Flur.
Eddie flucht. Holt den Handfeger und die Kehrschaufel aus der Küche und fängt an, sauber zu machen. Kristallglas hat die dumme Eigenschaft, in tausend Stücke zu zerbrechen. Stücke mit messerscharfen Kanten, wie er schnell merkt. Und zwar ausgerechnet an einem der größten Bruchteile. Er zieht sich einen kleinen, aber recht tiefen Schnitt am Zeigfinger der rechten Hand zu. Tut nicht sehr weh, fängt aber rasch an zu bluten.
Eddie flucht lauter. Aber er achtet darauf, beim Gang ins Bad, wo er Verbandsmaterial und Desinfektionsspray aufbewahrt, nicht auch noch mit den Füßen in die Glassplitter zu treten.
Das Desinfektionsmittel brennt – und wirkt somit, wie er vermutet, und das Pflaster klebt er so, dass die Wunde etwas zusammengepresst wird. Es färbt sich zwar sofort rot, aber während er nun besonders vorsichtig auch noch die letzten Scherben zusammenwischt, wird es nicht noch röter.
Die Scherben sammelt er in einer alten Zeitung, die er am Schluss so zerknüllt, dass das Glas darin ungefährlich ist. Den Zeitungsballen wirft er in den Abfall.
Er zieht die Schuhe an, den Regenmantel – einen Schirm hat er nicht, jedenfalls nicht hier in der Breite-Wohnung –, schließt hinter sich die Tür und geht durchs Treppenhaus nach unten. Durch die Glasfront beim Hauseingang sieht er: Es nieselt nicht, es regnet. Er schlägt den Kragen hoch, schimpft, macht sich auf den Weg.
Theoretisch stehen ihm drei Möglichkeiten offen. Nein, vier. Er könnte die Zürcherstraße hochgehen und dann in die Sevogelstraße abbiegen. Oder durch das «Stapfelweglein», aber das ist nass und pflotschig nach diesem Regentag. Oder durch das Gellertgut – doch dessen Tore sind seit Sonnenuntergang geschlossen. Oder den St. Alban-Teich genannten alten Gewerbekanal entlang, den Galgenhügel hoch und dann auf direktem Weg heim.
Die Zürcherstraße ist vermutlich am schnellsten, schätzt er. Aber da herrscht viel Verkehr, und die Gefahr ist groß, dass man ihn sieht, was er gerne vermeiden möchte. Sein Hin und Her soll so unauffällig sein, wie es nur geht. Hintenrum via Galgenhügel ist länger, aber dafür diskreter. Ein Vorteil, der ihn überzeugt.
Am Teich entlang begegnet er keiner Menschenseele, nur auf der Breitematte hat er, eher schemenhaft, noch zwei Gestalten gesehen, die entweder verliebt waren oder Streit hatten. Auf der anderen Seite des träge fließenden Gewässers, das die Basler vor vielen hundert Jahren angelegt haben, um beim St. Alban-Tal die Wasserkraft für die Papiermühlen nutzen zu können, stehen Bäume. Hinter der dichten Hecke zu seiner Linken sieht er die Wohnhäuser an der Lehenmattstraße, in ein paar wenigen Fenstern brennt noch Licht. Das blaue Flimmern eines Fernsehgeräts in der einen Dachwohnung fällt ihm auf. Es sind nur noch ein paar Schritte bis zur Gabelung. Sein Fußweg biegt nach rechts ab und verläuft nun parallel zur Autobahn, die ein paar Meter weiter oben mitten in die Stadt gewuchtet wurde, als man noch so richtig klotzen konnte, wenn es um leistungsfähige Straßen ging.
Eine Brücke führt ihn zuerst über den Teich, dann, nach vielleicht dreißig Metern, beginnt der spiralförmige Aufgang. Zur Rechten liegen ein paar gut versteckte Schrebergärten. Die geheimnisvollsten Basels, weil man sie fast nicht wahrnimmt, da sie von drei Seiten von alten Bäumen umgeben sind und der Teich sowie der Abhang sie ebenfalls umfassen, sodass sie fast wie von einer Faust umschlossen sind.
In Basel darf man nicht in den Schrebergartenhäuschen übernachten. Was nicht bedeutet, dass es nicht doch gemacht wird. Aber jetzt, Anfang November, kommt wohl niemand mehr auf die Idee, das Gesetz zu brechen und in einem dieser simplen Bretterverschläge zu nächtigen. Es ist dunkel dort. Stockdunkel.
Aber Eddie hört einen Hund. Zuerst nur ein Winseln. Schwer auszumachen, wo das herkommt. Er ist jetzt auf den ersten Metern der Spirale, die zügig nach oben führt, sogar über das Niveau der Autobahn hinaus. Früher einmal soll es einfach ein Pfad mit einigen recht steilen Abschnitten gewesen sein, hat ihm seine Mutter mal erzählt. Im Zuge des Autobahnbaus hat die Stadt sich Ende der 70er-Jahre aber für diese Spirale entschieden, die sich um eine Stele herum, ein Kunstwerk von Ludwig Stocker, in die Höhe schraubt. «Einrollen, Ausrollen» heißt das Ding in der Mitte.
Wieder das Winseln. Lauter nun. Auch lauter als das konstante Rauschen der Autos auf der A2. Eddie bleibt stehen. Versucht zu eruieren, wo das Geräusch herkommt. Sicherlich von den Schrebergärten. Hat da jemand seinen Hund angekettet zurückgelassen? Muss er nachschauen?
Ist das seine Sache? Er findet, nicht. Läuft wieder los. Etwa in der Hälfe der Spirale ist es definitiv kein Winseln mehr, das er hört. Der Hund schlägt nun an.
Als Pöstler hat Eddie so seine Erfahrung mit Hunden. Aller Art. Große. Kleine. Laute. Leise. Alte. Junge. Er trennt sie der Einfachheit halber in zwei Kategorien: jene, die Männer in Uniform hassen, und jene, denen so ein Pöstler völlig egal ist. Gebissen wurde er bisher nur ein einziges Mal. Ein alter, kleiner, lauter Sauhund griff ihn unvermittelt an und erwischte seine Hand. Rechts. Dieselbe, an der er nun den Schnitt hat. Tat verdammt weh, hatte zur Folge, dass er eine Tetanusspritze erhielt und drei Tage krankgeschrieben wurde. Immerhin.
Seither passt er auf. Man hat ihm zwar verschiedentlich erklärt – und mit «man» meint er Hundebesitzerinnen, Tierärzte, Besserwisserinnen, Klugscheißer und selbsternannte Fachleute – dass es am klügsten ist, souverän zu bleiben, seines Wegs zu gehen und den Köter – egal welcher Art – zu ignorieren. Nur so werde das Tier zur Einsicht gelangen, dass sein Imponiergehabe völlig nutzlos sei.
Seine Erfahrung hat ihn eines Besseren belehrt. Ein böser, aggressiver Köter merkt ganz genau, dass er Eindruck macht, selbst wenn man souverän ist und einfach unbeirrt weitergeht. Oder dann erst recht.
Eddie ist sich nun sicher. Der kläffende Hund ist nicht unten bei den Schrebergärten. Das hässliche Geräusch kommt von oben. Weil dieser blöde Aufgang gleichzeitig im Kreis herumführt und steil ansteigt, Spirale eben, kann er noch nicht sehen, was ihn weiter vorne erwartet.
Ist der Hund an der Leine? Kommt ihm jemand entgegen?
Für einen Moment erwägt er umzukehren. Aber es wäre ein verdammt weiter Heimweg, den er in Kauf nehmen müsste. Das würde ihn bestimmt fast eine Dreiviertelstunde mehr kosten.
«Hallo?», ruft Eddie. «Halloooo!»
Das Hundebellen wird lauter und aggressiver, kommt aber nicht näher. Die Hoffnung, eine menschliche Stimme würde sich melden und irgendetwas sagen wie «Kommen Sie nur, der beißt nicht, und ich habe ihn an der Leine», erfüllt sich nicht.
Zögerlich geht er weiter nach oben. Nur noch zwei, drei Meter, dann hat er wieder einen schnurgeraden Weg vor sich und kann mindestens zehn oder zwanzig Meter weit sehen.
Der Regen ist stärker geworden. Es ist jetzt nach 23 Uhr. Auf der Autobahn ist es plötzlich sehr ruhig. Fast kein Verkehr mehr. Eddie ist nicht von ängstlicher Natur, aber in einer Nacht wie dieser in diesem isolierten Teil der Stadt, der, so paradox es klingen mag, nur ein paar Meter vom meistbefahrenen Autobahnabschnitt der Nordwestschweiz entfernt ist, befällt ihn ein ungutes Gefühl.
Was, wenn hier zwei Schlägertypen mit einem verdammten Kampfhund unterwegs sind und ihm nicht bloß einen Schrecken einjagen wollen, sondern wirklich Böses im Schilde führen? Was, wenn der Hund irgendwo abgehauen ist, Tollwut hat und sich in den nächsten Sekunden auf ihn stürzt? Was, wenn es ein Wolf ist? Ist ja noch keine zwei Monate her, seit gemeldet wurde, dass im nahen Südbaden, in der Nähe von Rheinfelden, ein Wolf eine Ziege gerissen hat. Und so ein Wolf, hat es geheißen, könne im Lauf eines Tages gut und gerne sechzig Kilometer zurücklegen. Das reicht locker.
Eddie geht trotzdem weiter. Sein Herz pocht. Sein verletzter Finger pocht. Er vermutet, dass er wieder blutet. Das macht die Sache nicht besser. Kann das Biest sein Blut riechen? Zieht es das geradezu magisch an?
«Chabis», sagt er sich. «Reiß dich zusammen!» Und geht weiter. Das Bellen ist nun eindeutig zu verorten. Es kommt von weiter vorne. Aus der Richtung, in die er geht. Sehen aber kann er nichts. Der Weg ist frei. Niemand kommt ihm entgegen. Weder Schlägertypen in schwarzen Kleidern mit über den Kopf gezogenen Kapuzen noch andere dubiose Gestalten.
Das verursacht in seinem Kopf ein schwer entwirrbares Durcheinander: Was er hört, macht ihm Angst. Was er sieht, sagt ihm: Geh einfach weiter. Da ist nichts. Du bist ein Schisshas.
Also geht er. Der Weg, nun eine Art Brücke etwa zehn Meter über dem Grund, macht nach fünfzehn Metern einen Links-/Rechtsknick. Dort wird er Teil des Hangs, flankiert diesen auf einer Galerie parallel zur Autobahn. Wegen des Knicks ist die Fortführung wiederum nicht einsehbar. Das Bellen lässt nicht nach. Eddie biegt um die erste Kurve. Nichts. Nur der Furor des jetzt scheinbar heiser werdenden Tieres ist zu hören. Um die zweite Kurve. Nichts. Nun geht es geradeaus und nach einer leichten Biegung hinauf zur Gellertstraße. Unter ihm ist die Autobahn. Drei Fahrspuren in Richtung Süden. Anschließend die Trassen der Bahn. Die Fahrbahn für die Autos in Richtung Norden ist verbaut, liegt hinter einer Wand mit Deckel drauf. Über den Wipfeln der Bäume zu seiner rechten Seite sieht er die ersten Häuser.
Zivilisation. Menschen. Stadt. Eddie schwitzt. Er beschleunigt seine Schritte, obwohl ihm bewusst ist, dass er direkt auf den bellenden Hund zugeht. Aber es gibt kein Umkehren mehr. Wenn er Glück hat, sieht er oben auf der Brücke, die die Gellertstraße über Eisen- und Autobahn führt, vielleicht einen Velofahrer oder einen Fußgänger, dem er nötigenfalls zurufen könnte.
In dem kleinen, von einem Mäuerchen umgebenen Geviert zu seiner Linken meint er zu sehen, wie ihn zwei bernsteinfarbene Augen anblitzen. Irritierend ist, dass das Bellen aufhört. Es geht nun wieder in ein Winseln über. Dann ein Röcheln. Eddie stellt sich vor, wie der Hund – es muss ein großer Hund sein, ein kleiner hätte nicht dieses Stimmvolumen – nun geifert und sabbert und an seinem eigenen Geifer und Sabber zu ersticken droht.
Schnellen Schrittes geht er die letzten Meter den Hang hinauf zur schönen, breiten, hell beleuchteten Straße. Immer noch sprungbereit, darauf gefasst, einer möglichen Attacke ausweichen zu müssen.
Er sieht noch einmal die funkelnden Augen. Oder meint, sie zu sehen. Er hört das Winseln. Es ist nun fast ein Jammern. Aus seiner Angst wird unversehens Mitleid. Müsste er nicht zu dem Hund gehen und nach dem Rechten schauen?
Er lässt es bleiben. Er steht jetzt oben auf dem Trottoir. Wenn er die Straßenseite wechselt, ist er unmittelbar neben dem Gellertschulhaus. Mehrere Wohnblöcke, meist leicht nach hinten versetzt, von etwas Rasen umfasst, sind in unmittelbarer Nähe.
Eddie atmet auf. Ein kleines bisschen Blut kann er im Licht der nächsten Straßenlaterne an seinem Zeigfinger in Richtung Nagel fließen sehen. Der Regen fällt leise. Kein Mensch ist in Sicht. Das Hundegebell hat niemanden aufgescheucht.
Siri
Es ist ein friedlicher Novembermorgen. Nach all dem Regen der letzten beiden Tage gibt sich die Sonne Mühe, für etwas Abwechslung zu sorgen. Die Luft ist kühl und frisch. Fast unglaublich: Weil es so lange – bis weit in den Oktober hinein – sommerlich warm war, hat David Friedrich erst vor zwei Wochen zum ersten Mal die Heizung aufdrehen müssen.
«Mich fröstelt», hatte Anuschka gesagt. Er war gerade aus dem Büro gekommen, hatte wieder einmal widerwillig Bestellungen erledigt und Rechnungen gebucht. Fragend hatte er Marie-Jo angeschaut, die elegante Elsässerin, die ein paar Jahre älter ist als er und schon bei seinem Vater «die gute Seele» war.
«Sie hat recht, David. Es ist höchste Zeit, die Heizung aufzudrehen.»
Isabelle, seine Lehrtochter, hatte nichts gesagt. Nur genickt.
Nun gut. Er findet es ehrlich gesagt jetzt auch angenehm. Und die Temperaturen werden wohl nicht noch einmal in Richtung der Zwanzig-Grad-Marke klettern. Selbst wenn diesem endlosen Sommer alles zuzutrauen ist.
Bei Marie-Jo sitzt Frau Wegmüller auf dem Stuhl. Isabelle hat ihr vor zwanzig Minuten die Haare gewaschen. Anuschka ist mit der alten Frau Trist beschäftigt. Und er erwartet in etwa fünf Minuten diese seltsame Meredith Jones. Noch keine drei Monate Kundin bei ihm. Wohnt in dem kühlen, aber eleganten Neubau unten bei der Letzimauer. Amerikanerin. Ihr Mann ist Forscher bei der Roche. Viel weiß er nicht über sie. Er schätzt sie auf etwa 45, also gleich alt wie er. Ist irgendwo in den Südstaaten aufgewachsen. Alabama oder Mississippi. Hat einen entsprechend heftigen Akzent. Aber gute, feste Haare. Sie ist keine Schönheit, aber sehr gepflegt. Trägt teuren Schmuck und einen Ehering mit Brillanten. Sie kann kaum Deutsch. Deshalb bedient er sie. Anuschkas Englisch ist rudimentär. Marie-Jo kann Französisch – logischerweise fließend –, Italienisch und zudem etwas Spanisch. Isabelle kann gut Englisch, aber als Lehrtochter darf sie noch nicht schneiden. Und Patrizia ist immer noch im Mutterschaftsurlaub.
Mrs Jones’ Fremdsprachenkenntnis reicht so ungefähr für ein Grüezi und ein Adieu. Für «heiß», wenn beim Haarewaschen die Temperatur nicht stimmt, und «kalt», wenn es ihr zu frisch ist draußen. Oder drinnen.
Sie ist eine einfache Kundin. Will keinen komplizierten Haarschnitt, braucht noch keine Färbung, weil sich in ihren dicken, hellbraunen Haaren noch praktisch keine grauen verstecken. Er rechnet damit, dass sie nicht länger als eine Stunde im Geschäft sein wird.
Meistens kann sich David auf sein gutes Gedächtnis verlassen. Für die Beziehung zur Kundin ist es wichtig, dass er keine dummen Fragen stellt. Mit dumm meint er jene Fragen, die verraten würden, dass er bei ihrem letzten Schwatz nicht zugehört hat. Wenn er sich bei Mrs Jones zum Beispiel erkundigen würde, wie es ihrem Mann bei Novartis gefällt. Oder wie es ihren beiden Kindern geht. Sie, die kinderlos ist und das bedauert, wäre dann wohl zum letzten Mal im «Haargenau» an der St. Alban-Vorstadt gewesen.
«Wenn du dir all die Details nicht merken kannst, musste halt Notizen machen», hatte ihm Tess einmal geraten. Seine ehemalige Kollegin in Berlin, mit der er immer noch Kontakt pflegt, obwohl er seine Zelte dort abgebrochen hat.
«Schreib dir das Zeug auf, Davi.»
«Machst du das auch?», hatte er gefragt.
«Logo. Funktioniert aber nicht immer. Der Typ gestern? Der ältere Herr? Weißte noch? Der so schnell ne Fliege gemacht hat?»
«Ja. Ich weiß, wen du meinst.»
«Den hatte ich gefragt, wie es seiner Frau geht. Dabei hätt ich wissen müssen, dass es die nicht mehr gibt. Entweder weggelaufen oder weggestorben.»
«Und?»
«Hat angefangen zu heulen. Ging nichts mehr.»
Seit März ist David Friedrich wieder in Basel. Weil er so viele Jahre weg war, kannte er niemanden von der treuen Kundschaft mehr. Und er mochte ja nicht immer bei Marie-Jo oder Anuschka nachfragen. Also führt er seither tatsächlich Buch. Also nicht Rechnungen und so. Sondern eine kleine Stichwortsammlung zu seinen Kundinnen. Ergänzt mit Symbolen, die zeigen, ob die Kundin keine, billige, teure oder sehr teure Pflegeprodukte bevorzugt. Das ist noch ein Überbleibsel aus der Trickkiste seines Vaters. Genauso wie die «Bibel», das schwarze Auftragsbuch bei der Kasse mit all den Terminen drin.
Er sieht Mrs Jones kommen und öffnet ihr galant die Tür. Es fällt ihm sofort auf, dass sie anders ist als sonst. Ihre Augen sind stumpfer. Ihre Stimme bei der knappen Begrüßung ist leiser. Er hilft ihr aus dem Mantel, hängt das teure, schwere Ding an einen Bügel und bittet sie auf den Stuhl.
«The same procedure as last time, Mrs Jones?»
Ist ein kleiner Insiderwitz. Als Amerikanerin kannte sie den legendären Sketch «Dinner for One», der in der Schweiz und in Deutschland immer zu Silvester ausgestrahlt wird, nicht. Er hatte ihr davon erzählt.
Sie verzieht keine Miene. Schaut ihn im Spiegel nur mit großen Augen an.
«There is a problem, Mr Friedrich.»
«Aha. Tell me about it.»
Sie fährt sich mit der linken Hand durchs Haar, hält sie ihm hin. Stumm. Er sieht sofort, was sie meint. Sie hat ein paar ihrer Haare in der Hand.
«Oh. Haarausfall.»
«Yes.»
«Kann es geben. It happens.»
Und dann erzählt sie ihm, dass es ihr gerade nicht so gut gehe. Sie sei unruhig, nervös. Schlafe schlecht, und seit ein paar Tagen falle ihr eben jetzt auch noch auf, dass sie Haare verliert. Deutlich mehr als sonst üblich.
David merkt, dass dieser Termin doch nicht so einfach sein wird wie erwartet. Er muss die Dame beruhigen. Er muss ihr das Gefühl geben, als wäre sie hier bei ihm in einer Wohlfühlzone, wo alles, was sie gerade plagt, von ihr abfallen kann. Er senkt seine Stimme noch ein bisschen mehr als sonst. Und schlägt ihr vor, zuerst einmal zu waschen und sie solle sich doch entspannen.
Sie nickt.
Während des Waschens spürt er zwar, dass sie sich ein wenig fallen lässt und wie ihr das guttut. Aber er merkt auch, dass sich ihr Haar im Vergleich zum letzten Besuch verändert hat. Es ist weniger kräftig, an den Spitzen spröde, und er wäscht einige Haare aus.
Er redet nicht viel mit ihr. Fragt nur, ob die Temperatur okay sei, und massiert ihr ein bisschen länger als üblich den Kopf.
«Nur schneiden heute, Mrs Jones?»
«Ja, ändern Sie nichts. Und call me Meredith.»
«Gerne. Nennen Sie mich David.»
Er weiß jetzt nicht, ob er fragen soll, weshalb sie denn so unruhig sei, so nervös. Vielleicht sollte er besser warten, bis sie von sich aus eine Erklärung liefert. Oder mehr preisgibt? Aber sie ist Amerikanerin. Die sind nicht so verschlossen oder zurückhaltend. Da läuft er eher Gefahr, als uninteressiert zu gelten, als gleichgültig. Also geht er in die Offensive.
Was denn los sei mit ihr, ob ihr vielleicht Basel nicht gefalle. Oder ob ihr der Sommer auch zu lang und zu warm gewesen sei.
«That’s not it», sagt sie. «Ich liebe Basel, ich wohne so nahe am Rhein, dass ich an den heißen Tagen einfach Abkühlung finde, wenn ich sie suche. Und ich habe hier ein paar andere Expats kennengelernt, mit denen ich regen Kontakt habe. Wir sind in einer Art Club. Unternehmen Sachen zusammen, machen Ausflüge oder sammeln für irgendwelche Charities.»
«Hmm. Gut», sagt David. «Und Ihr Mann fühlt sich auch wohl hier?»
«Steve? Dem geht es sehr gut. Er fährt jeden Morgen mit der Fähre zur Arbeit, geht über Mittag joggen und kommt am Abend per Fähre wieder heim. Er liebt seinen Job. He really loves his job.»
Das sagt sie in einem Tonfall, wie es nur Amerikaner sagen können. Mit dieser tiefen Überzeugung, die ein Schweizer oder eine Schweizerin so nie hinkriegen würde.
Und so, wie Meredith über ihren Steve redet, ohne einen vielsagenden Augenaufschlag, ohne einen bösen Unterton, ohne die Andeutung von Distanz, Neid, Verabscheuung oder Gleichgültigkeit, ist es für David leicht erkennbar: Steve ist nicht das Problem. Nicht der Herd ihrer Unruhe und Schlaflosigkeit.
«It is this damn technology!», bricht es aus ihr heraus. Sie entschuldigt sich sofort für das Fluchen.
«What?»
«Technology!» Sie habe ständig Probleme mit dem Internet. Oder dann funktioniere die Programmierung des Backofens nicht oder die Uhr am Herd zeige plötzlich eine völlig falsche Zeit an. «But most of all it’s Siri.»
«Siri?»
Sie tippt mit ihrem Zeigefinger auf ihre Apple Watch. Das dumme Ding melde sich zu Unzeiten. Unterbreche Gespräche mit ihren Freundinnen, gebe ihr sinnlose Ratschläge oder Hinweise.
«Really?», fragt David. Und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
«Yes. And it’s not funny, David», sagt Meredith und mustert ihn kritisch.
«Sorry, ich sehe, dass Sie das stresst, Meredith. Aber was will denn diese blöde Siri von Ihnen?»
«Ich fand sie am Anfang ganz toll. Das war noch in Boston, als mein Mann beim MIT arbeitete. Er schenkte mir sie zum Geburtstag, 11. Mai» – David macht sich in Gedanken eine Notiz – «und sagte, ich werde schon sehen, wie hilfreich das Ding sei. Was ja auch stimmt. Ich kann damit telefonieren, WhatsApp empfangen, Schritte zählen, ins Internet. Alles. Wirklich toll. Und am Anfang habe ich es auch toll gefunden, Siri um Hilfe zu bitten.»
David weiß durchaus, wovon sie spricht. Er würde zwar den Teufel tun und sich so ein Ding kaufen, es käme ihm auch nie in den Sinn, eine Siri oder eine Alexa oder wie all die digitalen Assistentinnen heißen, nach irgendetwas zu fragen, aber er weiß, dass auch Eddie solchen Sachen gegenüber sehr viel aufgeschlossener ist als er.
«Wofür haben Sie denn Siri gebraucht, Meredith?»
«Für Rezepte zum Beispiel. Oder wenn ich beim Einkaufen etwas auf Deutsch nicht verstanden habe. Oder etwas über ein Produkt wissen wollte. Oder wenn ich mich in der Stadt verlaufen hatte und Siri mir sagte, wie ich wieder zum Barefoot Platz finde oder zum Market Place.»
«Okay. Aber jetzt nervt Siri?»
«Yes. Very much so. Es hat damit angefangen, dass sie behauptete, ich sei am Trainieren, obwohl ich gemütlich daheim in meinem Lesesessel saß und ein Buch las. Dann fing sie an, mir Ratschläge zu geben, was ich besser nicht essen sollte. Oder sie spielte Musik ab mitten in der Nacht.»
«Werfen Sie doch das Ding fort!»
«Es ist nicht so einfach, David. Erstens ist die Uhr ein Geschenk von Steve, zweitens hilft sie mir wirklich im Alltag. Ich brauche sie.»
David schneidet ihre Haare um zwei Zentimeter kürzer, macht ihr ihre Jennifer-Aniston-Frisur wieder adrett und verliert dabei kein Wort mehr über die Haare, die nicht mehr an ihrem Kopf bleiben wollen, sich selbstständig machen. Und Meredith, nach ihrer Beichte oder wie man das auch immer nennen mag, schweigt nun ebenfalls. Sie beobachtet seine Handgriffe im Spiegel, hat sich kein Magazin reichen lassen, als Isabelle ihr sehr höflich eines angeboten hatte – «Thank you, but I can’t read german» –, und David nimmt sich zwei Sachen vor: Meredith zu raten, sie soll den Haarausfall gut kontrollieren und allenfalls zum Arzt gehen wegen ihrer Anspannung und ihrer Unruhe. Und ein Abo für eine Frauenzeitschrift in Englisch zu lösen, damit all die Expats, die nun einen Teil seiner Kundschaft ausmachen, auch etwas zu lesen haben.
Die Frisur kommt gut. Etwa dreißig Minuten später fängt David an, Merediths Haar zu föhnen.
«Time to go!», meldet sich unvermittelt eine etwas metallisch klingende Frauenstimme. «Zeit zu gehen!»
Beide, Meredith und er, erschrecken.
«Shut up, Siri», faucht Meredith. Alle im Geschäft starren sie an. Sie hat es wohl lauter und aggressiver gesagt, als sie wollte. Meredith sieht die fragenden, staunenden, ablehnenden Augen. Und entschuldigt sich sofort.