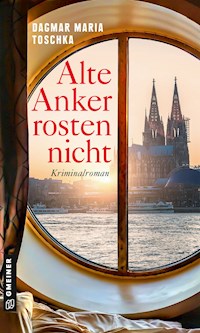Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Linda Weißenberg
- Sprache: Deutsch
Mit Witz und Schlagfertigkeit wirft sich Linda Weißenberg in die Widrigkeiten ihres ungewollten Single-Daseins, als sie bei einem Putzjob in der Deutzer Brücke eine Leiche findet. Prompt gerät sie ins Visier des Kölner Kommissars Raimund Golt, der sie aus mehreren Gründen nicht mehr aus den Augen lässt und sie schon bald des Mordes verdächtigt. Als sich die Schlinge der Indizienkette um ihren Hals schnürt, muss sie sich etwas einfallen lassen, um sich daraus zu befreien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dagmar Maria Toschka
Hafenwasser mit Schuss
Kriminalroman
Zum Buch
Neue Besen killen gut Gerade noch gelangweilte Ehefrau, stolpert Linda Weißenberg jetzt von einem Abenteuer ins nächste. Sie bezieht ein kleines Boot im Kölner Stadthafen und freundet sich hier schnell mit ihren exzentrischen Nachbarn an. Doch dann findet sie bei einem Putzjob in der Deutzer Brücke die Leiche des Mannes, den sie erst wenige Stunden zuvor kennengelernt hat. Kommissar Golt, bekannt für seine ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden, übernimmt den Fall. Er fährt mit seinem Camper am Hafen vor, um Linda und die anderen Bootsbewohner zu beobachten. Es dauert nicht lange, bis sie sich verdächtig machen. Auch Linda, die Golt bereits von einem früheren Fall kennt und die er mehr mag, als ihm lieb ist. Schweren Herzens ermittelt er gegen sie. Linda versucht jedoch selbst, sich auf ihre ganz eigene Art diesen Mordverdacht vom Hals zu schaffen. Durch unbedachte Alleingänge begibt sie sich in brenzlige Situationen, die bald ziemlich ausweglos erscheinen.
Am Niederrhein geboren, machte Dagmar Maria Toschka, nach kurzen Ausflügen in ein Kloster und ans Fließband einer Plätzchenfabrik, das Abitur in Geldern. Sie studierte Literatur, Pädagogik und Psychologie, arbeitete in England, den USA und Kanada. Später war sie als Hörfunkreporterin und im Tourismus tätig, gab ein Reisemagazin heraus und wurde schließlich Autorin und Dozentin für kreatives Schreiben. Ihre Bücher entstehen meist am Tatort oder auf einem Boot im Kölner Hafen. Dagmar Maria Toschka beschreibt in ihren Kriminalromanen neben den Mordfällen auch außergewöhnliche Lebensentwürfe – immer mit Humor und Spannung.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © engel.ac / AdobeStock
ISBN 978-3-8392-7284-8
Widmung
Mit herzlichem Dank an Ralph Ingrid, Thomas, Henning Werker und Ali Yünlü
Untergang?
Ich gurgle, japse nach Luft, ringe mit schmutzigem Wasser, gehe unter, ersticke fast, strample mich mit all meiner Kraft hoch und bekomme gerade wieder Luft, als mich ein Schlag trifft und wieder herunterdrückt. Ich schlucke dreckiges Wasser, kämpfe mich zurück, spüre den Schmerz. Als ich den Kopf wieder über Wasser bekomme, will ich um Hilfe rufen. Das Wasser färbt sich rot. Ich kämpfe um mein Leben, schlage mit den Armen um mich, will atmen, kann es nicht. Es ist kalt. Etwas in mir will aufgeben, sich dem Rhein ergeben, Erlösung finden, als jemand meinen Namen ruft. Ich kann nicht antworten. Hänge zwischen Wasser und Luft, zwischen Atem und Untergang auf dem Weg zur Hölle.
»Linda!«, höre ich wieder, ein Sog zieht mich hinunter. Alles an mir ist schwer und kalt. Ich kann nichts tun. Warum rettet mich keiner? Ich will nicht im Rhein begraben sein.
»Linda! Hilf mir, ich blute«, ruft diese Stimme, die klingt, als sei sie weit weg.
Eine Hand. Ich greife nach ihr. Sie zieht mich hoch. Dann noch ein Schlag, lautes Pochen. Ich fasse mir an die Stirn, in warmes Blut, öffne die Augen. Bin nicht mehr im Wasser. Gott sei Dank. Ich hechle.
Ich fühle mich verloren, weiß nicht, wo ich bin und wer mich ruft, sehe mich vorsichtig um. Klopfen. Ist es Tag oder Nacht? Mich umgeben Dunkelheit und Enge wie in einem Sarg. Dies ist nicht mein Schlafzimmer zu Hause. In welche Richtung ich mich auch bewege, überall stoße ich an. Selbst nach oben. Der Raum endet einen Meter über meiner Nasenspitze. Mein Kopf pocht. Ich versuche, mich aufzurichten, stoße an einen Balken über mir und fluche. Was mache ich hier?
»Linda«, höre ich gedämpft wie aus der Ferne und kann mir nicht zusammenreimen, wer mich ruft.
Mit der Hand ertaste ich einen schmalen Spalt, durch den ein wenig Licht scheint. Vielleicht eine Türe. Sie lässt sich öffnen. Frische Luft kommt herein. Ich kann wieder atmen.
Erwachen
Langsam fügten sich hinter meiner pochenden Stirn Erinnerungsstücke zusammen und mir dämmerte, wo ich war: auf der Happy Days. Einem alten kleinen Kahn im Yachthafen mitten in Köln. Ich schaute auf die Uhr. Halb neun. Mein Zuhause, eine behagliche Villa im Stadtteil Rodenkirchen, nur ein paar Kilometer von hier, hatte ich verlassen, um mich hierher zurückzuziehen. Mein Leben dort hatte nach fast 25 Jahren geendet. Das war gestern. Heute traf es mich wie ein Schlag.
Ich hatte Mühe, die kaum anderthalb Meter hohe Holzklappe meiner Schlafkabine aufzustoßen, auf deren Boden sich eine Matratze befand. Endlich gelang es mir und ich robbte durch sie hindurch. Als ich mich aufrichten konnte, stand ich gleich neben dem Steuerrad, dahinter die Bootstür. Durch ihre milchige Scheibe erkannte ich die Umrisse meiner Cousine Maike, die draußen vor dem Boot auf dem Steg stand. Ich zog die Schiebetür auf, die zu meinem Schrecken gar nicht abgeschlossen war. Mein Boot zog seitlich an Maike vorbei. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Dann zog es sich zu meiner Erleichterung wieder zurück. Vor Maike kam es zum Stillstand, nein, bewegte sich aufs Neue. Ein Schiff fuhr durch den Hafen, das Wasser war unruhig, meine Happy Days auch. Aber sie war angeleint, bewegte sich nur an den Tauen, die nicht stramm gezogen waren, vor und zurück.
Maike stand auf dem Steg und schaute dem Boot zu. Sie trug einen ihrer Kaftane, der ihr bis zu den Knöcheln reichte, darunter eine Hose aus demselben Stoff im gleichen, hellen Blau. Eine Bäckertüte, randvoll mit Brötchen, verströmte ihren Duft, den ich tief in mich hineinsog. Uns trennten drei Stufen im Inneren und eine kleine Laufleiste außen ums Boot herum, kaum einen Fuß breit. Ihr linker Ellenbogen war aufgeschürft. Ich sah mich um. Über dem alten Holzsteuerrad hing ein alter Putzlappen. Wohl kaum das Richtige für die Erstversorgung ihrer Wunde.
»Dachte schon, du wärst heute Nacht mit diesem Ding abgesoffen oder vor Kummer ins Wasser gegangen.«
»Hab ich erwogen, dann aber gelassen.« Ich beugte mich vor über die Stufen und nahm ihr die Brötchentüte ab. »Komm rein.«
»Wie soll das gehen?«, fragte sie.
Meine Eingangstür lag etwa einen halben Meter höher als der Steg, hinzu eine circa zehn Zentimeter hohe Umrandung der Laufleiste, über die man hinübersteigen musste, und die Bewegung des Bootes. Auf einen ausgewachsenen Hengst stieg es sich leichter auf.
»Stell dich seitlich zum Boot und setze einen Fuß auf diese kleine Laufleiste hier oben. Halte dich an dem Griff über der Türe fest. Dann ziehst du den anderen Fuß nach, drehst dich leicht, sodass du mit dem Rücken zur Tür stehst, duckst dich und kommst rückwärts nach vorne gebeugt herein. Achtung, es folgen sofort Stufen auf der Innenseite. So jedenfalls mache ich es.«
Maike raffte ihren Kaftan hoch und folgte meinen Anweisungen. Sie stellte sich seitlich zum Schiff, hob den linken Fuß, setzte ihn auf die schmale Laufleiste der Bordwand, ich nahm ihre freie Hand, um ihr Halt zu geben. In diesem Moment fuhr hinter uns eine Yacht aus dem Hafen. Es kamen Wellen im Hafen auf, mein Boot driftete leicht ab, der Steg kam etwas hoch, als sie das zweite Bein anhob, sie schwankte, mir flog ein Brötchen aus der Tüte. Eilig zog sie den anderen Fuß nach und drehte sich rückwärts zur Tür. Mit eingezogenem Kopf und vorgebeugtem Oberkörper kam sie wie ein Klappmesser zu mir herein.
Ich versuchte, sie zu dirigieren. Dieses Manöver erforderte ein wenig Geschick, wenn man nicht die Stufen hinunterfallen wollte, die gleich hinter der Türe lauerten und ins Innere des Bootes führten. Auch die ging man besser rückwärts herunter, in gebeugter Haltung und mit eingezogenem Kopf. Maike meisterte den Aufnahmetest in mein neues Zuhause und stand nun mit mir im Eingangsbereich, gleich neben dem alten Steuerrad, dessen Holz schon einige Kerben aufwies. Das gefallene Brötchen gab ich verloren. Es war ins Hafenwasser gefallen und weichte darin auf.
Maike schnaufte ein wenig, als ich sie bat, mit mir drei weitere Stufen, ebenfalls rückwärts, hinabzugehen. Dort unten befand sich ein kleiner Raum mit Tisch und zwei gepolsterten Sitzbänken. Der Durchgang dorthin war schmal und niedrig, man zog besser den Kopf ein.
»Hast du einen Erste-Hilfe-Kasten?«, fragte sie.
Ich zuckte mit den Schultern. So weit hatte ich meine neue Bleibe noch nicht erkundet. Ich folgte ihr die Stufen herunter, bat sie, sich hinzusetzen, damit ich an ihr vorbeikam, und ging durch den engen Raum, den ich Salon taufte, in eine Mini-Küchenzeile, die sich dahinter befand. Hier passte auch nur einer von uns rein. Ich öffnete einen kleinen Holzhängeschrank, dessen Türen so laut knarzten, als würde es sie schmerzen, sich zu bewegen. Darin fand ich ein paar Heftpflaster und klebte ihr eins davon auf die Wunde.
»Habe einen von diesen E-Scootern ausprobiert«, erklärte sie, »weil ich die letzten Meter vom Auto nicht zu Fuß gehen wollte. Parke unter der Severinsbrücke. Es lief ganz gut, bis mir so ein junger Typ mit seinem Fahrrad die Vorfahrt nahm. Dann verlor ich die Balance und flog hin.«
»Ich weiß nicht, ob wir in unserem Alter noch auf diesem Kinderspielzeug unterwegs sein sollten.«
»Warum nicht? Ich bin doch jetzt im richtigen Alter.«
»Wofür?«
»Für alles.« Sie strich über ihr Pflaster. »Er war bestimmt zur Sturzgeburt seines ersten Kindes unterwegs.«
»Hat er das gesagt?«
»Nein. Aber ich nehme das zu seinen Gunsten an. Sonst müsste ich denken, er sei ein rücksichtsloser Dummkopf – und das möchte ich nicht.«
»Warum nicht?«
»Es fühlt sich nicht gut an.«
»Wenn er es aber ist?«
»Bevor ich schlecht über jemanden denke, denke ich lieber gar nicht an ihn.«
»Klappt das?«, fragte ich.
»Ich übe es.«
Das musste ich auch mal ausprobieren und aufhören, an Adrian zu denken.
»Und du?«, fragte sie, »Überfallen worden? Vom Klabautermann?«
»So ungefähr. Die Schlafkajüte ist eng und niedrig. An der Decke hängt ein Balken, an den bin ich wohl gestoßen.« Ich fasste mir an die Stirn. »Habe geträumt, dass ich ertrinke. Kein Wunder, so wie sich das Boot hin und her bewegt.«
Die Happy Days war mit der Bugspitze am Steg festgemacht und längsseits rechts an einem schmaleren Seitensteg. Sie zog sich an ihren Leinen vor und zurück.
»Anfangs hatte ich Angst, dass ich aus der Parkbucht heraus in den Hafen treibe und das Schiff ohne mein Zutun ablegt. Aber dann zog es sich wieder sanft zurück. Ich kann ja so ein Boot gar nicht steuern. Ich wäre verloren, wenn es sich wirklich losreißen würde.«
»Besonders weit wärst du nicht gekommen, bevor die Hafenmauer dich aufgehalten hätte. Das Hafenbecken ist ja nicht sehr groß. Du hättest von Bord springen und zurück zum Steg schwimmen können«, sagte Maike.
»Nachts im Nachthemd.«
»Im Dunkeln hätte das ja keiner gesehen. Sonst gehst du heute Nacht besser im Badeanzug schlafen.«
»Danke für den Tipp.«
»Jederzeit.«
»Kaffee?«
»Bitte.«
Sie sah sich um. »Wo ist denn das Bett? Ich sehe keins.«
»Schau mal geradeaus die Stufen hoch.«
Ich zeigte auf die kleine Holzklappe oben gleich neben dem Steuerrad.
»Passt du da durch?«
»Ich robbe.«
»Das ist nichts für Phobiker.«
»Man spürt einen Hauch von Endlichkeit. Es fühlt sich an wie im Sarg.«
»Damit wollte ich mir eigentlich noch Zeit lassen.«
»Mach das.«
»Was?«
»Das mit dem Zeit lassen.«
Vornübergebeugt hatte sie sich in den schmalen Spalt zwischen Tisch und Bank geklemmt, um sich zu setzen. Alles war am Boden befestigt und ließ sich nicht verschieben.
»Hier wohnst du also nun«, sagte Maike.
»Erst mal«, antwortete ich.
Sie grinste. »Gemütlich.«
Ich war froh, dass sie meinen Entschluss weder hinterfragte noch kommentierte, und bot an, Kaffee zu kochen. In der winzigen Küche standen eine kleine Kaffeemaschine, ein Porzellanfilter und ein Wasserkessel. Ich suchte Tassen und Teller zusammen und legte die Brötchentüte auf den Tisch. Im Kühlschrank befanden sich noch ein bisschen Butter und Marmelade. Ansonsten war er leer.
»Ist mal was anderes.« Maike schnitt eines der Brötchen auf.
»Ja ja, das ist es.« Eigentlich fühlte ich mich selbst auf diesem Schiff, das inklusive Bugspitze kaum sechs Meter lang war, wie eine Sardine in der Dose. Aber ich war froh, erst mal eine Bleibe gefunden zu haben, die nichts kostete. Ich wunderte mich selbst, dass ich diese Entscheidung spontan getroffen hatte und wirklich von zu Hause weggegangen war.
»Du tauschst also ein Haus mit vier Schlafzimmern gegen ein altes, enges Boot auf dem Rhein und dein sicheres Leben an der Seite eines erfolgreichen Apothekers gegen eine ungewisse Zukunft ohne festen Boden unter den Füßen.«
»Der erfolgreiche Apotheker ist leider ein Hallodri.«
Sie nickte. »Mutig, Linda. Respekt.«
»Was ich jetzt brauche, ist nichts weniger als ein neues Leben. Und Geld. Ich brauche Arbeit.« Ich reichte ihr die Marmelade. »Willst du dir nicht schnell die Blutflecken aus deinem Kaftan waschen?«
»Jetzt bleibe ich erst mal sitzen. Ob ich je wieder herauskomme, ist fraglich. Schon beim Einatmen stößt mein Bauch an die Tischkante.«
Maike war mit ihren 1,70 Meter etwa so groß wie ich und rundum rund. Dieses schmale Boot war für jemanden mit ihrer Statur nicht gemacht. Obwohl ich um einiges weniger wog als sie, stieß auch ich ständig überall an.
»Die schlechten Nachrichten vorweg«, begann Maike, während die Kaffeemaschine nebenan vor sich hin tuckerte. »Als ich gestern nach Hause kam nach unserem turbulenten Urlaub auf dem Rhein, musste ich feststellen, dass ein Rohr im Bad leckte und meine Wohnung unter Wasser stand. Habe gleich einen Handwerker angerufen, der mir ein paar seiner Leute vorbeischickte, um es dichtzumachen. Es wird ein paar Tage dauern, bis ich wieder in meine Wohnung kann. Aber Alice, eine Freundin aus meinen Künstlertagen, arbeitet auf einem Campingplatz gleich am Rhein drüben in der Nähe der Poller Wiesen. Sie lässt mich dort für kleines Geld im Zelt schlafen. Ich fahre gleich nachher hin.«
»Camping, das ist ja super. Habe ich immer geliebt.«
»Seit wann?«, fragte sie.
»Seit immer.«
»Wann warst du mit Adrian in den letzten 25 Jahren zelten?«
»Nie.«
»Kannst du mir mal sagen, warum die Leute von den spannendsten Dingen träumen und sich dann im Alltag mit den langweiligsten zufriedengeben?«
Was von oben
Ich schenkte Maike Kaffee ein, während sie versuchte, das kleine Schiebefenster hinter sich zu öffnen. Es klemmte, doch gerade, als sie es mit einem Ruck aufgezogen hatte, kam vom Nachbarschiff, das um einiges größer war als die Happy Days, ein Schwall Wasser herunter und traf ihren Kopf. Sie zog den Kopf erst ein, schob ihn dann aber gleich durchs Fenster, um zu fluchen, ob man da drüben keine Augen im Kopf hätte.
Eine junge Frau mit einem dunklen, seitlich geflochtenen Zopf schaute über die Reling zu uns herunter. »Ist was passiert?« Sie sprach mit osteuropäischem Akzent. Dann erkannte sie, dass ihr Schmutzwasser Maike getroffen hatte, und schickte eine Litanei von Entschuldigungen hinterher. Eine zweite Frau schaute über die Reling, mit blonden, aufwendig frisierten Haaren und reichlich Make-up im Gesicht. »Ilona, ich habe dir tausend Mal gesagt, du sollst kein Brackwasser über Bord kippen, wir bekommen Ärger mit der Hafenmeisterin.«
In Maikes Haaren klebten Sachen, von denen keiner wissen wollte, worum es sich da handelte.
»Komm, wasch dir schnell den Kopf über dem Spülbecken«, bot ich an. »Im Notfall mit Spüli.«
Es klopfte. Immer noch im Nachthemd ging ich hoch zur Schiebetür und öffnete. Draußen auf dem Steg stand die blonde Frau von der Yacht nebenan. Sie stellte sich als Marisa van Gedden vor und lud uns auf ihre Blue Sky ein, um die Sache wiedergutzumachen.
»Mein Frisör ist noch da. Er bringt das Haar Ihrer Freundin wieder in Ordnung. Danach frühstücken wir gemeinsam, der Caterer ist unterwegs, mein Mann Richard auch.«
Schnell strich ich mit den Fingern durch meine krausen Locken, die auch einen Frisörbesuch benötigten, zog mir was an und ein paar Bröckchen aus Maikes Haar. Dann verließen wir unser kleines Boot. Maike raffte ihren Kaftan hoch, um genügend Beinfreiheit zu bekommen. Aber er rutschte immer wieder runter, bevor sie den großen Schritt herunter auf den Steg machen konnte. Deshalb stopfte sie sich den Stoff in die Hose und sah nun aus wie ein Ballon. Wir liefen einige Meter über unseren kleinen Seitensteg zum Hauptsteg, bogen links ab an unserem Heck vorbei und standen vor unserem Nachbarschiff, der Blue Sky. Dort warteten die Wasserschütterin und Marisa van Gedden. Deren Yacht, mit der ich mir eine Parkbucht teilte, war doppelt so breit und lang wie meine Happy Days. Zwei weiße Treppen am Heck rechts und links führten hoch an Bord. Man erreichte sie ebenerdig vom Hauptsteg aus, das Schiff hatte rückwärts angelegt. Hier musste man keinen doppelten Rittberger veranstalten, um es zu betreten, sondern ging bequem sechs Stufen hoch. Oben erwartete uns eine U-förmige Sitzbank in weißem Leder mit karamellfarbenen Kissen sowie einem großen Tisch. Der Caterer erschien, verteilte Platten mit Canapés und stellte einen Sektkühler auf den Tisch. Unsere Nachbarin führte Maike durch eine verdunkelte Schiebetür aus Glas ins Innere des Schiffes zum Frisör. Von hinten sah ich, dass noch ein Zipfel ihres Kaftans in ihrer Hose feststeckte. Kaum saß ich, kam eine junge Frau in dunkelblauem Hosenanzug mit einem kleinen Jungen an der Hand vom Steg aus hoch und gesellte sich zu mir. Sie stellte sich vor als Annabelle Hartung, Richard van Geddens Assistentin. Ich schätzte sie auf Mitte 30, sie trug blutroten Lippenstift und ihre langen braunen Haare in einem strengen Knoten. Der Junge, vielleicht fünf Jahre alt, war ihr Sohn Paul. Er lief auf Marisa zu und umarmte sie, dann warf er sich auf das Sofa und fühlte sich offenbar wie zu Hause. Auf dem Tisch stand eine Porzellanschale mit blau verziertem Deckel. Den öffnete er, um etwas hineinzulegen. Für Onkel Richi, sagte er zu Marisa van Gedden. Die schaute nur kurz, denn sie unterschrieb gerade Unterlagen, die Frau Hartung ihr zusammen mit einem Päckchen hinhielt. »Das ist der Tablettennachschub für Richard. Alles wie immer.« Schon gingen sie und Paul wieder von Bord. Die drei wirkten wie ein eingespieltes Team.
Marisa goss mir Kaffee ein und winkte in Richtung Steg. Dort kam ein älterer Herr entlang, mit welligem Haar, Sonnenbrille, schwarzem Sakko, weißem Hemd und karminroter Hose. Dazu Schuhe in derselben Farbe.
»Richard, da bist du ja. Darf ich dir unsere neue Nachbarin von der Happy Days vorstellen?« Marisa zögerte, ich hatte meinen Namen noch gar nicht genannt. Er wartete ihn auch nicht ab, sondern sagte:
»Sie wollen bestimmt mal auf einem richtigen Schiff frühstücken. Wie hält Harry das in seinem Bötchen nur aus? Der Kerl könnte sich längst was Gescheites gekauft haben. Hier fehlt Kaffeemilch. Hat das schon jemand bemerkt?«
Er setzte sich. Marisa sprang auf, öffnete die Schiebetür und kam kurz darauf mit Milch zurück. Richard griff nach einem Canapé, dabei fiel ihm eine Krabbe auf einen seiner Slipper. Mit einer lässigen Fußbewegung befreite er sich von dem toten Tier und ließ es auf das helle Parkett unter sich fallen, ohne groß Notiz von diesem Malheur zu nehmen.
»Sind Sie Harrys neue Freundin? Seine Erika hat er in den Wind geschossen, richtig?«
»Richard!«, sagte Marisa in ermahnendem Ton.
»Wer auch immer wen wohin geschossen hat«, erklärte ich, »die beiden sind wieder zusammen und verreist, deshalb lassen sie mich hier wohnen.«
»Echt, die haben sich versöhnt?« Richard rutschte etwas Kaviar vom Brot, was eine kleine Schmierschicht über seinen Handrücken und einen goldenen Siegelring zog. Er wirkte fahrig und wischte sich mit einer Serviette sauber. Er müsse dann auch wieder los. »Schon nach neun. Ich bin spät dran. Sei pünktlich heute Abend, du weißt, wir sind bei den Bernsteins eingeladen«, sagte er zu Marisa, ohne sie anzusehen. Er beugte sich über den Tisch, öffnete den Deckel der Porzellanschale, griff hinein und nahm etwas heraus, das er sich in die Jackentasche steckte. Unten auf dem Steg zündete er sich eine Zigarette an, während er in Richtung Hafenausgang lief. Wir sahen ihm aus luftiger Schiffshöhe nach.
Die Lachs-Canapés sahen gut aus, ich nahm eins. Maike sollte sich ruhig noch eine Weile mit dem Frisör vergnügen, dann konnte ich mich so richtig satt essen. Seit meinem Auszug gestern Nachmittag hatte ich nichts mehr gegessen. Meine neue Zukunft begann besser mit wohlgenährtem Magen. Nach und nach bediente ich mich an allem, was auf dem Tisch stand und von Marisa kaum beachtet wurde. Sie schien ihren eigenen Gedanken nachzuhängen, blickte immer wieder herunter auf den Steg, den man von hier oben aus bis zum Hafeneingang überblicken konnte. Das war mir ganz recht. Ich genoss es, im Freien zu sitzen. Obwohl erst Ende April, war es sonnig und angenehm warm an Deck.
Nach einer Zeit des Schweigens, in der ich ordentlich aß, erhob sich Marisa von ihrem Sitz und winkte. »Da ist meine Tochter Cara. Meist kommt sie zum Frühstück vorbei, bevor sie in die Uni geht.«
»Wohnen Sie auf Ihrer Yacht?«, fragte ich.
»Nein, wir haben eine Villa draußen in Hahnwald. Wenn es bei meinem Mann spät wird, bleibt er oft in seiner Stadtwohnung. Wir treffen uns dann zum Frühstück auf der Yacht. Das ist für alle das Bequemste. Und ich freue mich, wenn ich alle um mich habe. Leben Sie allein?«
»Ich glaube schon.«
»Cara, Schatz, hast du gut geschlafen?« Marisa umarmte ihr Kind, das seine blonden langen Haare zu einem Krönchen auf dem Kopf gedreht hatte. Alles an ihr wirkte makellos, ihre Haut so hell und zart wie Mozzarella.
Cara setzte sich auf die Polster mit etwas gelangweilter Miene und saftig vollen Lippen, die aussahen wie ein großer Schmollmund, und bekam sofort Kaffee von ihrer Mutter eingeschenkt. »Gut geschlafen, Spätzchen?«
Das Mädchen reagierte kaum, nippte nur an der Kaffeetasse. Ich schätzte sie auf Anfang 20. Sie legte ihre Endlosbeine übereinander, während sie sich mit einem Kaviar-Canapé zurücklehnte. Keine fünf Minuten später verabschiedete sich das Spätzchen wieder.
Ich aß, Marisa schwieg. Maike ließ auf sich warten. Es dauerte noch fast eine Stunde und viele weitere Häppchen, bis sich die Schiebetür endlich wieder öffnete und Maike samt Frisör ins Freie trat. Meistens schlang sie sich Tücher zu einem Turban um den Kopf und scherte sich wenig um ihre Haare, die kaum zu einer Frisur taugten, wie sie fand. Zusammen mit ihren Kaftanen sah das dann so aus, als käme sie geradewegs aus Afrika. Heute dagegen war sie mal richtig gut frisiert, und weil die Gelegenheit so günstig war, auch gleich geschminkt. Sie begann nun, die von mir noch nicht verwerteten Canapés zu essen, bis wir schließlich gegen halb elf die Yacht wieder verließen und zu meiner Happy Days wechselten. Auf der Treppe hinunter zum Steg kam uns eine junge Frau mit Rastalocken und Yogamatte unter dem Arm entgegen.
Eigentlich hatten Maike und ich uns verabredet, um Zukunftspläne für mich zu schmieden. Ich wollte wieder arbeiten, wusste aber nicht, was.
»Du bist künstlerisch interessiert, aber nicht ausgebildet. Du könntest ein Nageldesignstudio eröffnen. Die schießen wie Pilze aus dem Boden«, schlug Maike vor.
»Auf so miese Ideen komme ich ja noch nicht mal alleine. Fällt dir da nichts Besseres ein? Trink mehr Kaffee.«
»Du bist finanziell verwöhnt, musstest nie arbeiten, hast dein Studium nie beendet, stell dir das mal nicht so einfach vor, deinen Lebensunterhalt jetzt selbst zu verdienen.«
»Wer hat von einfach gesprochen? Ich bin zu allem bereit. Du sagst selbst immer: Jammern ist wie schaukeln, man kommt nicht von der Stelle.«
Nach einer angeregten Stunde des Kopfzerbrechens ohne brillante Ideen erhielt Maike einen Anruf von Alice, der Bekannten, die ihr eine Schlafgelegenheit auf dem Campingplatz vermitteln wollte. Nach einer kurzen Unterhaltung legte sie auf.
»Komm mit«, sagte sie, »vielleicht ist ein Job da für dich drin.«
»Was denn für einer?«, fragte ich.
»Ich hab’s nicht ganz verstanden. Alices Mutter ist ins Krankenhaus gekommen. Jemand muss die vertreten. Ich fahr uns schnell hin.«
»Mit dem Auto, oder? Nicht mit einem E-Scooter.«
»Ich will ja, dass wir das überleben«, antwortete sie.
Neues Ufer
Maikes hellroter Golf bildete einen schönen Farbkontrast zum hellen Seegrün der Severinsbrücke, unter der er parkte. Schon von Weitem sah ich ein Knöllchen unter dem Scheibenwischer.
Maike riss es wütend runter. »Das Parken in Köln frisst einem den letzten Hafer aus der Tasche.«
Mein Auto stand in der Tiefgarage gleich neben dem Hafen und aß mir eine ganze Haferplantage aus der Tasche, so teuer wie die Parkgebühren dort waren. Das musste ich bald ändern.
Wir fuhren los, überquerten den Rhein und fuhren auf der anderen Seite an den Poller Wiesen entlang, bis wir in eine kleine Straße abbogen. Weidenweg, las ich auf dem Straßenschild. Auf dem Asphalt ein großes Zeichen in Blau-Weiß: Fahrradstraße. Mit unserem Auto waren wir nur zu Gast, höchstens geduldet. Entsprechend langsam fuhr Maike. Kurz nach zwölf erreichten wir den Campingplatz, verwunschen hinter Bäumen und Sträuchern.
Eine Frau in geblümten Leggins und lila T-Shirt winkte uns zu. Sie saß auf einer Bank vor einem grün gestrichenen Container mit weißen Fenstern, in ihm war offenbar die Rezeption der Anlage. Es war Alice. Wir parkten das Auto und gingen auf sie zu. Auf ihrem Shirt sah ich ein Logo mit bunten Lettern: Campingplatz der Stadt Köln. Sie wirkte angespannt, ihre Mutter Gundel war gestürzt, auf dem Weg zu einem Putzjob für einen Kunden, der wichtig für sie war. Alice konnte jedoch nicht für ihre Mutter einspringen. Auf dem Platz war zu viel los. Ihre Schwester hatte nur kurz die Mutter im Krankenhaus besucht und Alice einen Schlüssel gebracht, den man für jenen Raum brauchte, der gereinigt werden sollte.
Wenn ich eines konnte, dann putzen. Und so sagte ich zu, diesen Job zu übernehmen, ohne zu ahnen, worum es ging. So ganz genau wusste Alice es auch nicht, aber es wurden vier Stunden vom Auftraggeber bezahlt. Ich sollte einfach schauen, was am dreckigsten aussah, und mich daran abarbeiten. Wichtig war, die Toilette vor Ort gründlich zu reinigen und das auf einem Zettel an der Wand zu protokollieren, der den Namen der Putzfirma ihrer Mutter trug: Shiny Clean.
Sie gab mir einen Schlüssel, der aussah wie ein großer schwarzer Chip. Mit ihm ließen sich alle nötigen Türen öffnen. Der zu reinigende Raum befand sich innerhalb der Deutzer Brücke. Meinen Lohn würde man mir später geben.
Ich sagte zu, war zu allem bereit. Jemand ohne Berufsausbildung wie ich musste nehmen, was man kriegen konnte. Und wenn dieser Putzjob ein erster Schritt in die neue Freiheit war, dann wollte ich ihn kurz entschlossen antreten. Maike fuhr mich gleich wieder zum Hafen, wo ich mich schnell umziehen wollte. In weißer Bluse und heller Leinenhose ließ es sich schlecht putzen. Von der Eingangstreppe aus, die hinunter ins Hafenbecken führte, sah ich meine Schiffsnachbarin Marisa auf einem Stand-Up-Paddle-Board knien, das an ihrem Schiff mit einer Leine befestigt war. Neben ihr befand sich die junge Frau mit Rasta-Locken auch auf solch einem Board. Als ich näher kam, hörte ich deren Anweisungen. »Und wir gehen in den herabschauenden Hund …«
Marisa nahm Yoga-Unterricht. Während ihre Lehrerin sich souverän auf ihrem Board bewegte, wackelte Marisa hin und her. »Komm, mach mit«, rief sie mir zu, als ich näher kam. »Gerne beim nächsten Mal. Ich muss weg.«
»Ach was, du kneifst.«
Wie recht sie hatte. Ich sah mich auf diesem Brett sofort untergehen.
Bei meiner Happy Days bog ich in den kleinen Seitensteg ein. Genau auf der Höhe meiner Tür saß ein Mann mit geschlossenen Augen zurückgelehnt auf einem schwarzen Sitzsack. Er trug eine hellgraue Jogginghose, über seinen nackten Oberkörper hatte er ein weißes T-Shirt wie eine Minidecke gelegt. Seine ergrauten Haare standen ihm vom Kopf ab. Die Frisur erinnerte an Albert Einstein, nachdem der in eine Steckdose gegriffen hatte. Die Arme hatte er unter dem T-Shirt verschränkt. Um in mein Boot zu kommen, hätte ich über ihn hinweg steigen müssen. Sein Sitzsack war fast so breit wie der Seitensteg, der zu meinem Eingang führte, und stand genau davor.
»Entschuldigung«, versuchte ich ihn leise anzusprechen. Er öffnete ein Auge und brummte etwas vor sich hin, was ich nicht verstand.
»Geht es Ihnen gut?«, fragte ich. Er machte ein zustimmendes Geräusch. »Es ist nur so, dass ich nicht in mein Boot komme, wenn Sie hier sitzen.«
Er öffnete sein zweites Auge und schaute mich verschlafen an. »In welches Boot?«
»Die Happy Days.«
Er stand auf, und prompt flog sein T-Shirt herunter, während er versuchte, den Sitzsack zur Seite zu schieben.
»Ich bin Ben, hallo, guten Morgen.« Er streckte seitlich eine Hand aus, um mich zu begrüßen. »Dann sind wir ja jetzt Nachbarn. Mein Schiff ist die Tobago Sun.« Mit dem Daumen zeigte er auf die andere Seite des kleinen Steges. »Nur keinen Stress.«
Mir fielen seine freundlichen braunen Augen sofort auf. »Nein, nein. Wer will schon Stress«, antwortete ich, hängte ihm das T-Shirt zurück über die Schulter und setzte zu meinem etwas umständlichen Einsteigeritual an. Ich war froh, dass er damit beschäftigt war, seinen Sitzsack in Schach zu halten. Bei meinem linksgedrehten Fallrückzieher-Bootseinstieg wollte ich lieber nicht gesehen werden.
»Da liegt übrigens ein Brötchen im Wasser«, sagte er.
»Ja, stimmt«, antwortete ich, »es ist sicher längst zu Brei geworden.«
»Die Enten würden sich freuen, nur kommen sie dort nicht hin, zwischen Boot und Steg ist es zu eng für sie.«
Meine Happy Days war rückwärts zum Hauptsteg eingeparkt. Das Boot verschlankte sich nach hinten etwas und ließ eine Ecke zwischen Seitensteg und Längsseite frei, wo sich das Brötchen, oder was noch von ihm übrig war, befand.
Er legte sich auf den Steg und kam mit seiner Hand so gerade an das Brötchen heran, das es zerfiel, als er es hochholte. Er trug seine tropfende Beute zum Ende des Steges und rief: »Helma, Louise!« Zwei Enten kamen angeschwommen und machten sich über den Brötchenbrei her.
Eilig zog ich mich um und wollte wieder von Bord gehen, als ich Ben draußen auf dem Steg wieder an derselben Stelle vorfand.
»Ich müsste dann mal wieder raus.«
»Oh ja, Entschuldigung.« Er stand auf und schob den Sitzsack erneut zur Seite. »Nur keinen Stress.«
»Nein, nein«, antwortete ich und lief schnell auf den Hauptsteg in Richtung Hafenausgang, am herabschauenden Hund der beiden Damen auf ihren Stand-Up-Boards vorbei.
Auf zu neuen Ufern
Der Gedanke an einen bezahlten Job beschwingte meine Schritte. Ich würde die Strecke längs des Rheins zu Fuß gehen. Vorbei an der gläsernen Fassade des Schokoladenmuseums, in der sich die Sonne spiegelte, und jeder Menge Spaziergängern, die an der Rheinpromenade entlang schlenderten. Ich schlängelte mich an ihnen vorbei, begann zu rennen, wollte keine Zeit verlieren. Alice hatte mir beschrieben, wo ich den Eingang zu diesem ominösen Raum finden würde. Demnach musste ich unter der Deutzer Brücke hindurch und dann gleich links gehen. Diesen Anweisungen folgte ich und stand vor einer Einfahrt, die bergab zu einem großen grauen Rolltor führte. Darin befand sich eine Türe. Sie führte in einen der Brückenpfeiler. Zu meiner Linken stand ein Werbeschild mit Männern in Warnwesten, die Spundwände gegen Hochwasser aufbauten. Darunter ein Slogan: DIE WASSERBESSERMACHER. Ich fand Wasser ja schon perfekt, so wie es war. Aber ich würde denen später mal mein Wischwasser geben, damit sie es besser machen konnten. Zum ersten Mal spürte ich so etwas wie Aufbruchsstimmung. Ich freute mich auf diesen neuen Job, auch wenn ich langfristig gerne etwas anderes machen wollte als putzen. Ich betrachtete ihn als Neuanfang. Gespannt lief ich die sieben, acht Meter bis zur Türe hinunter und konnte diese tatsächlich mit dem schwarzen Chip öffnen, als ich ihn vor das Schloss hielt. Kühle empfing mich und Dunkelheit. Alles war finster mit Ausnahme der ersten zwei, drei Meter, auf die ein wenig Tageslicht durch die offene Tür fiel. Vorsichtig trat ich ein, fühlte mich, als würde ich ein großes schwarzes Loch betreten. Bevor ich den Lichtschalter fand, fiel die Tür hinter mir ins Schloss und mein Herz blieb stehen. Ich sah nichts mehr und mir war, als hörte ich etwas rascheln. Vorsichtig versuchte ich, mich zurück zur Türe zu orientieren, tastete nach der Klinke und war froh, dass sie sich ohne Schlüssel von innen öffnen ließ. Denn ich hätte nicht gewusst, wo ich den Chip im Dunkeln hätte hinhalten müssen. Ich ging zurück ins Freie und atmete tief durch. Hier schien die Sonne. Alles gut, dachte ich. Hatte mich nur ein wenig erschrocken. Ich würde den Lichtschalter schon finden. Wenn ich auf eigenen Füßen stehen wollte, dann besser nicht auf Hasenfüßen. Also hielt ich wieder den Chip vor das Türschloss, öffnete die Tür und hielt sie mit meinem Fuß einen Spalt weit offen. Links an der Wand sah ich einige Lichtschalter. Die würde ich nicht erreichen, ohne den Fuß aus der Türe zu nehmen und einige Schritte im Dunkeln zu gehen. Das musste machbar sein. Andere Leute kamen schließlich auch herein, ohne sich im Dunkel zu verlieren. Ich prägte mir also ein, wie hoch sie hingen, etwa kurz über meiner Nase, stieß die Tür noch einmal weit auf und ging die paar Schritte in Richtung Schalter. Die Tür fiel schneller zu als gedacht, ich tastete mit der Hand an der Wand entlang und hörte wieder etwas rascheln. Lauter als vorher und vor allem näher. Endlich fand ich den ersten Schalter, drückte ihn hastig, und sofort sprangen Deckenleuchten an. Wieder ein Rascheln. Ich sah mich um. Nichts bewegte sich. Um mich herum war alles grau. Betongrau. Ich war in einem Bunker gelandet. Hunderte von Quadratmetern groß, wie es schien. Die Decke gut und gerne fünf Meter hoch, getragen von meterdicken Betonsäulen. Vor mir erstreckte sich ein Raum von bestimmt 20 Metern Länge und zehn Metern Breite, der an seinem gegenüberliegenden Ende abbog und dort offenbar weiterging. An den Wänden lagerten gestapelte Leisten, die für mich aussahen wie Stahlträger. Zu meiner Linken gab es einen weiteren Raum, den ich auf etwa 15 Meter Länge schätzte bei vielleicht acht Metern Breite. In vier Stunden bekam man das hier nicht sauber. So viel sah ich gleich. Im Gegenteil konnten diese Räumlichkeiten einen Frühjahrsputz gebrauchen, für den ich Jahre an Arbeit veranschlagte. Vorsichtig ging ich ein paar Schritte hinein, ehrfürchtig wie in einer Kirche. Vorbei an einem blauen Container, der nicht nur locker hineinpasste, sondern der fast klein wirkte. Überall sah ich Lagerregale mit Spaten, Zangen und anderen Geräten. Ich knöpfte meine Strickjacke zu, das nächste Mal würde ich meinen Skianzug mitbringen. Besser ich bewegte mich, sonst fror ich noch fest.